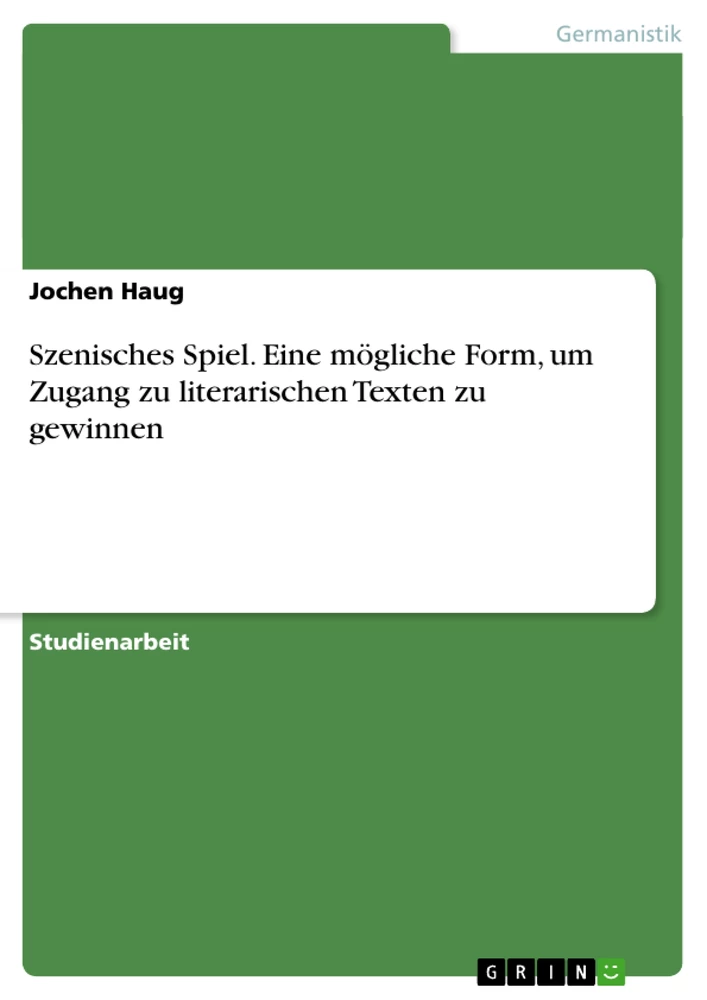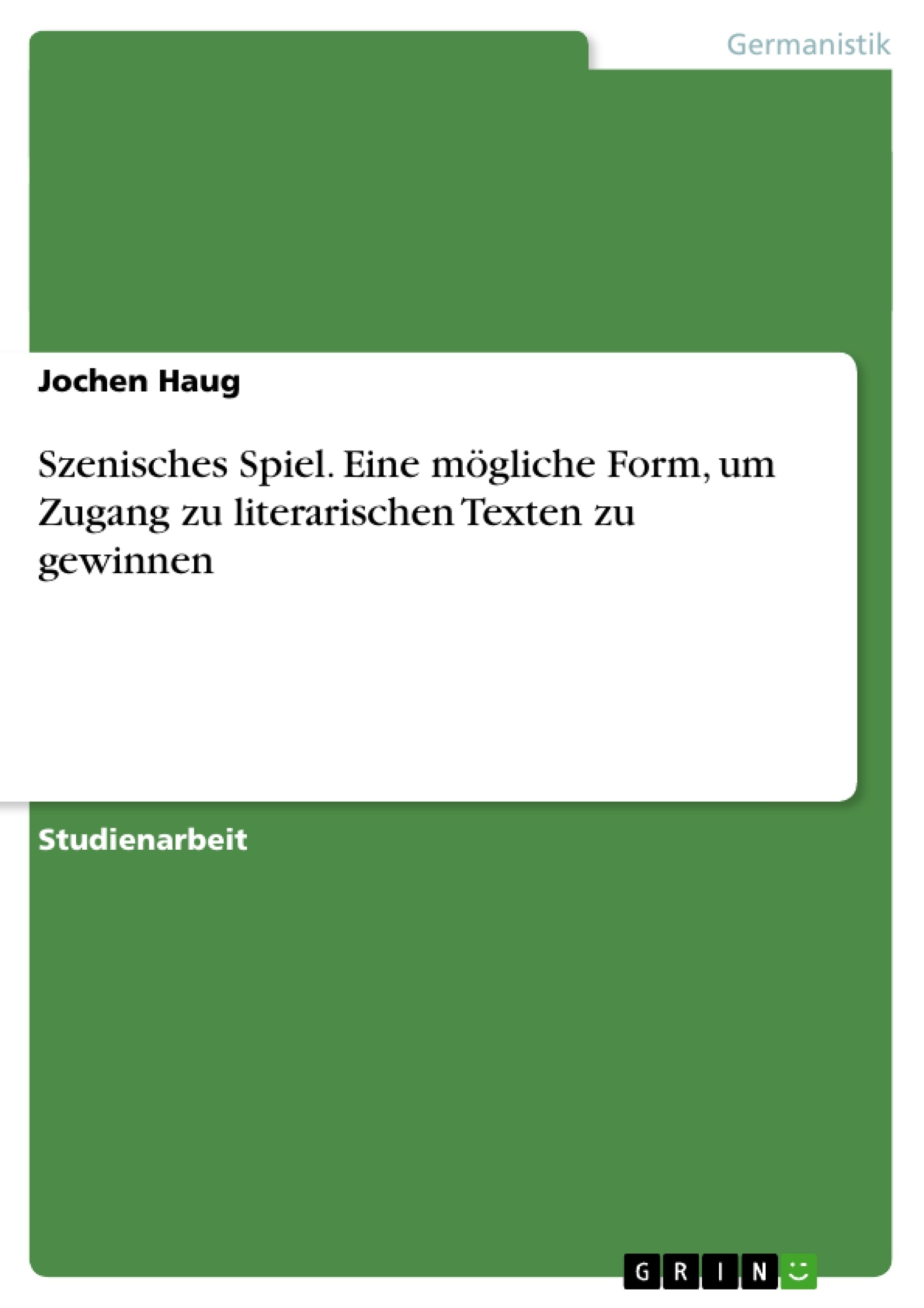Der Begriff „szenische Interpretation“ schließt sehr viele verschiedene Verfahren ein.
Hierzu gehören z.B. auch Phantasiereisen, Rollenschreiben, szenisches Lesen,
Rollengespräche, Standbilder, usw.1 In dieser Arbeit möchte ich mich jedoch auf das
Verfahren des „szenischen Spiels“ oder auch des „literarischen Rollenspiels“ beschränken,
da ich mit dieser Form auch selbst schon Erfahrungen gesammelt habe.
Im ersten Teil soll es darum gehen, weshalb produktions- und handlungsorientierte
Unterrichtsformen sinnvoll erscheinen. Des weiteren möchte ich klären, welches
Textverständnis und welche Rezeptionsauffassung für dieses Verfahren von Nöten sind,
bevor ich mich der Beschreibung des Verfahrens zuwende. Abschließend möchte ich noch
ein Beispiel aus eigener Erfahrung anbringen.
1.2 Sammlung von Materialien
Als ich auf der Suche nach geeignetem Material für diese Arbeit war, stellte ich sehr bald
fest, dass es einerseits sehr viel Literatur zum Thema „Theater in der Schule“ und
„Aufführungen in der Schule“ gibt, andererseits viel zu „sprachdidaktischen Rollenspielen“
als Therapieform oder zur Konfliktbewältigung. Über die Literaturhinweise in diesen
Büchern gelang es mir aber dann schließlich, etwas zu dem Thema zu finden, wie literarische
Texte durch Rollenspiele oder andere szenischen Darstellungsformen analysiert und
interpretiert werden können. So beschäftigte ich mich zunächst mit „Handlungs- und
Produktionsorientierten“ Unterrichtsformen, bevor ich mich den eigentlichen
Vorgehensweisen von „literarischem Rollenspiel“, „szenischer Interpretation“ und deren
verschiedenen Arbeitsformen widmete.
1 Vgl.: Scheller, Ingo: Wir machen unsere Inszenierungen selber (1) – Szenische Interpretation von
Dramentexten. Universität Oldenburg: Zentrum für pädagogische Berufspraxis 1989
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeption
- Sammlung von Materialien
- Wie es zur Arbeit kam
- Didaktische Grundgedanken
- Weshalb andere Unterrichtsformen?
- Problem des Rezeptionsmodells
- Textverständnis der Schüler
- Das Spiel
- Prinzipien
- Ganzheitliches Lernen
- Beschreibung des Spiels
- Spielverlauf
- Einfühlung in Rollen
- Raum und Requisiten
- Die Rolle des Spielleiters/Lehrers
- Grenzen des Spiels
- Eigene Erfahrungen
- Abschließende Bemerkung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Verwendeter Textausschnitt aus Friedrich Dürrenmatts Die Physiker
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwendung des „szenischen Spiels“ im Literaturunterricht als Mittel zur Erschließung literarischer Texte. Die Autorin argumentiert, dass diese Form des Unterrichts, im Gegensatz zu traditionelleren Methoden, Schülern einen lebendigen und interaktiven Zugang zum Text ermöglichen kann, der das Textverständnis und die Rezeption fördert.
- Bedeutung und Potenzial von produktions- und handlungsorientierten Unterrichtsformen
- Probleme des traditionellen Rezeptionsmodells im Literaturunterricht
- Die Rolle des „szenischen Spiels“ bei der Förderung des Textverständnisses
- Beschreibung der Prinzipien und Praxis des „szenischen Spiels“
- Bewertung der Grenzen und Möglichkeiten des „szenischen Spiels“ im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Arbeit ein und erläutert das Konzept des „szenischen Spiels“ als Methode im Literaturunterricht. Es werden die Beweggründe für diese Arbeit sowie die gesammelten Materialien erläutert, bevor der Weg zur Entstehung des Projekts beschrieben wird.
Das Kapitel „Didaktische Grundgedanken“ untersucht, warum alternative Unterrichtsformen im Literaturunterricht relevant sind und wie diese das Textverständnis fördern können. Hier werden die Herausforderungen des traditionellen Rezeptionsmodells und die Notwendigkeit einer aktiven und interaktiven Herangehensweise an den Text beleuchtet.
Das Kapitel „Das Spiel“ geht auf die Prinzipien und die praktische Umsetzung des „szenischen Spiels“ im Unterricht ein. Die Autorin beschreibt die verschiedenen Aspekte des Spiels, darunter Spielverlauf, Einfühlung in Rollen und die Gestaltung des Raumes. Außerdem wird die Rolle des Lehrers und die Grenzen des Spiels untersucht.
Das Kapitel „Eigene Erfahrungen“ dient dazu, persönliche Erfahrungen der Autorin mit dem „szenischen Spiel“ zu teilen. Es wird ein konkretes Beispiel vorgestellt, das die positive Wirkung dieser Methode verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Szenisches Spiel, literarisches Rollenspiel, Textverständnis, Rezeption, Unterrichtsformen, Literaturunterricht, produktionsorientierte Unterrichtsformen, handlungsorientierter Unterricht, Theater in der Schule, didaktische Grundgedanken, Ganzheitliches Lernen, Spielverlauf, Raum und Requisiten, Rolle des Spielleiters, Grenzen des Spiels
- Quote paper
- Jochen Haug (Author), 2002, Szenisches Spiel. Eine mögliche Form, um Zugang zu literarischen Texten zu gewinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19364