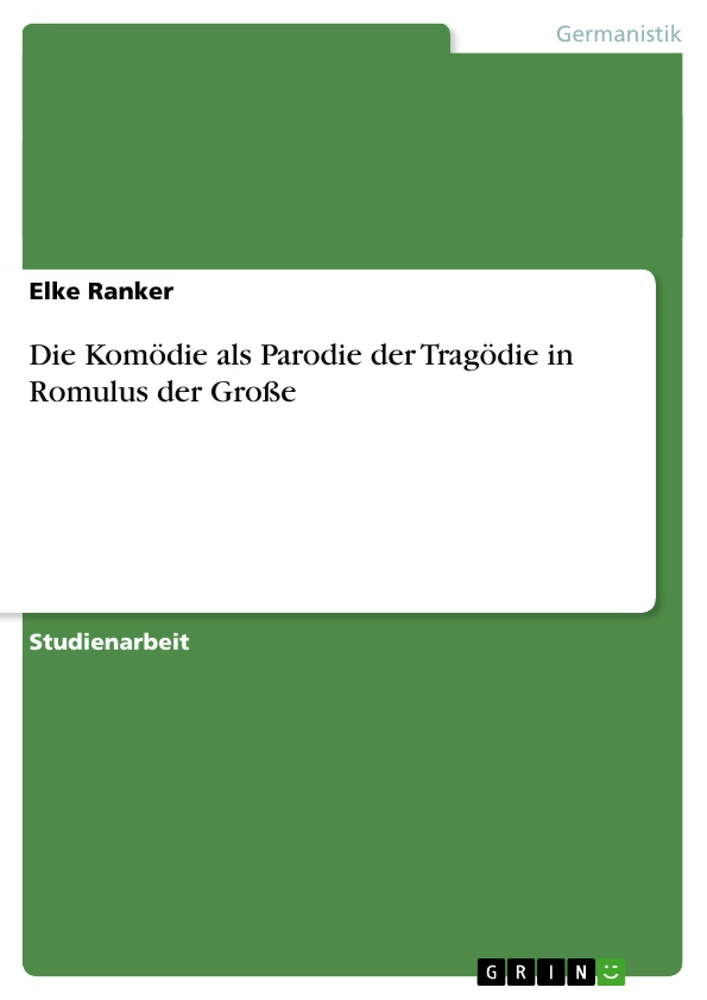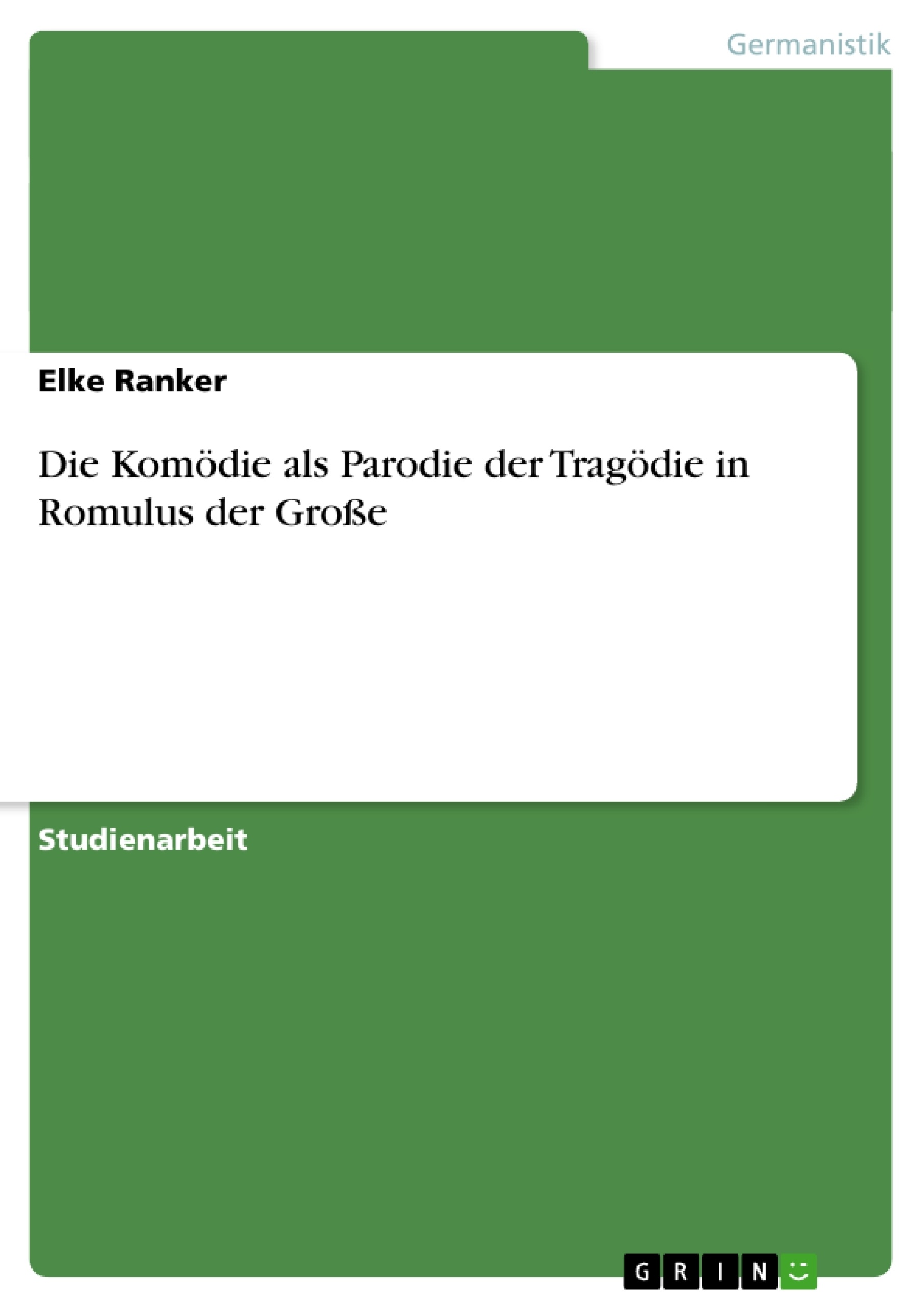„Eine schwere Komödie, weil sie scheinbar leicht ist.“1So beurteilt Dürrenmatt
das Stück „Romulus der Große“. Er hat mit seiner „ungeschichtlichen historischen
Komödie“ seine Tragödienkritik zum Ausdruck gebracht, indem er die Tragödie
in seinem Werk überspitzt und komisch nachgeahmt hat. Sämtliche tragischen
Momente werden ins Komische verkehrt und man kann sagen, dass er die Tragödie
auf diese Weise parodiert.
Genau diese „Parodie der Tragödie“ soll in dieser Arbeit nachgewiesen und aufgezeigt
werden, in Zusammenhang mit Dürrenmatts Tragödien- und Komödienverständnis.
2 Allgemeine Merkmale der Tragödie
Tragödie kommt von dem griechischen Wort „tragodia“ und bedeutet Bocksgesang,
was gleichbedeutend mit „tragisches Drama“ bzw. „Trauerspiel“ ist. Die
Tragödie ist „neben der Komödie die wichtigste Gattung des europäischen Dramas“
2 und entstand anlässlich des Kultfestes des Dionysos in Griechenland. Die
bekanntesten Tragiker der griechischen Antike waren Aischylos, Sophokles und
Euripides. Die Tragödie ist gekennzeichnet durch „einen schicksalhaften, unvermeidlichen
und unausgleichbaren Gegensatz, der zum Untergang des Protagonisten
führt“3. Die Stoffe der antiken Tragödie wurden der „mythisch-sagenhaften
Überlieferung“4 entnommen. Als erster wichtiger Tragiker der Neuzeit wird
Shakespeare betitelt. Bei seinen Dramen geht es um den Konflikt des Einzelnen
mit sich selbst oder mit anderen Mächten.
Lessing als erster bedeutender deutscher Tragiker durchbrach das klassische Tragödienschema,
da er von der gehobenen Rede ebenso absah wie von der gehobenen
Gesellschaft. Sein Ziel war, die Selbstidentifikation des Zuschauers mit dem
Helden auf der Bühne zu verstärken. „Die Erregung von Furcht und Schrecken bei den Zuschauern, die letztlich eine Reinigung von diesen Affekten bewirken soll,
wird bei LESSING zur Erregung von Mitleid und von Furcht als auf sich selbst
bezogenem Mitleid.“5
1Anmerkung I zu Romulus der Große, S.119
2Brockhaus Enzyklopädie 1993, Bd. 22, S. 300
3ebd.
4ebd.
5ebd.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Merkmale der Tragödie
- Allgemeine Merkmale der Komödie
- Dürrenmatts Komödien- und Tragödienverständnis
- Dürrenmatt über die Tragödie
- Dürrenmatt über die Komödie
- Die Komödie als Parodie der Tragödie in „Romulus der Große“
- Das Drama als Parodie
- Klassischer Aufbau des Dramas
- Einheit der Zeit
- Einheit des Ortes
- Einheit der Handlung
- Kulissenanweisungen
- Regieanweisungen
- Parodie von Shakespeare
- Parodie von Sophokles
- Personal
- Julia
- Ämilian
- Spurius Titus Mamma
- Cäsar Rupf
- Apollyon
- Zeno
- Odoaker
- Romulus als Hauptfigur
- Sprache
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Dürrenmatts „Romulus der Große“ als eine Parodie der Tragödie. Die Arbeit analysiert, wie Dürrenmatt gängige Elemente der Tragödie aufgreift und sie in komödiantische Elemente umwandelt. Die Zielsetzung ist es, Dürrenmatts Verständnis von Tragödie und Komödie zu beleuchten und dies anhand der Dramenstruktur und der Figurenzeichnung in „Romulus der Große“ zu veranschaulichen.
- Dürrenmatts Verständnis von Tragödie und Komödie
- Die Dramaturgie der Parodie in "Romulus der Große"
- Die Charakterisierung der Figuren als Spiegelbild tragischer Archetypen
- Die Funktion der Sprache und des Dialogs in der komödiantischen Umdeutung der Tragödie
- Der Vergleich mit klassischen Tragödien (Shakespeare, Sophokles)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Dürrenmatts „Romulus der Große“ eine Parodie der Tragödie darstellt. Das Stück wird als „schwere Komödie“ charakterisiert, die durch die Überspitzung tragischer Elemente komische Effekte erzeugt. Die Arbeit kündigt die Analyse dieser Parodie an, im Kontext von Dürrenmatts Verständnis von Tragödie und Komödie.
Allgemeine Merkmale der Tragödie: Dieses Kapitel definiert die Tragödie anhand ihrer Ursprünge im griechischen Theater. Es beschreibt die zentralen Merkmale der Tragödie, wie den schicksalhaften Untergang des Protagonisten, den unvermeidlichen Konflikt und die Verwendung mythischer Stoffe. Der Einfluss von Autoren wie Aischylos, Sophokles, Euripides und Shakespeare auf die Entwicklung der Tragödie wird erläutert, ebenso wie Lessings Bruch mit dem klassischen Tragödienschema und dessen Fokus auf Mitleid und Furcht beim Zuschauer.
Allgemeine Merkmale der Komödie: Ähnlich wie das vorherige Kapitel, beschreibt dieses die Komödie, ausgehend von ihren griechischen Wurzeln. Es werden die typischen Merkmale der Komödie wie heiterer Inhalt und glücklicher Ausgang erläutert. Die große formale und thematische Variationsbreite der Komödie wird hervorgehoben, und die Entwicklung von der Gesellschaftskritik hin zu typisch menschlichen Fehlern und deren pädagogischer Wirkung wird diskutiert. Die zunehmende Aufhebung der Grenzen zwischen Komödie und ernstem Drama in der Moderne wird ebenfalls thematisiert.
Dürrenmatts Komödien- und Tragödienverständnis: Dieses Kapitel beleuchtet Dürrenmatts eigene Sicht auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Tragödie und Komödie. Dürrenmatt sieht die Unterscheidung primär in den Entstehungsbedingungen und weniger in der Kunst selbst. Er betrachtet Tragödie und Komödie als "Formbegriffe", die Gleiches umschreiben können. Das Kapitel legt die Grundlage für die folgende Analyse von „Romulus der Große“ als eine spezielle Form der Komödie, die Elemente der Tragödie aufgreift und uminterpretiert.
Schlüsselwörter
Romulus der Große, Friedrich Dürrenmatt, Tragödie, Komödie, Parodie, Dramaturgie, Figurencharakterisierung, Sprache, Shakespeare, Sophokles, Komik, Tragik, überspitzung, historische Komödie.
Häufig gestellte Fragen zu Dürrenmatts "Romulus der Große" - Seminararbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Stück "Romulus der Große" als Parodie der Tragödie. Sie untersucht, wie Dürrenmatt klassische Elemente der Tragödie aufgreift und in komödiantische Elemente umwandelt.
Welche Aspekte von "Romulus der Große" werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Dürrenmatts Verständnis von Tragödie und Komödie, die Dramaturgie der Parodie im Stück, die Figurencharakterisierung als Spiegelbild tragischer Archetypen, die Funktion der Sprache und des Dialogs in der komödiantischen Umdeutung der Tragödie und vergleicht das Stück mit klassischen Tragödien von Shakespeare und Sophokles.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu den allgemeinen Merkmalen der Tragödie und Komödie, ein Kapitel zu Dürrenmatts eigenem Verständnis beider Gattungen, eine detaillierte Analyse von "Romulus der Große" als Parodie (inkl. Betrachtung der Dramenstruktur, Figuren wie Romulus, Julia, Ämilian etc., Sprache und Stil), und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Romulus der Große, Friedrich Dürrenmatt, Tragödie, Komödie, Parodie, Dramaturgie, Figurencharakterisierung, Sprache, Shakespeare, Sophokles, Komik, Tragik, Überspitzung, historische Komödie.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These ist, dass Dürrenmatts "Romulus der Große" eine Parodie der Tragödie darstellt, eine "schwere Komödie", die durch die Überspitzung tragischer Elemente komische Effekte erzeugt.
Wie definiert die Arbeit Tragödie und Komödie?
Die Arbeit definiert Tragödie und Komödie anhand ihrer historischen Entwicklung, beginnend mit dem griechischen Theater. Es werden die typischen Merkmale beider Gattungen, wie z.B. der Untergang des Helden bei der Tragödie und der glückliche Ausgang bei der Komödie, beschrieben. Die Arbeit hebt auch die zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen Tragödie und Komödie in der Moderne hervor.
Welche Rolle spielt Dürrenmatts persönliches Verständnis von Tragödie und Komödie?
Dürrenmatts eigene Sicht auf Tragödie und Komödie wird ausführlich behandelt. Die Arbeit zeigt, dass Dürrenmatt die Unterscheidung zwischen beiden Gattungen primär in den Entstehungsbedingungen und weniger in der Kunst selbst sieht. Er betrachtet sie als "Formbegriffe", die Gleiches umschreiben können.
Wie wird "Romulus der Große" als Parodie analysiert?
Die Analyse von "Romulus der Große" als Parodie umfasst die Untersuchung der Dramenstruktur (Einheiten von Zeit, Ort und Handlung), der Figurenzeichnung, der Sprache und des Dialogs, sowie den Vergleich mit klassischen Tragödien von Shakespeare und Sophokles. Die Arbeit beleuchtet, wie Dürrenmatt durch die Überspitzung tragischer Elemente komische Effekte erzielt.
- Quote paper
- Elke Ranker (Author), 2002, Die Komödie als Parodie der Tragödie in Romulus der Große, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19294