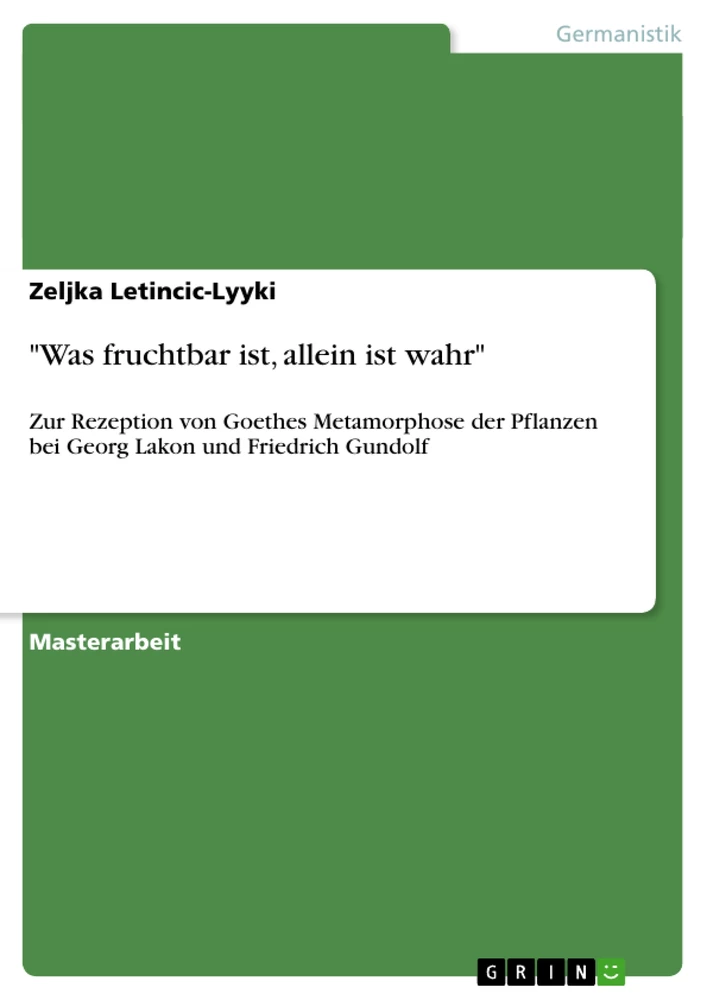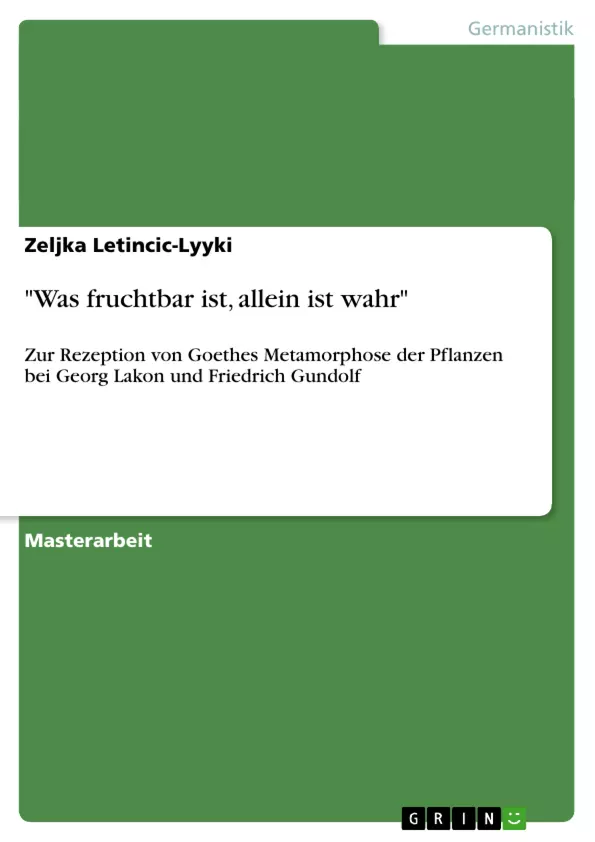Zusammenfassung:
Die vorliegende Magisterarbeit widmet sich den Rezeptionen von Lakon und Gundolf über Goethes Prosaabhandlung Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären. Die entsprechenden Auswertungen der Realisationen werden an die rezeptionstheoretischen Ansätze angelehnt. Diese Arbeit geht der grundlegenden Auffassung der Rezeptionstheorie nach, die besagt, dass die Bedeutung eines Textes nicht einfach in ihm enthalten ist, wie etwa ein bestimmter Stoff in einer chemischen Verbindung sondern vielmehr wird die Bedeutung erst während der Rezeption gebildet und zwar im Wechselspiel zwischen dem Text und der Aktivität des Lesers. Im weiterem wird auf die zwei Fragen eingegangen: welche Rolle hat der Leser in dem geschichtlichen Leben eines Werkes sowie in welchem Sinne kann man von einer adäquaten Rezeption sprechen? Zudem soll das Niederschreiben als auch das Lesen seinen Beitrag dazu leisten, durch das Studieren von fremden Systemen ein eigenes System zu finden
Das Konzept der Rezeption unterscheidet sich von den historischen Thematisierungen des Lesers und des Textes. Aus der wirkungsästhetischen Perspektive sind die Rezeptionen von Lakon und Gundolf handlungsorientierte und sinnstiftende Reflexionen sowie Gegenstand für Autoren Selbstreflexion. Die Aktualisierung und Entfaltung der zunächst potentiellen Textbedeutung der Metamorphose der Pflanze wird auf die Rezeption der Erwartungshorizonte Lakons und Gundolfs bezogen. Dies geschieht bezogen auf ein System lebensweltlicher, wertmaßstäblicher und ästhetischer Normen, von deren Hintergrund der Text wahrgenommen und wieder in dialogischer Beziehung als Text konstruiert wird. Dem Wandel des Erwartungshorizonts entspricht ein Wandel der konstruierten und erlebten Textbedeutungen.
Die Analyse von Lakons und Gundolfs Realisationen zeigt deutlich, dass die Bedeutung von Goethes Metamorphose der Pflanze erst während der aktiven Rezeption Lakons und Gundolfs gebildet wurde, da sie unter unterschiedlichen wirkungsästhetischen Perspektiven sowie Autoren Selbstreflexionen realisiert worden sind. Aufgrund dessen, wird die zentrale Auffassung der Rezeptionstheorie bestätigt.
Schlagwörter: Rezeption, Rezeptionsgeschichte, Rezeptionsästhetik, Erwartungshorizont, (Literarische)Wertung, Dialogizität, Horizontverschmelzung, Reflexion, Kontemplation, Konkretisation, Metamorphose.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1 Einleitung
- 1.1 Material
- 1.2 Focus und die Fragestellung der Arbeit
- 1.3 Methode
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 2 Seiner Zeit voraus
- 2.1 Johann Wolfgang von Goethe und Metamorphose der Pflanze
- 2.2 Georg Lakon und Goethes Pflanzenmetamorphose
- 2.3 Friedrich Gundolf und sein Absatz Natur in dem Buch Goethe
- 3 Rezeptionstheoretische Ansätze
- 3.1 Rezeptionsvorgang und Wertung
- 3.2 Rezeption als Terminus und Konzept
- 3.3 Die Geschichte der Rezeption
- 3.4 Rezeptionsästhetik
- 3.5 Was versteht man unter dem Begriff Wertung?
- 3.6 Das Verlangen nach Konkretisation
- 3.7 Naturwissenschaftliche Begriffserläuterungen
- 3.8 Zur Theorie der Rezeptionspraxis
- 4 Empirische Analyse
- 4.1 Methodologische Vorgehensweisen
- 4.2 Analyse von Lakons Realisation
- 4.3 Analyse von Gundolfs Realisation
- 4.4 Das Dialogische beim Gundolf
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Rezeption von Goethes „Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären“ durch Georg Lakon und Friedrich Gundolf. Die Arbeit untersucht, inwiefern die Bedeutung des Textes nicht in ihm selbst, sondern erst im Wechselspiel zwischen dem Text und der Aktivität des Lesers gebildet wird. Insbesondere wird auf die Rolle des Lesers im geschichtlichen Leben eines Werkes und die Frage nach adäquater Rezeption eingegangen.
- Die Rolle des Lesers in der Rezeption von Texten
- Das Konzept des Erwartungshorizonts und seine Bedeutung für die Rezeption
- Die Bedeutung von Wertung und Konkretisation im Rezeptionsprozess
- Die Analyse von Lakons und Gundolfs Rezeptionen von Goethes „Metamorphose der Pflanze“
- Die kommunikative Leistung der ästhetischen Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Die Arbeit stellt das Material, den Fokus, die Fragestellung und die Methode vor.
- Kapitel 2: Seiner Zeit voraus
- Dieses Kapitel beleuchtet die Biografien von Goethe, Lakon und Gundolf sowie ihre jeweiligen Werke.
- Kapitel 3: Rezeptionstheoretische Ansätze
- Dieses Kapitel liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse, indem es zentrale Begriffe der Rezeptionstheorie und -ästhetik definiert und erläutert.
- Kapitel 4: Empirische Analyse
- Dieses Kapitel analysiert Lakons und Gundolfs Rezeptionen anhand der definierten Kriterien und Methoden.
- Kapitel 5: Zusammenfassung und Ausblick
- Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der Rezeptionstheorie und -ästhetik, wie Rezeption, Rezeptionsgeschichte, Rezeptionsästhetik, Erwartungshorizont, Wertung, Dialogizität, Horizontverschmelzung, Reflexion, Kontemplation, Konkretisation und Metamorphose. Diese Begriffe werden im Kontext von Goethes „Versuch die Metamorphose der Pflanze zu erklären“ und den Rezeptionen Lakons und Gundolfs analysiert.
- Arbeit zitieren
- Zeljka Letincic-Lyyki (Autor:in), 2010, "Was fruchtbar ist, allein ist wahr", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192638