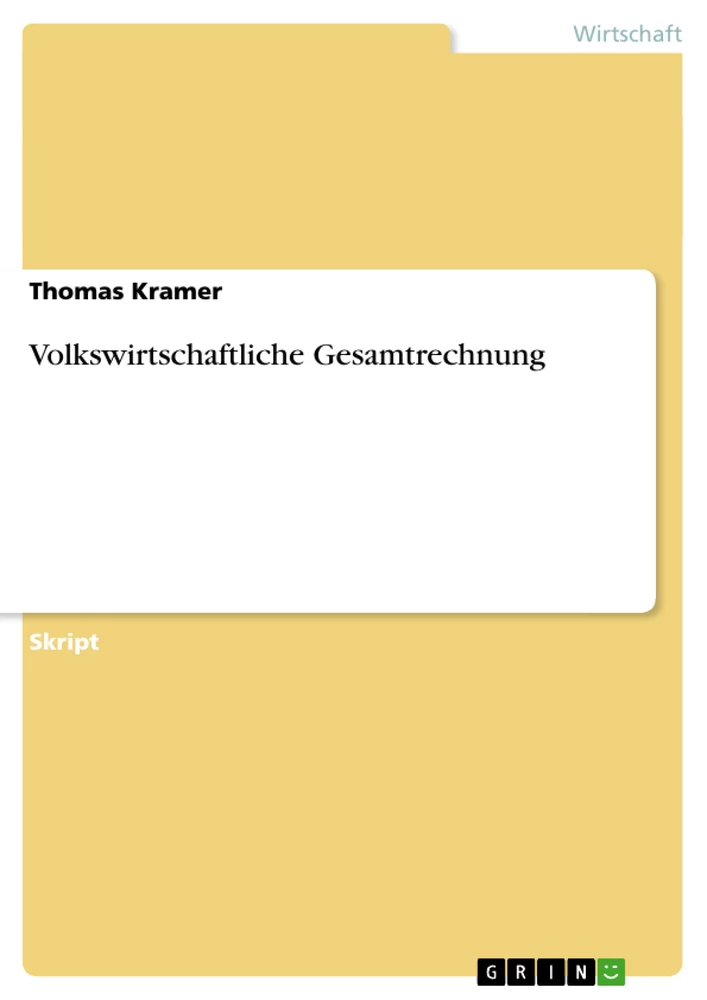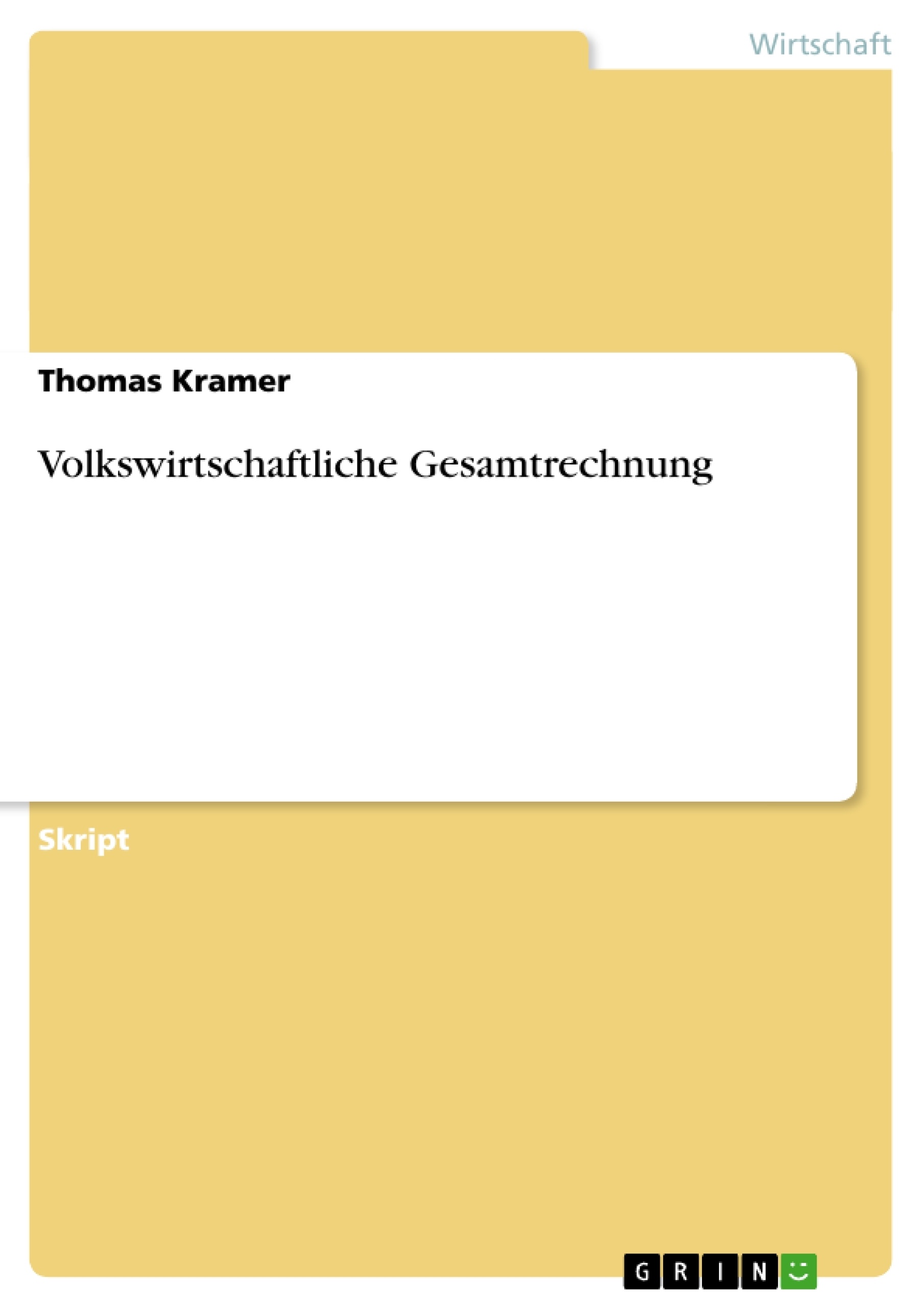Eine stichwortartige Einführung in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit Definitionen, Formeln und Buchungen. Gut für Klausurvorbereitung, um sich in den Begrifflichkeiten auszukennen. Inhalte des 7-seitigen Skriptes:
-Was sind ex-ante und ex-post Analysen?
-Unterschied Stromgröße und Bestandsgröße
-Finanzierungssaldo vs. Ersparnis
-Finanztransaktion vs. Leistungstransaktion
-Vermögensübertragungen vs. Einkommensübertragungen
-Ermittlung der Nettoinvestitionen
-Klassische Sich vs. keynesianische Sicht
-Staatsausgaben vs. Staatsverbrauch
-Formel für Finanzierungsdefizit (für geschlossene und offene Volkswirtschaft)
-Leistungsbilanzsaldo
-Vorleistungen vs. Faktorleistungen
-Berechnung Nettowertschöpfung
-Indirekte vs. Direkte Steuern
-Ineffizienzen in der Volkswirtschaft
-Inlandskonzept vs. Inländerkonzept
-Faktoreinkommen
-Verfügbares Einkommen der Volkswirtschaft
-Berechnungen des Bruttosozialproduktes
-Inlandsprodukt nach der Entstehungsseite und Güterverwendungsseite
-Einkommensverteilung
-Leistungsbilanz + Teilbilanzen
-Leistungsbilanzsaldo
-Nettoauslandsvermögen
Inhaltsverzeichnis
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Ex-Ante Analyse
- Ex-Post Analyse
- Bestandsgröße
- Stromgröße
- Finanzierungssaldo
- Ersparnis
- Nettoinvestitionen
- Ex-Post Identität
- Staatsausgaben
- Leistungsbilanzsaldo
- Vorleistungen
- Nettowertschöpfung
- Indirekte Steuern
- Ineffizienzen in der VW
- Inlandskonzept
- Inländerkonzept
- Faktoreinkommen
- Verfügbares Einkommen der VW
- Berechnungen des Bruttosozialproduktes
- Inlandsprodukt nach der Entstehungsseite
- Güterverwendungsseite
- Einkommensverteilungsseite
- Einkommensverwendungsseite
- Produktionswert eines Wirtschaftszweiges (Sektor)
- Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
- Investitionsquote
- Exportquote
- Importquote
- Staatsausgabenquote
- Staatsverbrauchsquote
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt eine Übersicht über wichtige Konzepte der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Ziel ist es, die Unterscheidung zwischen Ex-Ante und Ex-Post Analysen, Bestands- und Stromgrößen, sowie verschiedene Berechnungsmethoden des Bruttosozialprodukts zu erläutern.
- Ex-Ante vs. Ex-Post Analysen in der VGR
- Bestandsgrößen und Stromgrößen in der ökonomischen Analyse
- Berechnung und Interpretation des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
- Analyse der Staatsausgaben und deren Einfluss auf die Volkswirtschaft
- Unterschiede zwischen Inlandskonzept und Inländerkonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Dieser Abschnitt führt in die grundlegende Methodik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein und legt den Rahmen für die folgenden Analysen. Es werden die zentralen Konzepte und Zusammenhänge der gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise eingeführt, die für das Verständnis der späteren Kapitel essentiell sind. Die Darstellung der VGR als gesamtwirtschaftliches Rechnungssystem bildet die Grundlage für die Analyse von makroökonomischen Zusammenhängen.
Ex-Ante Analyse: Dieses Kapitel befasst sich mit der vorausschauenden Methode der Ex-Ante Analyse. Es erklärt, wie geplante Größen verwendet werden, um zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen zu prognostizieren. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Planungs- und Erwartungsgrößen zur Erklärung zukünftiger volkswirtschaftlicher Zusammenhänge. Im Gegensatz zur Ex-Post Analyse, die auf vergangenen Daten basiert, konzentriert sich die Ex-Ante Analyse auf die antizipierten Entwicklungen.
Ex-Post Analyse: Im Gegensatz zur Ex-Ante Analyse beschreibt dieses Kapitel die rückschauende Betrachtungsweise der Ex-Post Analyse. Hier werden realisierte Daten verwendet, um vergangene volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu beschreiben und zu analysieren. Die VGR und Kreislaufanalysen werden als Beispiele für die Anwendung der Ex-Post Analyse genannt, die auf bereits abgelaufenen Ereignissen basiert und somit eine deskriptive Funktion hat.
Bestandsgröße: Dieses Kapitel definiert Bestandsgrößen als in Geldeinheiten gemessene Größen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ermittelt werden. Es werden verschiedene Beispiele für Bestandsgrößen genannt, wie Wertpapierbestände, Kapitalstock oder Arbeitslosigkeit. Die Unterscheidung von Bestandsgrößen und Stromgrößen ist zentral für das Verständnis der VGR und der gesamtwirtschaftlichen Analyse.
Stromgröße: Hier werden Stromgrößen als in Geldeinheiten gemessene Größen definiert, die sich auf einen bestimmten Zeitraum beziehen, meist ein Jahr. Es werden Beispiele wie Einkommen, Konsum oder Investitionen angeführt. Der Unterschied zu Bestandsgrößen wird herausgestellt, wobei der Fokus auf der zeitlichen Dimension der Messung liegt.
Finanzierungssaldo: Das Kapitel erläutert den Finanzierungssaldo im Kontext von Geldvermögen und Leistungstransaktionen. Es werden die Veränderungen der Struktur und des Niveaus des Geldvermögens durch Finanz- und Leistungstransaktionen differenziert. Der Unterschied zwischen regelmäßigen und nicht-regelmäßigen Einkommens- und Vermögensübertragungen wird hervorgehoben.
Ersparnis: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Ersparnis und deren Beziehung zu Investitionen. Es wird der Zusammenhang zwischen Ersparnis, Geldvermögen und Reinvermögen erläutert. Die Bedeutung der Ersparnis als eine wichtige Größe für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird unterstrichen.
Nettoinvestitionen: Hier wird der Begriff der Nettoinvestitionen im Kontext von Bruttoinvestitionen und Abschreibungen erklärt. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoinvestitionen wird klar definiert, um Missverständnisse zu vermeiden und das Verständnis der Kapitalbildung zu verbessern.
Ex-Post Identität: Dieses Kapitel untersucht die Ex-Post Identität im Kontext von Angebots- und Nachfrageüberhängen. Es werden die Anpassungsprozesse am Gütermarkt unter klassischer und keynesianischer Sichtweise verglichen, unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Beschäftigung.
Staatsausgaben: Das Kapitel beschreibt Staatsausgaben, unterteilt in Staatsverbrauch und Transfers. Es wird der Zusammenhang zwischen Staatsausgaben, Einnahmen und dem Finanzierungsdefizit des öffentlichen Haushalts erläutert. Die Formel für den Finanzierungssaldo des öffentlichen Haushalts wird vorgestellt.
Leistungsbilanzsaldo: Dieser Abschnitt behandelt den Leistungsbilanzsaldo im Kontext der offenen Volkswirtschaft. Es wird der Zusammenhang zwischen Exporten, Importen, Übertragungen und dem Nettoauslandsvermögen erläutert. Die Formel für den Leistungsbilanzsaldo wird definiert und die Auswirkungen auf das Nettoauslandsvermögen werden erklärt.
Vorleistungen: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Vorleistungen, die im Produktionsprozess verbraucht werden. Der Unterschied zu den dauerhaften Gütern wird hervorgehoben, und ein Beispiel wird gegeben, um das Konzept zu veranschaulichen.
Nettowertschöpfung: Hier wird die Nettowertschöpfung definiert und im Verhältnis zu den Faktorleistungen gesetzt. Die Berechnung der Nettowertschöpfung aus dem Produktionswert und den Vorleistungen wird erläutert.
Indirekte Steuern: Dieses Kapitel definiert indirekte Steuern im Gegensatz zu direkten Steuern. Beispiele für indirekte Steuern werden genannt und die Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Rechnung erklärt.
Ineffizienzen in der VW: Dieser Abschnitt behandelt die Auswirkungen von Ineffizienzen auf den öffentlichen Haushalt und Unternehmen. Es wird gezeigt, wie sich Ineffizienzen in der Produktion und im Eigenverbrauch niederschlagen.
Inlandskonzept: Das Kapitel erklärt das Inlandskonzept zur Berechnung des Inlandsprodukts, wobei der Fokus auf dem Produktionsort liegt, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der beteiligten Akteure.
Inländerkonzept: Im Gegensatz zum Inlandskonzept wird hier das Inländerkonzept vorgestellt, welches die Ressourcen im Besitz von Inländern berücksichtigt, unabhängig vom Produktionsort.
Faktoreinkommen: Dieser Abschnitt definiert Faktoreinkommen, unterteilt in Einkommen aus unselbstständiger und selbstständiger Arbeit. Es werden die Komponenten des Faktoreinkommens detailliert erklärt.
Verfügbares Einkommen der VW: Das Kapitel erläutert das verfügbare Einkommen der Volkswirtschaft und die Berechnung des verfügbaren Einkommens unter Berücksichtigung der Nettoersparnisse und Übertragungen.
Berechnungen des Bruttosozialproduktes: Hier werden verschiedene Methoden zur Berechnung des Bruttosozialprodukts (BSP) vorgestellt, unterteilt nach Güterverwendungsseite, Einkommensverteilungsseite und Einkommensverwendungsseite.
Inlandsprodukt nach der Entstehungsseite: Dieser Abschnitt beschreibt die Berechnung des Inlandsprodukts nach der Entstehungsseite, basierend auf der Wertschöpfung in verschiedenen Wirtschaftszweigen.
Güterverwendungsseite, Einkommensverteilungsseite, Einkommensverwendungsseite: Diese Abschnitte erklären detailliert die verschiedenen Ansätze der BIP-Berechnung und ihre jeweiligen Komponenten. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Berechnungsmethoden werden erläutert und die Bedeutung der jeweiligen Komponenten für das Verständnis der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hervorgehoben.
Produktionswert eines Wirtschaftszweiges (Sektor): Der Abschnitt erläutert die Berechnung des Produktionswerts eines einzelnen Wirtschaftszweiges und wie dieser zur Berechnung des BIP beiträgt.
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen: Hier wird die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen erklärt, unter Berücksichtigung von indirekten Steuern und Subventionen.
Investitionsquote, Exportquote, Importquote, Staatsausgabenquote, Staatsverbrauchsquote: Diese Abschnitte definieren und erläutern die jeweiligen Kennzahlen und ihre Bedeutung für die ökonomische Analyse. Sie zeigen, wie diese Quoten zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung herangezogen werden können.
Schlüsselwörter
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Ex-Ante Analyse, Ex-Post Analyse, Bestandsgröße, Stromgröße, Finanzierungssaldo, Ersparnis, Nettoinvestitionen, Staatsausgaben, Leistungsbilanzsaldo, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Inlandskonzept, Inländerkonzept, Faktoreinkommen, Indirekte Steuern.
Häufig gestellte Fragen zur Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Ex-Ante und Ex-Post Analysen, Bestands- und Stromgrößen sowie verschiedener Berechnungsmethoden des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt detailliert Konzepte wie Ex-Ante und Ex-Post Analysen, Bestands- und Stromgrößen, Finanzierungssalden, Ersparnisse, Nettoinvestitionen, Staatsausgaben, Leistungsbilanzsalden, Vorleistungen, Nettowertschöpfung, indirekte Steuern, Ineffizienzen, Inlandskonzept und Inländerkonzept. Es erklärt auch verschiedene Methoden zur Berechnung des BIP (nach der Entstehungs-, Güterverwendungs- und Einkommensseite) und wichtige Kennzahlen wie die Investitions-, Export-, Import-, Staatsausgaben- und Staatsverbrauchsquote.
Was ist der Unterschied zwischen Ex-Ante und Ex-Post Analysen?
Ex-Ante Analysen sind vorausschauend und verwenden geplante Größen zur Prognose zukünftiger Entwicklungen. Ex-Post Analysen hingegen sind rückschauend und analysieren bereits realisierte Daten vergangener wirtschaftlicher Zusammenhänge.
Was ist der Unterschied zwischen Bestands- und Stromgrößen?
Bestandsgrößen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen (z.B. Kapitalstock), während Stromgrößen sich auf einen Zeitraum beziehen (z.B. Einkommen pro Jahr).
Wie wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) berechnet?
Das BIP kann auf verschiedene Weisen berechnet werden: nach der Entstehungsseite (Wertschöpfung der einzelnen Wirtschaftszweige), der Güterverwendungsseite (Konsum, Investitionen, Staatsausgaben, Exporte minus Importe) und der Einkommensseite (Faktoreinkommen, indirekte Steuern).
Was ist der Unterschied zwischen Inlandskonzept und Inländerkonzept?
Das Inlandskonzept berücksichtigt die Produktion innerhalb der Landesgrenzen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Produzenten. Das Inländerkonzept erfasst hingegen das Einkommen von Inländern, unabhängig vom Produktionsort.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig zum Verständnis der VGR?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Ex-Ante Analyse, Ex-Post Analyse, Bestandsgröße, Stromgröße, Finanzierungssaldo, Ersparnis, Nettoinvestitionen, Staatsausgaben, Leistungsbilanzsaldo, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Inlandskonzept, Inländerkonzept, Faktoreinkommen und indirekte Steuern.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Dokument enthält für jedes der aufgeführten Themen im Inhaltsverzeichnis eine eigene Kapitelzusammenfassung, die die wichtigsten Punkte und Konzepte erläutert.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument eignet sich für Studierende und alle, die ein umfassendes Verständnis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) erwerben möchten. Es dient als fundierte Übersicht und bietet einen guten Einstieg in die Thematik.
Welche Kennzahlen werden zur Analyse der Volkswirtschaft verwendet?
Das Dokument erklärt und definiert wichtige Kennzahlen wie die Investitionsquote, Exportquote, Importquote, Staatsausgabenquote und Staatsverbrauchsquote und deren Bedeutung für die ökonomische Analyse.
- Citar trabajo
- Thomas Kramer (Autor), 1998, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1925