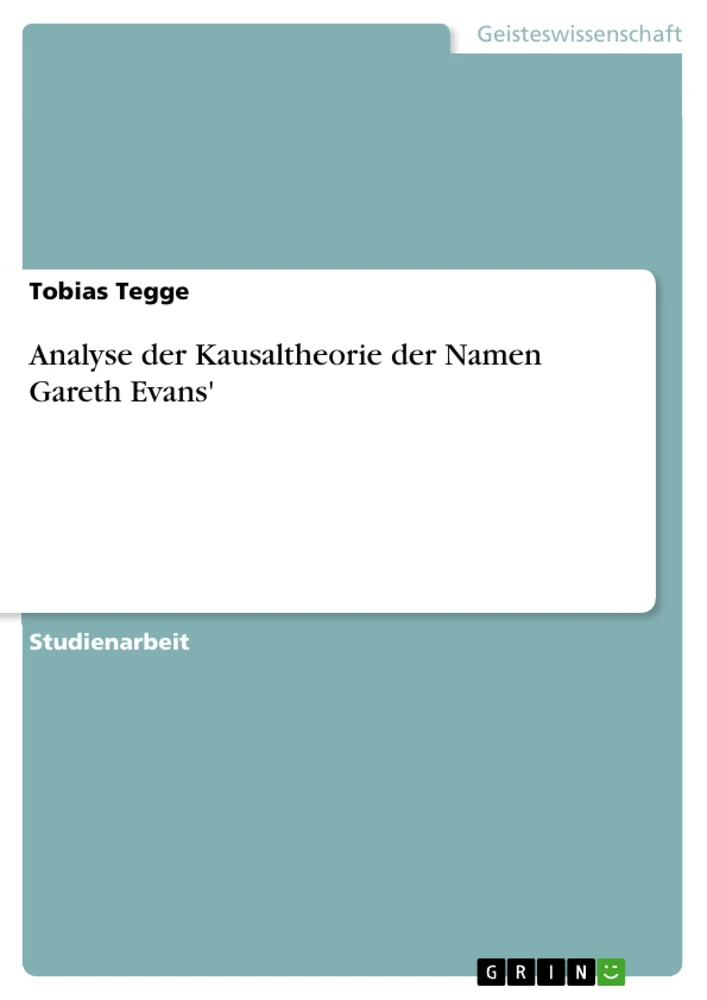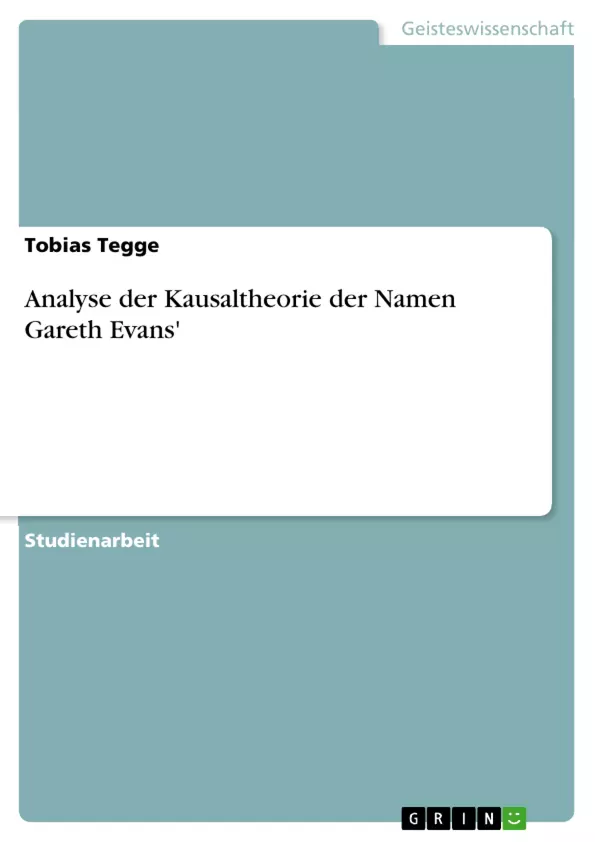Im folgenden Text, der sich auf Gareth Evans' „Causal Theory of Names“ und in Teilen auf Saul A. Kripkes „Name und Notwendigkeit“ bezieht, möchte ich eine Zielsetzung Evans' herausgreifen und seine Theorie hinsichtlich der Erfüllung dieser überprüfen, etwas, das Evans selbst in besagtem Aufsatz meines Erachtens übergeht.
Neben dieser Zielsetzung überprüfe ich auch ein Beispiel, das er zum Abschluss seines Textes gibt, um seine Thesen noch einmal zusammenzufassen. Außerdem stelle ich eine kurze Erklärung seiner Theorie voran. Zugunsten der besseren Verständlichkeit werde ich auf die in der Sprachphilosophie und in der Logik üblichen Abkürzungen weitgehend verzichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zielsetzung
- 2. Behandlung der „Causal Theory of Names“
- 2.1 Zusammenfassung
- Einleitung
- Die Beschreibungstheorien
- Eine Zusammenfassung der kausalen Theorie von Saul A. Kripke und eine Erläuterung des Gödel-Beispiels
- Die Erweiterung der kausalen Namenstheorie durch Evans
- 2.2 Erläuterung der für diese Hausarbeit relevanten Zielsetzung Evans' und des Madagaskar-Beispiels
- 2.3 Die Prüfung des Madagaskar-Beispiels
- Prämissen
- Analyse
- 2.4 Die Prüfung des Gödel-Beispiels
- Prämissen
- Analyse
- 2.5 Das Turnip-Beispiel
- Zusammenfassung des Beispiels
- Prämissen
- Wie verhält es sich hier mit den Informationen, die mit dem Namen „Turnip“ verbunden werden? Wer ist die Quelle dieser Informationen?
- In welcher Sprecher-Gemeinschaft herrscht über welche Bezüge Einigkeit?
- 2.1 Zusammenfassung
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Gareth Evans' "Causal Theory of Names" im Kontext von Saul A. Kripkes "Name und Notwendigkeit". Der Fokus liegt auf der Überprüfung einer spezifischen Zielsetzung Evans', die dieser in seinem Aufsatz meines Erachtens nicht ausreichend behandelt. Die Arbeit analysiert auch ein von Evans präsentiertes Beispiel (Madagaskar-Beispiel) zur Veranschaulichung seiner Theorie. Eine kurze Erklärung der Theorie selbst bildet den einleitenden Teil.
- Analyse der "Causal Theory of Names" von Gareth Evans
- Vergleich mit Kripkes kausaler Namenstheorie
- Überprüfung eines spezifischen Ziels von Evans' Theorie
- Analyse des Madagaskar-Beispiels
- Untersuchung der Rolle von Kontext und Sprechergemeinschaft in der Namensgebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zielsetzung: Die Arbeit untersucht eine spezifische Zielsetzung von Gareth Evans in Bezug auf seine "Causal Theory of Names", welche darin besteht, eine Theorie zu entwickeln, die die Namensgebung für geographische Orte (Madagaskar-Beispiel) von der Namensgebung für Personen (Gödel-Beispiel) differenziert. Die Arbeit überprüft Evans' Theorie auf ihre Eignung zur Erfüllung dieses Ziels und analysiert ergänzende Beispiele.
2. Behandlung der „Causal Theory of Names“: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über Evans' Theorie. Es beginnt mit einer Diskussion der Beschreibungstheorie der Namen und ihren zwei Varianten: der Beschreibungstheorie der Bezeichnung durch den Sprecher und der Beschreibungstheorie der Bezeichnung durch den Namen. Anschließend wird Kripkes kausale Namenstheorie zusammengefasst, insbesondere anhand des Gödel-Beispiels, welches die Schwächen der Beschreibungstheorie aufzeigt. Evans erweitert Kripkes Ansatz, indem er die Beschreibungstheorien mit dem kausalen Ansatz verbindet und den Kontext der Äußerung berücksichtigt. Ein zentraler Punkt ist die Dominanz des zu bezeichnenden Gegenstandes in der Informationsmenge, die der Sprecher mit dem Namen verbindet, sowie die Einigkeit einer Sprechergemeinschaft über die Namensverwendung.
2.2 Erläuterung der für diese Hausarbeit relevanten Zielsetzung Evans' und des Madagaskar-Beispiels: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Evans’ Ziel, eine Theorie zu schaffen, die die Namensgebung für Madagaskar und Gödel unterscheidet. Das Madagaskar-Beispiel veranschaulicht eine Namensverschiebung: Der Name bezog sich ursprünglich auf ein Gebiet in Zentralafrika, wurde aber von Marco Polo auf die Insel südöstlich von Afrika angewendet. Dieses Beispiel steht im Kontrast zum Gödel-Beispiel, welches die Probleme der reinen kausalen Verbindung aufzeigt. Die Arbeit untersucht, wie Evans' Theorie diese unterschiedlichen Fälle erklärt und ob sie dem von ihm formulierten Ziel gerecht wird.
Schlüsselwörter
Kausale Namenstheorie, Gareth Evans, Saul A. Kripke, Beschreibungstheorie, Referenz, Bezeichnung, Kontext, Sprechergemeinschaft, Madagaskar-Beispiel, Gödel-Beispiel, Namensgebung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Analyse der Kausalen Namenstheorie von Gareth Evans
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Gareth Evans' "Causal Theory of Names" im Kontext von Saul A. Kripkes "Name und Notwendigkeit". Der Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung einer spezifischen Zielsetzung Evans', die eine Unterscheidung in der Namensgebung für geographische Orte (Madagaskar-Beispiel) und Personen (Gödel-Beispiel) anstrebt. Die Arbeit untersucht, ob Evans' Theorie diesem Ziel gerecht wird.
Welche Theorien werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert die Kausale Namenstheorie von Gareth Evans mit der Kausalen Namenstheorie von Saul A. Kripke. Sie beleuchtet auch die Beschreibungstheorie der Namen mit ihren zwei Varianten: der Beschreibungstheorie der Bezeichnung durch den Sprecher und die Beschreibungstheorie der Bezeichnung durch den Namen, und zeigt deren Schwächen auf.
Was ist das Madagaskar-Beispiel und seine Bedeutung?
Das Madagaskar-Beispiel veranschaulicht eine Namensverschiebung: Der Name bezog sich ursprünglich auf ein Gebiet in Zentralafrika, wurde aber von Marco Polo auf die Insel südöstlich von Afrika angewendet. Es dient als Gegenbeispiel zum Gödel-Beispiel und soll die Unterschiede in der Namensgebung für geographische Orte und Personen verdeutlichen und die Grenzen der rein kausalen Verbindung aufzeigen.
Was ist das Gödel-Beispiel und seine Relevanz?
Das Gödel-Beispiel, aus Kripkes Theorie, veranschaulicht die Schwächen der Beschreibungstheorie und unterstreicht die Bedeutung des kausalen Zusammenhangs bei der Namensgebung. Es dient im Vergleich zum Madagaskar-Beispiel zur Herausstellung der unterschiedlichen Aspekte der Namensgebung.
Welche Rolle spielt der Kontext und die Sprechergemeinschaft?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Kontextes der Äußerung und der Einigkeit innerhalb einer Sprechergemeinschaft über die Verwendung eines Namens. Evans erweitert Kripkes Ansatz, indem er diese Faktoren in seine kausale Namenstheorie integriert. Die Dominanz des zu bezeichnenden Gegenstandes in der Informationsmenge, die der Sprecher mit dem Namen verbindet, ist hierbei zentral.
Welche Zielsetzung verfolgt Evans, die in der Arbeit geprüft wird?
Evans’ Ziel ist es, eine Theorie zu entwickeln, die die Namensgebung für geographische Orte (wie Madagaskar) von der Namensgebung für Personen (wie Gödel) unterscheidet. Die Hausarbeit analysiert, ob seine Theorie diesem Anspruch gerecht wird.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Kausale Namenstheorie, Gareth Evans, Saul A. Kripke, Beschreibungstheorie, Referenz, Bezeichnung, Kontext, Sprechergemeinschaft, Madagaskar-Beispiel, Gödel-Beispiel, Namensgebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Zielsetzung, die Behandlung der Kausalen Namenstheorie (mit Unterkapiteln zur Zusammenfassung der Theorie, Erläuterung relevanter Zielsetzungen Evans und Analyse der Madagaskar- und Gödel-Beispiele sowie dem Turnip-Beispiel), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Was ist das Turnip-Beispiel?
Das Turnip-Beispiel dient der weiteren Veranschaulichung der Theorie und der Rolle der Informationen, die mit einem Namen verbunden werden, sowie der Frage nach der Quelle dieser Informationen und der Einigkeit in der Sprechergemeinschaft bezüglich der Bezüge.
- Quote paper
- Tobias Tegge (Author), 2010, Analyse der Kausaltheorie der Namen Gareth Evans', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192573