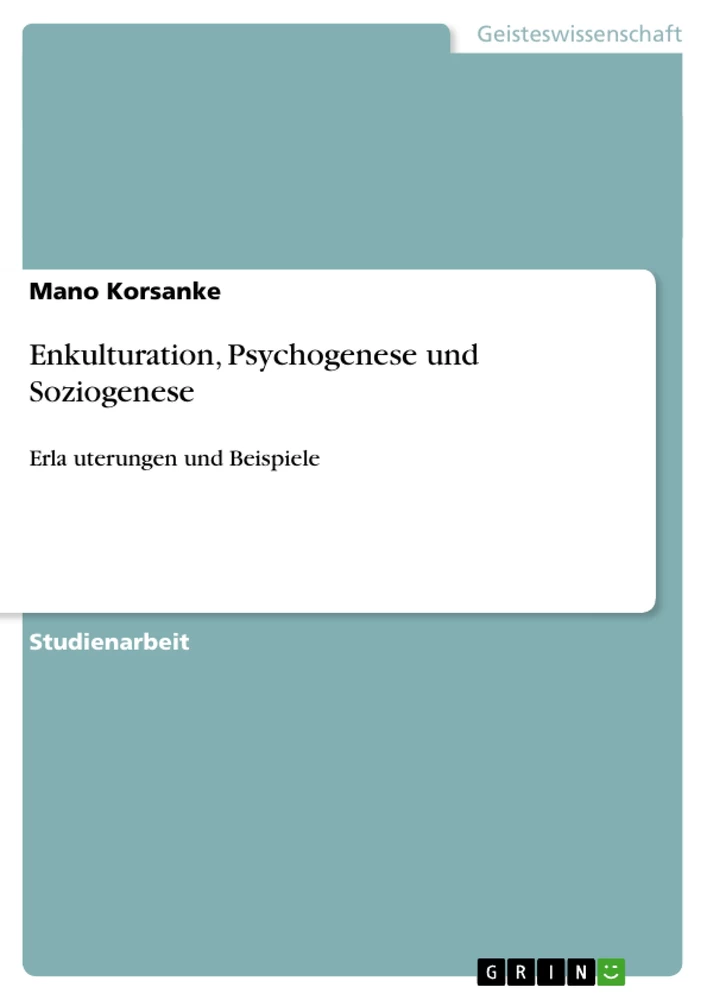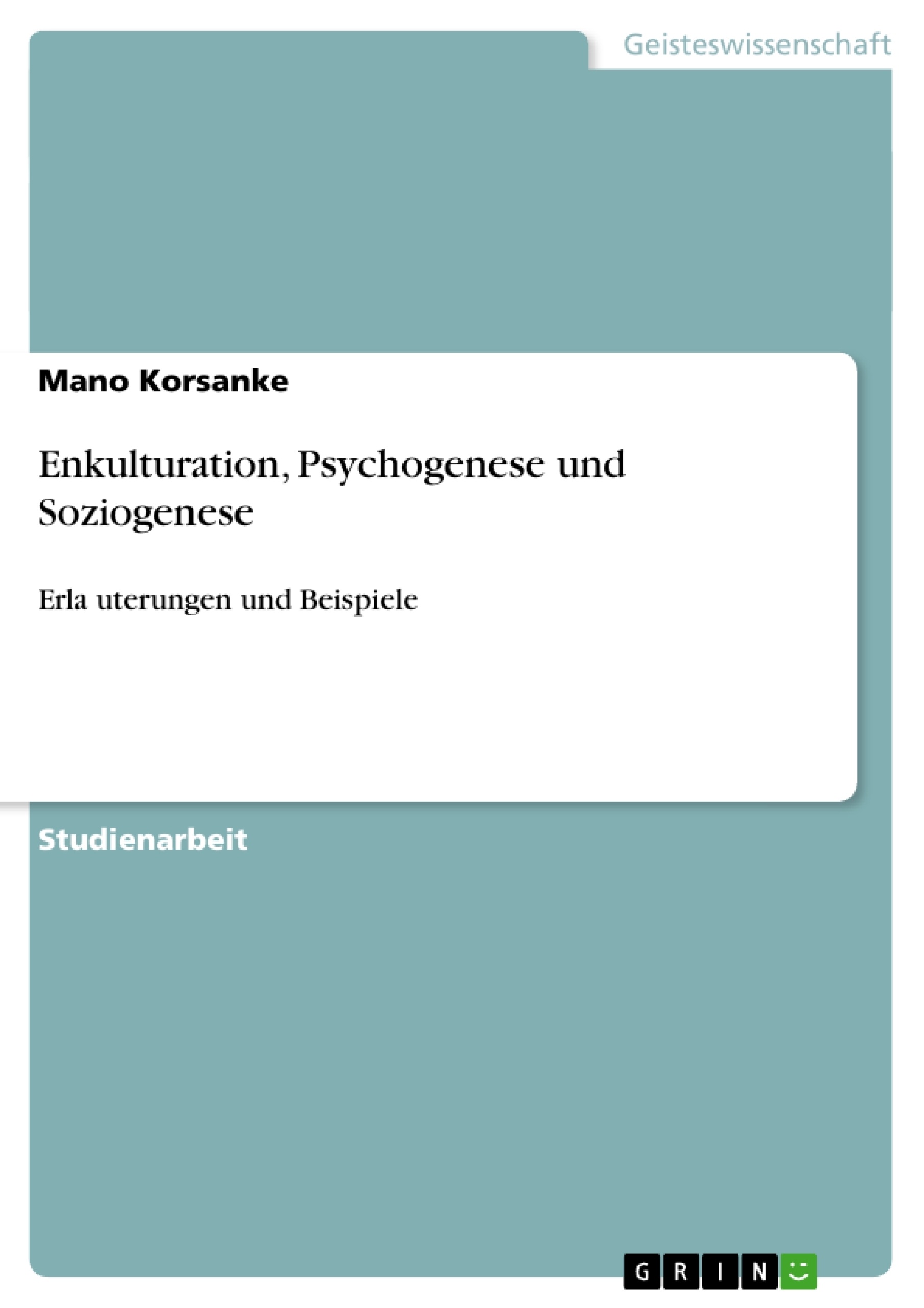In den 1930er Jahren beschäftigte sich der deutsch-jüdische Soziologe Norbert Elias in seinem Londoner Exil „mit den Entwicklungen des Mittelalters, des Humanismus, der höfischen Gesellschaften und der Aufklärung im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts“. Sein Hauptaugenmerk lag dabei vor allem auf den langfristigen und permanenten Transformationen der Persönlichkeits- und Gesellschaftsstrukturen innerhalb der westlichen Gesellschaften. Diese Arbeit wird die Frage klären wie sich das Zusammenspiel von Psychogenese und Soziogenese innerhalb den Zivilisationsprozesses gestaltet und welche Bedeutung der Enkulturation in diesem Kontext beibemessen wird. Elias wollte untersuchen, was der innere ‚Antrieb’ des kulturellen Fortschrittes war und wie die Menschen im Laufe der Jahrhunderte sich selbst und auch ihre Mitmenschen dazu brachten „allmählich zivilisiertere Verhaltenweisen anzunehmen“. Als empirisches Material dienten dabei die in verschiedenen Sprachen verfassten Manieren- und Erziehungsschriften sowie Anstands- und Zeremoniellbücher. Er untersuchte die Verhaltensänderungen der höfischen Eliten vom ausklingenden Mittelalter bis ins 18te Jahrhundert wobei die Zeit des französischen Absolutismus den zentralen Punkt seiner Forschungen bildete. Diese monumentale zweibändige Monographie aus dem Jahr 1939 ist mit „Über den Prozess der Zivilisation“ tituliert und wahrscheinlich Elias’ bedeutendstes Werk. Die darin enthaltene Zivilisationstheorie erhält ihre hohe Aussagekraft bis zum heutigen Tag vor allem durch die interdisziplinäre Leistung, welche die Soziologie mit der Geschichtswissenschaft, der Ethnologie, Anthropologie, Psychologie, Rechts- wissenschaft und Kulturwissenschaft verknüpfte. "Die Strukturen der menschlichen Psyche, die Strukturen der menschlichen Gesellschaft und die Strukturen der menschlichen Geschichte, sie sind Komplementärerscheinungen und nur im Zusammenhang miteinander zu erforschen." Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen soziologischen Theorien und der bloßen Beschreibung von gesellschaftlichen Tendenzen in der Gegenwart ermöglicht sie es, weitaus längerfristige Vorgänge in der Kulturgeschichte zu erfassen, zu verstehen und zu deuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Zivilisationsprozess
- 2.1. Der Begriff der Zivilisation
- 3. Psychogenese
- 3.1. Affektbändigung
- 3.2. Fremdzwänge zu Selbstzwängen
- 3.3. Scham- und Peinlichkeitsgefühle
- 4. Soziogenese
- 4.1. Veränderung der Ordnungsstrukturen durch Affektkontrolle
- 4.2. Entwicklung von Herrschaftsstrukturen und das Gewaltmonopol
- 5. Enkulturation
- 5.1. Enkulturationsbegriff
- 5.2. Figurationen/Interdependenzgeflechte
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Norbert Elias' Zivilisationstheorie, indem sie das Zusammenspiel von Psychogenese und Soziogenese im Zivilisationsprozess analysiert und die Bedeutung der Enkulturation in diesem Kontext beleuchtet. Elias' Ziel war es, den "inneren Antrieb" des kulturellen Fortschritts zu erforschen und die allmähliche Entwicklung zivilisierterer Verhaltensweisen zu verstehen.
- Der Begriff der Zivilisation und seine Abgrenzung von "Kultur"
- Die Interdependenz von Psychogenese (individuelle Persönlichkeitsentwicklung) und Soziogenese (gesellschaftliche Entwicklung)
- Die Rolle der Affektbändigung und die Transformation von Fremdzwängen zu Selbstzwängen
- Die Bedeutung von Scham- und Peinlichkeitsgefühlen im Zivilisationsprozess
- Der Einfluss der Enkulturation auf den Zivilisationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Werk Norbert Elias' "Über den Prozess der Zivilisation" ein und beschreibt dessen Fokus auf die langfristigen Transformationen von Persönlichkeits- und Gesellschaftsstrukturen in westlichen Gesellschaften. Sie skizziert die Forschungsfrage nach dem Zusammenspiel von Psychogenese und Soziogenese im Zivilisationsprozess und der Rolle der Enkulturation. Elias' methodischer Ansatz, basierend auf Manieren- und Erziehungsschriften, wird ebenfalls vorgestellt, ebenso wie die Bedeutung seines interdisziplinären Ansatzes, der Soziologie, Geschichte, Ethnologie, Anthropologie, Psychologie, Rechtswissenschaft und Kulturwissenschaft verbindet.
2. Der Zivilisationsprozess: Dieses Kapitel differenziert zwischen den Begriffen "Kultur" und "Zivilisation", wobei "Zivilisation" als Prozess und nicht als Zustand definiert wird. Es beinhaltet eine Auseinandersetzung mit Elias' soziogenetischen und psychogenetischen Untersuchungen, die den wechselseitigen Einfluss von individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungen im historischen Kontext betont. Das Kapitel führt in Elias' Zivilisationstheorie und seine Staatenbildungstheorie ein, die beide als aufeinander aufbauende Konstruktionen den Prozess der Zivilisation erklären, ohne ihn als geplant oder zufällig zu reduzieren.
3. Psychogenese: Dieses Kapitel befasst sich mit der Mikroebene des Zivilisationsprozesses, der Psychogenese. Es analysiert den langfristigen Wandel menschlicher Persönlichkeitsstrukturen und Verhaltensweisen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen. Ein zentrales Thema ist der zunehmende Bedarf an Selbstkontrolle und Selbstregulierung von Affekten im Zuge wachsender sozialer Verflechtung.
4. Soziogenese: Dieser Abschnitt untersucht die Makroebene des Zivilisationsprozesses, die Soziogenese. Er analysiert, wie die zunehmende Affektkontrolle die gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen verändert und zur Entwicklung von Herrschaftsstrukturen und dem Gewaltmonopol beiträgt. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Machtstrukturen und ihrem Einfluss auf das Verhalten von Individuen und Gruppen.
5. Enkulturation: Das Kapitel widmet sich der Enkulturation, dem Prozess der Übernahme und Internalisierung kultureller Normen und Werte. Es untersucht den Begriff der Enkulturation und analysiert die Rolle von Interdependenzgeflechten und Figurationen in der Formierung von kulturellen Mustern und Verhaltensweisen. Die Bedeutung der Enkulturation für die Stabilität und den Wandel von Gesellschaften wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Zivilisationsprozess, Psychogenese, Soziogenese, Enkulturation, Affektbändigung, Selbstzwänge, Scham, Peinlichkeit, Norbert Elias, Interdependenz, Herrschaftsstrukturen, Gesellschaftliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Norbert Elias' Zivilisationstheorie. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Zusammenspiels von Psychogenese (individuelle Persönlichkeitsentwicklung) und Soziogenese (gesellschaftliche Entwicklung) im Zivilisationsprozess und der Rolle der Enkulturation.
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Aspekte von Elias' Zivilisationstheorie, darunter: den Begriff der Zivilisation und seine Abgrenzung von "Kultur"; die Interdependenz von Psychogenese und Soziogenese; die Rolle der Affektbändigung und die Transformation von Fremdzwängen zu Selbstzwängen; die Bedeutung von Scham- und Peinlichkeitsgefühlen; und den Einfluss der Enkulturation auf den Zivilisationsprozess. Die Arbeit untersucht auch Elias' methodischen Ansatz und seine interdisziplinäre Perspektive.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Zivilisationsprozess, Kapitel zur Psychogenese und Soziogenese, ein Kapitel zur Enkulturation und abschließend eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht zusammengefasst.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Elias' Zivilisationstheorie zu untersuchen und das Zusammenspiel von Psychogenese und Soziogenese im Zivilisationsprozess zu analysieren. Sie beleuchtet die Bedeutung der Enkulturation in diesem Kontext und erklärt Elias' Ziel, den "inneren Antrieb" des kulturellen Fortschritts zu erforschen.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe umfassen: Zivilisationsprozess, Psychogenese, Soziogenese, Enkulturation, Affektbändigung, Selbstzwänge, Scham, Peinlichkeit, Norbert Elias, Interdependenz, Herrschaftsstrukturen, Gesellschaftliche Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung.
Was ist der Unterschied zwischen "Kultur" und "Zivilisation" laut Elias?
Die Arbeit differenziert zwischen den Begriffen "Kultur" und "Zivilisation". "Zivilisation" wird als Prozess und nicht als Zustand definiert, im Gegensatz zu einem statischen Kulturbegriff. Die genaue Unterscheidung wird im Kapitel "Der Zivilisationsprozess" erläutert.
Wie wird der Zivilisationsprozess in dieser Arbeit erklärt?
Der Zivilisationsprozess wird als ein komplexes Zusammenspiel von psychischen und gesellschaftlichen Entwicklungen dargestellt. Die Arbeit untersucht, wie sich die zunehmende Affektkontrolle auf die individuellen Persönlichkeitsstrukturen und die gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen auswirkt.
Welche Rolle spielt die Enkulturation im Zivilisationsprozess?
Die Enkulturation, der Prozess der Übernahme und Internalisierung kultureller Normen und Werte, spielt eine zentrale Rolle im Zivilisationsprozess. Die Arbeit untersucht, wie Interdependenzgeflechte und Figurationen die Formierung kultureller Muster und Verhaltensweisen beeinflussen und zur Stabilität und zum Wandel von Gesellschaften beitragen.
- Quote paper
- Mano Korsanke (Author), 2011, Enkulturation, Psychogenese und Soziogenese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192466