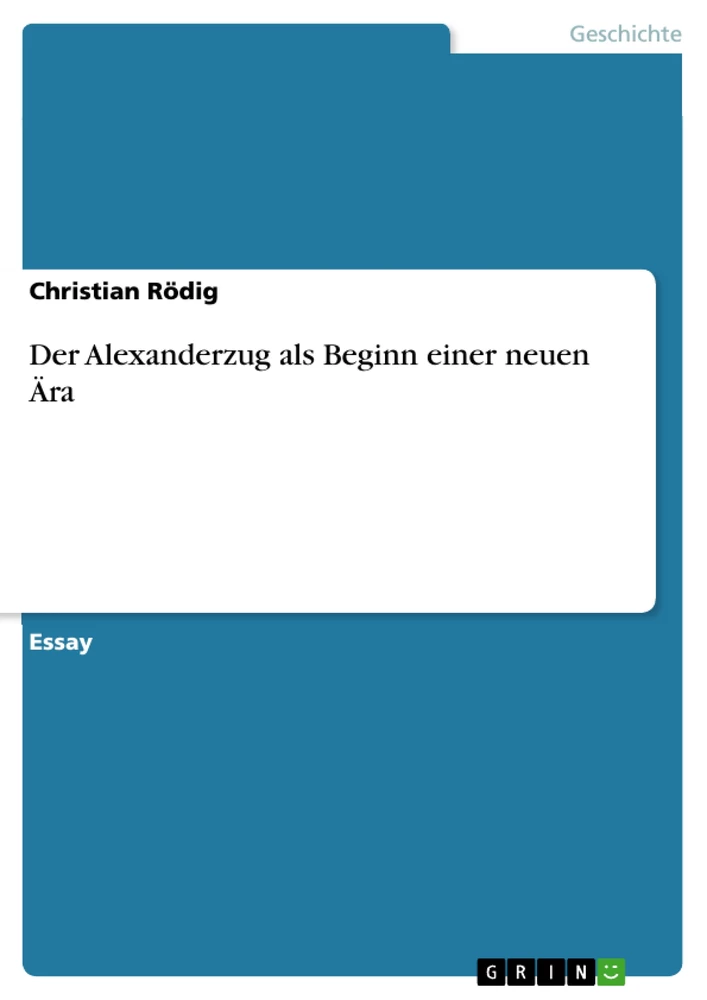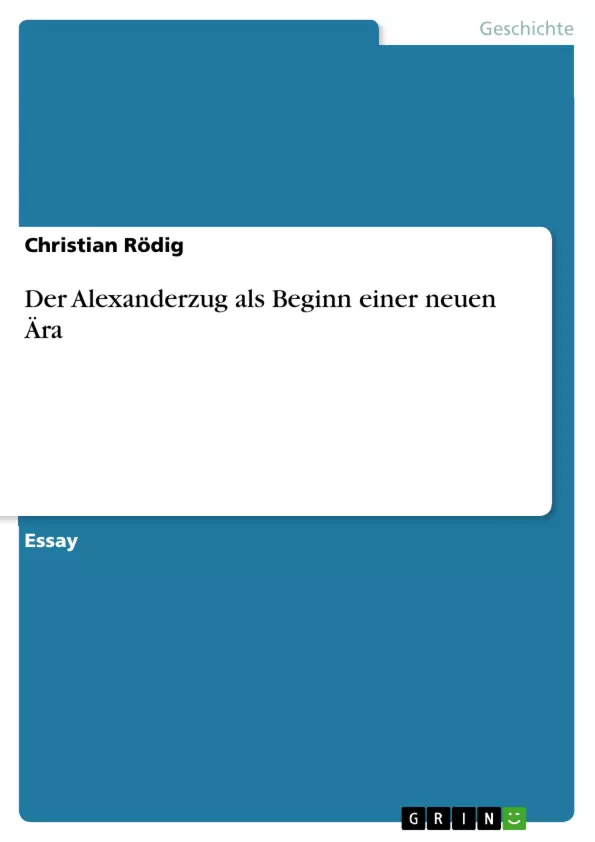Knapp 150 Jahre waren vergangen, seit sich die griechischen Poleis gegen die Perser erfolgreich verteidigt hatten.
Die Perser hatten eines der bis dahin mächtigsten Reiche der Welt errichtet und verloren auch nach den empfindlichen Niederlagen von Marathon und Salamis nicht ihre Vormachtstellung.
Doch nun, nach eineinhalb Jahrhunderten, schaffte es ein makedonischer König dieses Weltreich in einem gigantischen Feldzug zu erobern. Er wurde fortan Alexander der Große genannt.
Nach Schlachten, welche an Bedeutung denen der Perserkiege in nichts nachstehen, , gelang es ihm ein Reich zu errichten, dessen Größe jenes der Perser sogar noch übertraf.
Sein Feldzug, den er 336 v. Chr. begann und welcher ihn bis an das Ende der damals bekannten Welt führen sollte, wurde zu einem Wendepunkt der Geschichte und läutete eine neue Ära ein.
Doch darf dieser Alexanderzug nicht nur unter militärischen Aspekten gesehen werden, weil dies dazu führen würde die kulturellen Veränderungen außer Acht zu lassen.
In diesem Essay geht es primär darum, Alexanders Motivation für seine Kulturpolitik, welche erst durch den Erfolg des Alexanderzuges möglich wurde, zu erforschen.
Im Zentrum der Betrachtung steht dabei zum einen Alexanders Motivationen für seine Städtegründungen, zum anderen seine Politik gegenüber anderen Völkern und Kulturen seines Reiches. Dafür werden die Ansichten ausgewählter Historiker diskutiert, um letztlich die Beweggründe für Alexanders Handeln zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Städtegründungen Alexanders
- Verbrüderung der Welt oder Notwendiges Übel?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Motivationen hinter Alexanders Kulturpolitik, die erst durch den Erfolg seines Feldzugs möglich wurde. Die Analyse konzentriert sich auf zwei zentrale Aspekte: Alexanders Beweggründe für die Gründung von Städten sowie seine Politik gegenüber anderen Völkern und Kulturen innerhalb seines Reiches.
- Alexanders Motivationen für seine Städtegründungen
- Die Auswirkungen von Alexanders Kulturpolitik auf andere Kulturen
- Die Verbindung von makedonischen und iranischen Elementen im Alexanderreich
- Die Rolle der Toleranz und des Zusammenlebens verschiedener Kulturen
- Die politische Bedeutung von Alexanders Handeln im Kontext seines Weltreiches
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt den Alexanderzug als Wendepunkt der Geschichte dar, der eine neue Ära einleitete. Der Fokus liegt auf Alexanders Motivationen für seine Kulturpolitik, die durch den Erfolg des Feldzugs ermöglicht wurde. Die Analyse konzentriert sich auf Alexanders Städtegründungen und seine Politik gegenüber anderen Kulturen.
Die Städtegründungen Alexanders
Der Text beleuchtet die Kontroversen um die genaue Anzahl der Städtegründungen Alexanders und die unterschiedlichen Meinungen von Historikern hinsichtlich seiner Motive. Droysen sah in Alexanders Beweggründen eine Kombination aus Eroberung, Förderung des Welthandels und Hellenisierung. Tscherikower hingegen argumentierte, dass Alexander seine Städte hauptsächlich aus militärischen Gründen gründete. Jones hingegen sah Alexanders Motivationen in demographischen und idealistischen Gründen, wobei er die Überbevölkerung Griechenlands und Alexanders Wunsch, die griechische Kultur zu exportieren, betonte.
Verbrüderung der Welt oder Notwendiges Übel?
Der Text diskutiert die unterschiedlichen Ansätze in der Forschung bezüglich Alexanders Kulturpolitik. Während ältere Forscher Alexander oft als Vermittler einer Einheit zwischen den Völkern betrachteten, argumentiert der Text, dass seine Toleranz gegenüber anderen Kulturen vor allem aus politischen Gründen erfolgte. Die Unterdrückung dieser Kulturen hätte seine Feldzüge gefährdet.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Alexanderzug, Städtegründungen, Hellenisierung, Kulturpolitik, Toleranz, Weltreich, Motivation, historische Forschung, Historiker, Plutarch, Droysen, Tscherikower, Jones, Weltverbrüderung.
Häufig gestellte Fragen zum Alexanderzug
Warum gilt der Alexanderzug als Wendepunkt der Geschichte?
Alexanders Feldzug beendete die persische Vormachtstellung und läutete durch die Verschmelzung griechischer und orientalischer Kulturen das Zeitalter des Hellenismus ein.
Welche Motive hatte Alexander für seine Städtegründungen?
Historiker diskutieren verschiedene Motive: militärische Sicherung, Förderung des Welthandels, Hellenisierung und die Lösung demographischer Probleme in Griechenland.
Verfolgte Alexander eine bewusste Politik der Völkerverbrüderung?
Während ältere Forschung dies oft annahm, sieht die moderne Sicht seine Toleranz eher als politisches Kalkül, um die Stabilität in seinem riesigen Weltreich zu sichern.
Was bedeutet Hellenisierung?
Es bezeichnet die Ausbreitung der griechischen Kultur, Sprache und Lebensweise im gesamten Orient infolge der Eroberungen Alexanders.
Wie beurteilte der Historiker Droysen Alexander den Großen?
Droysen sah in Alexander einen visionären Herrscher, dessen Städtegründungen und Kulturpolitik den Grundstein für eine neue, globale Zivilisation legten.
- Citation du texte
- B.A. Christian Rödig (Auteur), 2009, Der Alexanderzug als Beginn einer neuen Ära, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192391