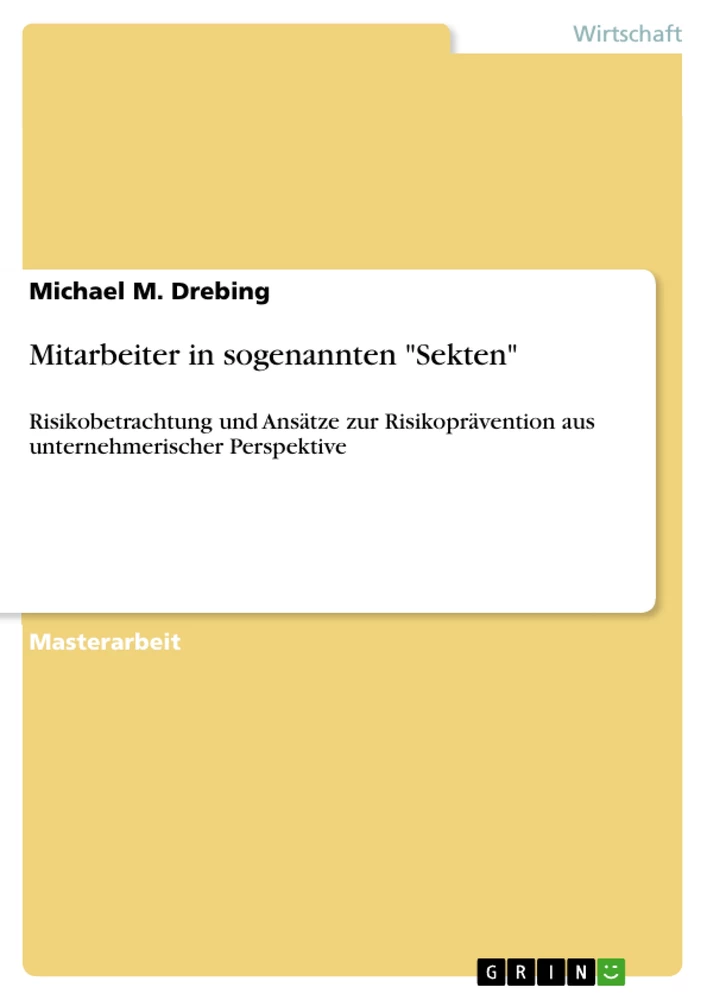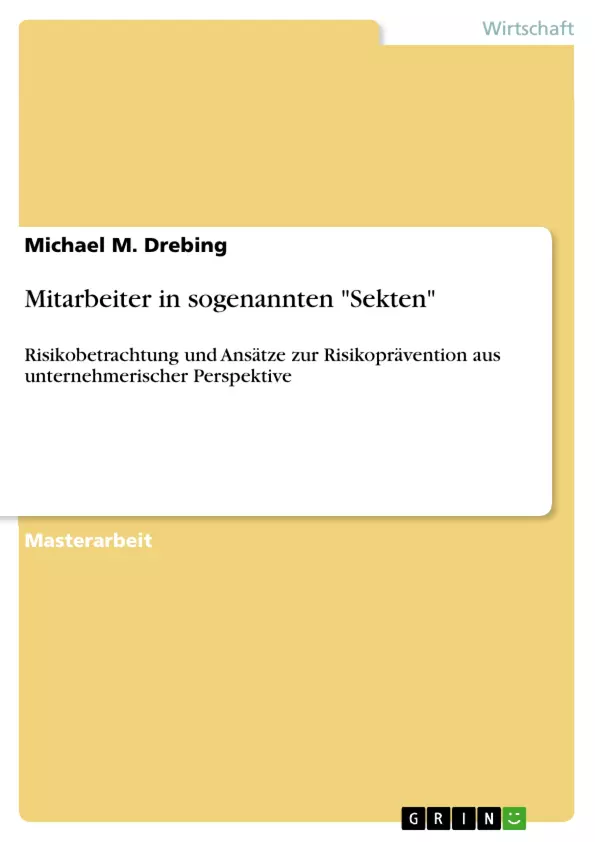Religion galt in Westeuropa lange Zeit als eine rein persönliche Angelegenheit. Ob und wie man an einen Gott glaubte, gehörte in die private Welt und ging weder Nachbarn, noch Behörden noch den Arbeitgeber etwas an. Das gab dem religiösen Fundamentalismus – in allen Weltreligionen – die Gelegenheit, sich nahezu unbemerkt auszubreiten. Die gesellschaftlichen Nachbeben des 11. Septembers 2001 führten zu einem langsamen Umdenken: Über die Rolle, die Religion in der Gesellschaft spielen darf oder spielen soll, wird seitdem wieder intensiver diskutiert.
Die vorliegende Master-Thesis reiht sich mit einem betriebswirtschaftlichen Fokus in diesen Diskurs über die „Deprivatisierung der Religion“ ein.
Die Arbeit stellt dar, inwieweit ein Unternehmen durch seine Mitarbeiter3 besonderen ideologisch bedingten qualitativen personellen Risiken ausgesetzt sein kann und leitet Präventionsansätze für das Personalmanagement ab. Sie widmet sich insbesondere Mitarbeitern aus den ideologisch konfliktträchtigen Gruppierungen4 Scientology und Jehovas Zeugen.
Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Angehörige einer Religionsgemeinschaft pauschal zu kriminalisieren oder unter einen Generalverdacht zu stellen. Zu vielfältig ist das Zusammenspiel möglicher Einflussfaktoren, das letztendlich zu einer Handlung des Individuums führt. Vielmehr ist es gerade der Einzelne selbst, der bei Loyalitätskonflikten zwischen der Lehre seiner Religionsgemeinschaft und den Erwartungen seines Arbeitgebers jedes Mal und immer wieder neu abwägt, wie er sich verhalten wird.
Zunächst wird diese Arbeit ideologisch bedingte qualitative personelle Risiken definieren und in den betriebswirtschaftlichen Kontext einordnen. Das dritte Kapitel gibt anschließend einen allgemeinen Überblick über sogenannte Sekten und Psychogruppen, bevor es detailliert auf Geschichte, Organisation und Lehre von Scientology und Jehovas Zeugen in der für das Verständnis der Arbeit gebotenen Tiefe eingeht.
Nach der daraus folgenden Darlegung spezieller personeller Risiken in Kapitel vier erarbeitet das fünfte Kapitel Präventionsansätze aus juristischer, personalstrategischer und soziologischer Perspektive. Das Fazit führt die einzelnen Perspektiven zu einem ganzheitlichen Präventionsansatz zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielstellung und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Vorüberlegungen
- 2 Ideologisch bedingte qualitative personelle Risiken
- 2.1 Wesen von Ideologien
- 2.2 Einordnung in den unternehmerischen Kontext
- 3 Ideologisch konfliktträchtige Gruppen
- 3.1 Überblick
- 3.2 Scientology
- 3.2.1 Geschichtlicher Abriss
- 3.2.2 Organisationsstruktur
- 3.2.3 Lehre
- 3.3 Jehovas Zeugen
- 3.3.1 Geschichtlicher Abriss
- 3.3.2 Organisationsstruktur
- 3.3.3 Lehre
- 4 Spezielle Risiken aus der Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu ideologisch konfliktträchtigen Gruppen
- 4.1 Austritts- und Anpassungsrisiko
- 4.1.1 Scientology
- 4.1.2 Zeugen Jehovas
- 4.1.3 Mittelbares Austrittsrisiko
- 4.2 Motivationsrisiko
- 4.3 Deliktrisiko
- 4.3.1 Scientology
- 4.3.2 Jehovas Zeugen
- 4.4 Integrationsrisiko
- 4.4.1 Scientology
- 4.4.2 Jehovas Zeugen
- 4.5 Unterwanderungsrisiko
- 5 Ansätze zur Prävention
- 5.1 Die juristische Sichtweise
- 5.1.1 Das Grundgesetz
- 5.1.2 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
- 5.1.3 Kritische Würdigung der rechtlichen Situation
- 5.2 Die personalstrategische Sichtweise
- 5.2.1 Erfolgsfaktor Diversity
- 5.2.2 Ziele des Diversity Managements
- 5.2.3 Grenzen von Diversity
- 5.3 Die soziologische Sichtweise
- 5.3.1 Erfolgsfaktor Integration
- 5.3.2 Funktionale Koordination unterstützen
- 5.3.3 Moralische Integrität steuern
- 5.3.4 Expressive Gemeinschaft fördern
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Risiken, die sich aus der Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu ideologisch konfliktträchtigen Gruppen für Unternehmen ergeben. Sie analysiert die Besonderheiten dieser Gruppen und untersucht die Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis.
- Wesen von Ideologien und ihre Einordnung in den unternehmerischen Kontext
- Risiken durch Austritt, Motivation, Delikte, Integration und Unterwanderung
- Juristische, personalstrategische und soziologische Präventionsansätze
- Zusammenhang zwischen Ideologie, Risikomanagement und Diversity Management
- Entwicklung eines ganzheitlichen Modells zur Risikoprävention
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ideologisch bedingten personellen Risiken ein und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar. Sie diskutiert die Bedeutung des Themas im Kontext der heutigen Arbeitswelt und skizziert die relevanten Aspekte der Untersuchung.
- Kapitel 2: Ideologisch bedingte qualitative personelle Risiken: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Wesen von Ideologien und ihrer Einordnung in den unternehmerischen Kontext. Es analysiert die spezifischen Risiken, die aus der Zugehörigkeit zu ideologisch geprägten Gruppen resultieren können.
- Kapitel 3: Ideologisch konfliktträchtige Gruppen: In diesem Kapitel werden zwei konkrete Gruppen – Scientology und Jehovas Zeugen – vorgestellt und ihre Organisationsstruktur sowie Lehre näher beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Analyse der jeweiligen Ideologien und deren potenziellen Auswirkungen auf Unternehmen.
- Kapitel 4: Spezielle Risiken aus der Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu ideologisch konfliktträchtigen Gruppen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene konkrete Risiken, die im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu ideologisch konfliktträchtigen Gruppen auftreten können. Hierzu zählen Austritts- und Anpassungsrisiken, Motivationsrisiken, Deliktrisiken, Integrationsrisiken und Unterwanderungsrisiken.
- Kapitel 5: Ansätze zur Prävention: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Prävention ideologisch bedingter personeller Risiken. Es werden die juristische, personalstrategische und soziologische Sichtweise vorgestellt und deren Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Ideologie, Risikomanagement, Personalrisiken, Diversity Management, Scientology, Jehovas Zeugen, Austrittsrisiko, Motivationsrisiko, Deliktrisiko, Integrationsrisiko, Unterwanderungsrisiko, Präventionsansätze, juristische Sichtweise, personalstrategische Sichtweise, soziologische Sichtweise, Unternehmenskultur, Integration, Moralische Integrität.
- Citar trabajo
- Michael M. Drebing (Autor), 2012, Mitarbeiter in sogenannten "Sekten", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192273