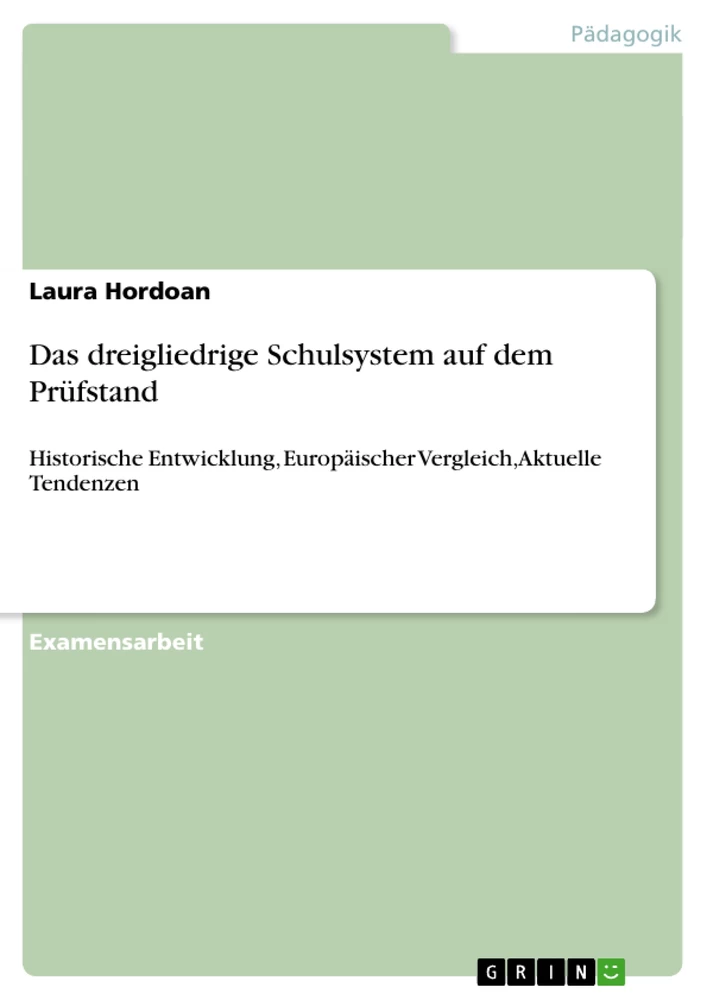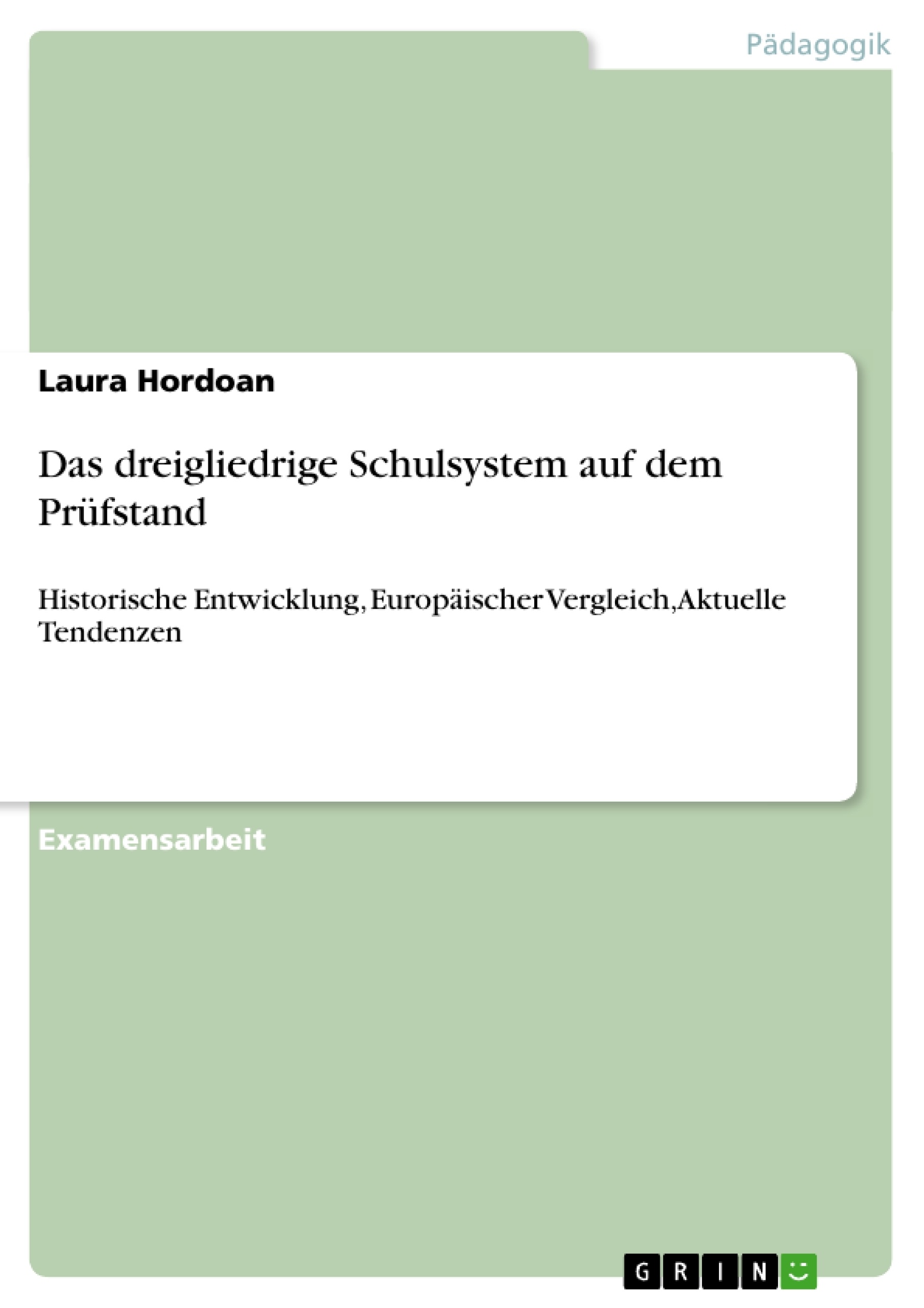Nach den Untersuchungen der PISA-Studie ist das deutsche Schulsystem stark in die Kritik geraten und wird immer wieder in den Medien diskutiert. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben die deutschen Schüler bei internationalen Leistungsvergleichen erstaunlich schlecht abgeschnitten. Die Gründe dafür werden vor allem im Bildungssystemen gesucht: fehlende Vorschulbildung, späte Einschulung, frühe Selektion und Undurchlässigkeit des Systems sowie fehlende Anschlussmöglichkeiten. Das deutsche Bildungssystem befindet sich in einer Krise, die Dreiteilung der Sekundarstufe erfüllt nicht mehr ihren Zweck, die deutschen Schüler scheinen zu spät und nicht genug zu lernen und sind Gleichaltrigen anderer Länder unterlegen.
Die Arbeit beruht auf der These, dass die Dreigliederung der Sekundarstufe I kein zukunftsträchtiges Modell mehr darstellt, weil es durch die frühe Selektion Bildungskarrieren blockiert. Der Vergleich mit anderen Schulmodellen soll darstellen, dass eine Reformierung des Schulsystems hin zu mehr Einheitlichkeit sich positiv auf das Bildungssystem auswirken könnte.
Zunächst wird die historische Entwicklung des deutschen Bildungswesens geschildert und aufgezeigt, wie die Unterscheidung zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium entstanden ist. Anschließend wird das deutsche Bildungswesen in Theorie und Praxis dargestellt. Das gegenwärtige deutsche Schulwesen gefährdet Bildungschancen, weil die Mehrheit der Schüler nicht optimal gefördert wird.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Schulsysteme anderer europäischer Staaten analysiert: das niederländische Schulwesen mit einer der deutschen ähnlichen Teilung der Sekundarstufe I, das französische System, das alle Schüler auf das gemeinsame collège bündelt, Polen, das nach dem kommunistischen Regime eine erfolgreiche Bildungsreform unter Beibehaltung der Einheitsschule durchgeführt hat, und zuletzt Schweden, das mit seinen überdurchschnittlichen Ergebnissen bei den letzten internationalen Bildungsvergleichen das Vorzeigemodell für ein erfolgreiches einheitliches Gesamtschulsystem ist.
Im letzten Teil werden bildungspolitische Reformen der letzten Jahre benannt und aktuelle Tendenzen im Bildungsbereich skizziert. Schließlich werden Wege aus der Krise aufgezeigt und die Option einer Schulform ‚für alle’ diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Entwicklung des Schulsystems
- 2.1 Anfänge des Schulwesens
- 2.2 Institutionalisierung und Ausbau des Schulwesens
- 2.3 Verstaatlichung und Vereinheitlichung - das Weimarer System
- 2.4 Nationalsozialistische Schulpolitik
- 2.5 Wiederaufbau und Bildungsexpansion
- 2.6 Das Schulsystem der DDR
- 2.7 Deutschlands Wiedervereinigung
- 3. Das deutsche Schulwesen im 21. Jahrhundert
- 3.1 Grundstruktur des Schulwesens
- 3.2 Grundschulempfehlung und Übergang
- 3.3 Die Sekundarstufe I und Durchlässigkeit des Systems
- 3.4 Probleme im Schulwesen
- 3.4.1 Stellenwert der Bildung
- 3.4.2 Die Leistung deutscher Schulbildung
- 3.4.3 Ungleichheit der Bildungschancen
- 3.4.4 Sozial- und milieubedingte Schulprobleme
- 3.4.5 Problemlösungsansätze und ihre Grenzen
- 4. Europäischer Vergleich
- 4.1 Niederlande
- 4.2 Frankreich
- 4.3 Polen
- 4.4 Schweden
- 5. Aktuelle Tendenzen
- 5.1 Strukturelle und inhaltliche Reformen
- 5.1.1 Achtjähriges Gymnasium und Ganztagsunterricht
- 5.1.2 Bildungsstandards und Kompetenzen
- 5.2 Diskussion
- 5.2.1 Was wird aus der Hauptschule?
- 5.2.2 Die Gesamtschule: Braucht Deutschland eine Einheitsschule?
- 5.3 Ausblick: Die Zukunft des deutschen Schulwesens
- 5.1 Strukturelle und inhaltliche Reformen
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch das dreigliedrige deutsche Schulsystem. Ziel ist es, die historische Entwicklung aufzuzeigen und aktuelle Probleme im Kontext des europäischen Vergleichs zu analysieren. Die Arbeit argumentiert, dass die frühe Selektion im deutschen System zu Ungleichheit der Bildungschancen führt.
- Historische Entwicklung des deutschen Schulsystems
- Analyse der aktuellen Probleme des deutschen Schulsystems
- Europäischer Vergleich verschiedener Schulmodelle
- Diskussion aktueller bildungspolitischer Reformen
- Bewertung der Zukunftsfähigkeit des dreigliedrigen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
2. Historische Entwicklung des Schulsystems: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des deutschen Schulsystems von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Es zeigt den Wandel des Bildungsbegriffs auf, von der religiös geprägten Erziehung des 18. Jahrhunderts über die Säkularisierung und die Entwicklung eines institutionalisierten Fächerkanons bis hin zur heutigen Diskussion um Bildung als Ressource und Humankapital. Besonders hervorgehoben wird die Entstehung der Dreigliedrigkeit und ihre soziale Funktion, die bis heute andauert. Die Kapitel verdeutlicht, wie politische und gesellschaftliche Veränderungen den Bildungssektor beeinflusst haben und wie sich das Schulsystem an diese angepasst – oder nicht angepasst – hat. Der abgrenzende Charakter von Bildung durch Institutionen und Fächerkanone, der soziale Positionen festigt und Außengrenzen manifestiert, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls beleuchtet.
3. Das deutsche Schulwesen im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Struktur des deutschen Schulsystems im 21. Jahrhundert. Es untersucht die Grundschulempfehlung und den Übergang in die Sekundarstufe I, wobei die mangelnde Durchlässigkeit des Systems und die damit verbundenen Probleme hervorgehoben werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Ungleichheiten der Bildungschancen, die durch soziale und familiäre Hintergründe verstärkt werden. Das Kapitel beleuchtet den Stellenwert der Bildung in der Gesellschaft und die Leistung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich. Es werden Problemlösungsansätze und ihre Grenzen diskutiert.
Schlüsselwörter
Dreigliedriges Schulsystem, historische Entwicklung, europäischer Vergleich, Bildungsungleichheit, Grundschulempfehlung, Durchlässigkeit, Bildungsreform, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, PISA-Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: "Deutsches Schulwesen - Eine Analyse"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Schulsystem. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse des dreigliedrigen Schulsystems, seiner historischen Entwicklung, aktuellen Problemen und einem europäischen Vergleich.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einleitung, 2. Historische Entwicklung des Schulsystems, 3. Das deutsche Schulwesen im 21. Jahrhundert, 4. Europäischer Vergleich, 5. Aktuelle Tendenzen und 6. Resümee. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung vom Beginn des Schulwesens bis zur Wiedervereinigung. Kapitel 3 analysiert die aktuelle Struktur, Probleme wie Ungleichheit der Bildungschancen und Lösungsansätze. Kapitel 4 vergleicht das deutsche System mit Niederlanden, Frankreich, Polen und Schweden. Kapitel 5 behandelt aktuelle Reformen wie Ganztagsunterricht und die Diskussion um Einheitsschule. Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch das dreigliedrige deutsche Schulsystem. Ziel ist es, die historische Entwicklung aufzuzeigen und aktuelle Probleme im Kontext des europäischen Vergleichs zu analysieren. Ein zentrales Argument ist, dass die frühe Selektion zu Ungleichheit der Bildungschancen führt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des deutschen Schulsystems, die Analyse aktueller Probleme, einen europäischen Vergleich verschiedener Schulmodelle, die Diskussion aktueller bildungspolitischer Reformen und die Bewertung der Zukunftsfähigkeit des dreigliedrigen Systems.
Welche Probleme des deutschen Schulsystems werden analysiert?
Das Dokument analysiert Probleme wie die mangelnde Durchlässigkeit des Systems, die Ungleichheit der Bildungschancen aufgrund sozialer und familiärer Hintergründe, den Stellenwert der Bildung in der Gesellschaft und die Leistung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich. Die Diskussion um die Hauptschule und die Einführung einer Einheitsschule (Gesamtschule) wird ebenfalls behandelt.
Wie wird der europäische Vergleich durchgeführt?
Der europäische Vergleich umfasst die Schulsysteme der Niederlande, Frankreichs, Polens und Schwedens. Der Vergleich dient dazu, die Stärken und Schwächen des deutschen Systems im internationalen Kontext zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Dreigliedriges Schulsystem, historische Entwicklung, europäischer Vergleich, Bildungsungleichheit, Grundschulempfehlung, Durchlässigkeit, Bildungsreform, Gesamtschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, PISA-Studie.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Es werden Zusammenfassungen für die Kapitel "Historische Entwicklung des Schulsystems" und "Das deutsche Schulwesen im 21. Jahrhundert" bereitgestellt. Die Zusammenfassung zu Kapitel 2 betont den Wandel des Bildungsbegriffs und die Entstehung der Dreigliedrigkeit. Die Zusammenfassung zu Kapitel 3 fokussiert auf die Struktur des Systems im 21. Jahrhundert, die Grundschulempfehlung, die Durchlässigkeit und die Ungleichheit der Bildungschancen.
- Citar trabajo
- Laura Hordoan (Autor), 2007, Das dreigliedrige Schulsystem auf dem Prüfstand, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191917