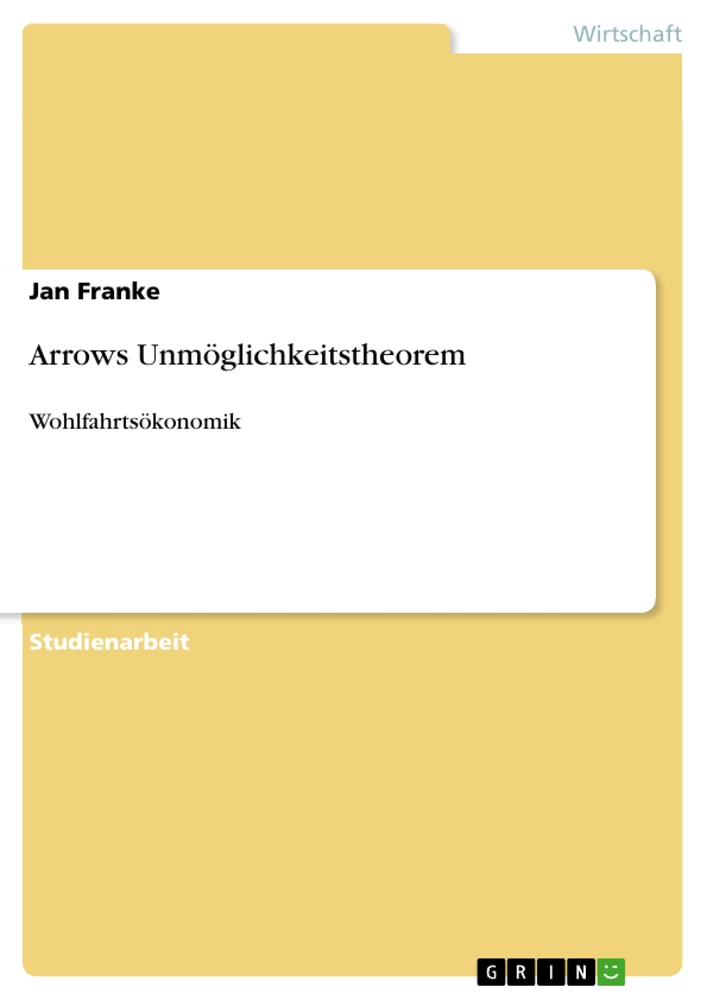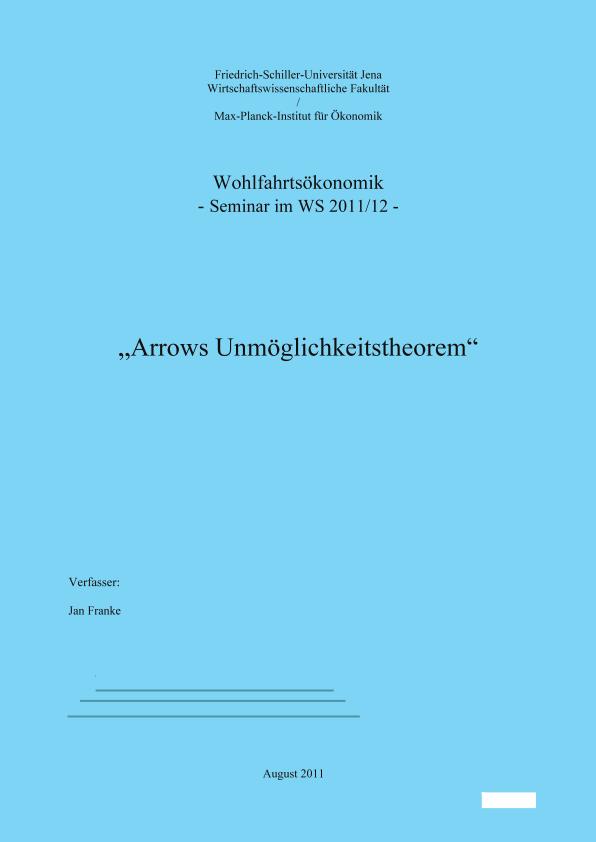Als Kenneth Arrow (US-Amerikanischer Ökonom, *1921) 1951 seine Doktorarbeit unter dem Titel "Social Choice and Individual Values" veröffentlichte, begründete er damit die moderne Social Choice-Theorie, die analytisch und logisch untersucht, wie in Gruppen (z.B. demokratischen Gesellschaften) gemeinsame rationale Entscheidungen getroffen werden können. In Anbetracht des Alters der Demokratie als Staatsform handelt es sich dabei um ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet. Dass man in diesem Feld keine aufsehenerregenden Ergebnisse hervorbringen kann, kann als Grund dafür zumindest ausgeschlossen werden: Zentraler Bestandteil von Arrows Arbeit ist die, als Unmöglichkeitstheorem bekannt gewordene Aussage, dass es kein kollektives Wahlverfahren gibt, welches ein paar trivial scheinende demokratische Prinzipien erfüllt. Dabei untersucht er jedoch nur einen Teilbereich der kollektiven Entscheidungsfindung. Welcher das ist , soll im Folgenden näher eingegrenzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Systematisierung kollektiver Entscheidungen nach Alternativenmengen
- 3. Die KWF und Arrows Bedingungen an sie
- 3.1. Unbeschränkter Definitionsbereich der KWF
- 3.2. Transitivität
- 3.3. Ausschluss von Diktatur
- 3.4. Pareto-Prinzip
- 3.5. Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (IIA)
- 4. Wege aus der Unmöglichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Kenneth Arrows Unmöglichkeitstheorem, einem zentralen Bestandteil der Social Choice-Theorie. Ziel ist es, das Theorem verständlich darzustellen und seine Implikationen für die kollektive Entscheidungsfindung zu erläutern. Der Fokus liegt auf der Analyse der Bedingungen, die Arrow an seine kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF) stellt, und der Erklärung, warum deren gleichzeitige Erfüllung unmöglich ist.
- Kollektive Entscheidungsfindung und die Herausforderungen der Aggregation individueller Präferenzen
- Arrows Unmöglichkeitstheorem und seine zentralen Bedingungen
- Die unterschiedlichen Arten von Alternativenmengen (qualitativ, quantitativ, offen, geschlossen)
- Die Rolle der KWF in der Aggregation individueller Präferenzen
- Mögliche Lösungsansätze für das Unmöglichkeitstheorem (wird in Kapitel 4 angesprochen)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel stellt Kenneth Arrows Unmöglichkeitstheorem vor und skizziert den Gegenstand der Arbeit. Es wird erläutert, dass Arrows Arbeit die Grundlage der modernen Social Choice-Theorie bildet und sich mit der Frage beschäftigt, wie in Gruppen rationale Entscheidungen getroffen werden können. Das Kapitel hebt die zentrale Aussage des Unmöglichkeitstheorems hervor: Es gibt kein kollektives Wahlverfahren, das einige grundlegende demokratische Prinzipien gleichzeitig erfüllt. Es deutet an, dass Arrow nur einen Teilbereich der kollektiven Entscheidungsfindung betrachtet und grenzt den Untersuchungsgegenstand der Arbeit ein.
2. Systematisierung kollektiver Entscheidungen nach Alternativenmengen: Dieses Kapitel systematisiert kollektive Entscheidungsmöglichkeiten, indem es verschiedene Arten von Alternativenmengen unterscheidet: qualitative und quantitative, diskrete und stetige, offene und geschlossene Mengen. Es werden Beispiele für verschiedene Arten von Entscheidungsproblemen angeführt und die unterschiedlichen Verfahren zur Entscheidungsfindung – Marktmechanismus und Wahl – diskutiert. Das Kapitel hebt die Unterschiede in der Anwendung von Wahlen und Marktmechanismen in Abhängigkeit von der Art der Alternativenmenge hervor und betont, dass Arrows Untersuchung sich auf Entscheidungsprobleme mit geschlossenen Alternativenmengen konzentriert. Die verschiedenen Arten von Alternativenmengen und die damit verbundenen Entscheidungsprozesse werden prägnant und differenziert dargestellt.
3. Die KWF und Arrows Bedingungen an sie: Dieses Kapitel beschreibt die kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF) und die von Arrow an diese gestellten Bedingungen. Es wird erklärt, wie individuelle Präferenzordnungen aggregiert werden, um eine kollektive Ordnung zu erzeugen. Das Kapitel präsentiert und diskutiert die einzelnen Bedingungen (unbeschränkter Definitionsbereich, Transitivität, Ausschluss von Diktatur, Pareto-Prinzip, Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen), die Arrow an seine KWF stellt. Es wird deutlich gemacht, dass der Beweis des Unmöglichkeitstheorems selbst nicht im Detail dargestellt wird, da dies eine bloße Wiederholung bekannter Lehrbuchinhalte wäre.
Schlüsselwörter
Arrows Unmöglichkeitstheorem, kollektive Entscheidungsfindung, kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF), Social Choice Theorie, Präferenzordnungen, Alternativenmengen, demokratische Prinzipien, Pareto-Prinzip, Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (IIA).
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Arrows Unmöglichkeitstheorem
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Kenneth Arrows Unmöglichkeitstheorem. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der verständlichen Darstellung des Theorems und seinen Implikationen für die kollektive Entscheidungsfindung. Das Dokument analysiert die von Arrow an seine kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF) gestellten Bedingungen und erklärt, warum deren gleichzeitige Erfüllung unmöglich ist.
Was ist Arrows Unmöglichkeitstheorem?
Arrows Unmöglichkeitstheorem ist ein zentrales Ergebnis der Social Choice Theorie. Es besagt, dass es kein kollektives Wahlverfahren gibt, das gleichzeitig einige grundlegende demokratische Prinzipien erfüllt. Das Theorem beschäftigt sich mit der Frage, wie in Gruppen rationale Entscheidungen getroffen werden können und wie individuelle Präferenzen zu einer kollektiven Ordnung aggregiert werden können.
Welche Bedingungen stellt Arrow an seine kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF)?
Arrow stellt fünf Bedingungen an seine KWF: 1. Unbeschränkter Definitionsbereich der KWF; 2. Transitivität; 3. Ausschluss von Diktatur; 4. Pareto-Prinzip; 5. Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (IIA). Das Dokument erläutert jede dieser Bedingungen im Detail. Der Beweis der Unmöglichkeit, dass alle Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden können, wird nicht im Detail dargestellt, da dies eine bloße Wiederholung bekannter Lehrbuchinhalte wäre.
Welche Arten von Alternativenmengen werden im Dokument betrachtet?
Das Dokument unterscheidet verschiedene Arten von Alternativenmengen: qualitative und quantitative, diskrete und stetige, offene und geschlossene Mengen. Es werden Beispiele für verschiedene Entscheidungsprobleme angeführt und die unterschiedlichen Verfahren zur Entscheidungsfindung (Marktmechanismus und Wahl) diskutiert, wobei die Abhängigkeit von der Art der Alternativenmenge hervorgehoben wird. Arrows Untersuchung konzentriert sich auf Entscheidungsprobleme mit geschlossenen Alternativenmengen.
Wie werden individuelle Präferenzen aggregiert?
Die Aggregation individueller Präferenzen zu einer kollektiven Ordnung geschieht mittels der kollektiven Wohlfahrtsfunktion (KWF). Das Dokument beschreibt den Prozess der Aggregation und die Rolle der KWF dabei. Es wird erklärt, wie die einzelnen Bedingungen von Arrows Theorem die Möglichkeiten der Aggregation einschränken.
Welche Lösungsansätze für das Unmöglichkeitstheorem werden angesprochen?
Das Dokument deutet an, dass mögliche Lösungsansätze für das Unmöglichkeitstheorem in Kapitel 4 behandelt werden. Konkrete Lösungsansätze werden jedoch in der Zusammenfassung der Kapitel nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit Arrows Unmöglichkeitstheorem wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Arrows Unmöglichkeitstheorem, kollektive Entscheidungsfindung, kollektive Wohlfahrtsfunktion (KWF), Social Choice Theorie, Präferenzordnungen, Alternativenmengen, demokratische Prinzipien, Pareto-Prinzip und Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen (IIA).
- Citar trabajo
- Jan Franke (Autor), 2011, Arrows Unmöglichkeitstheorem, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191752