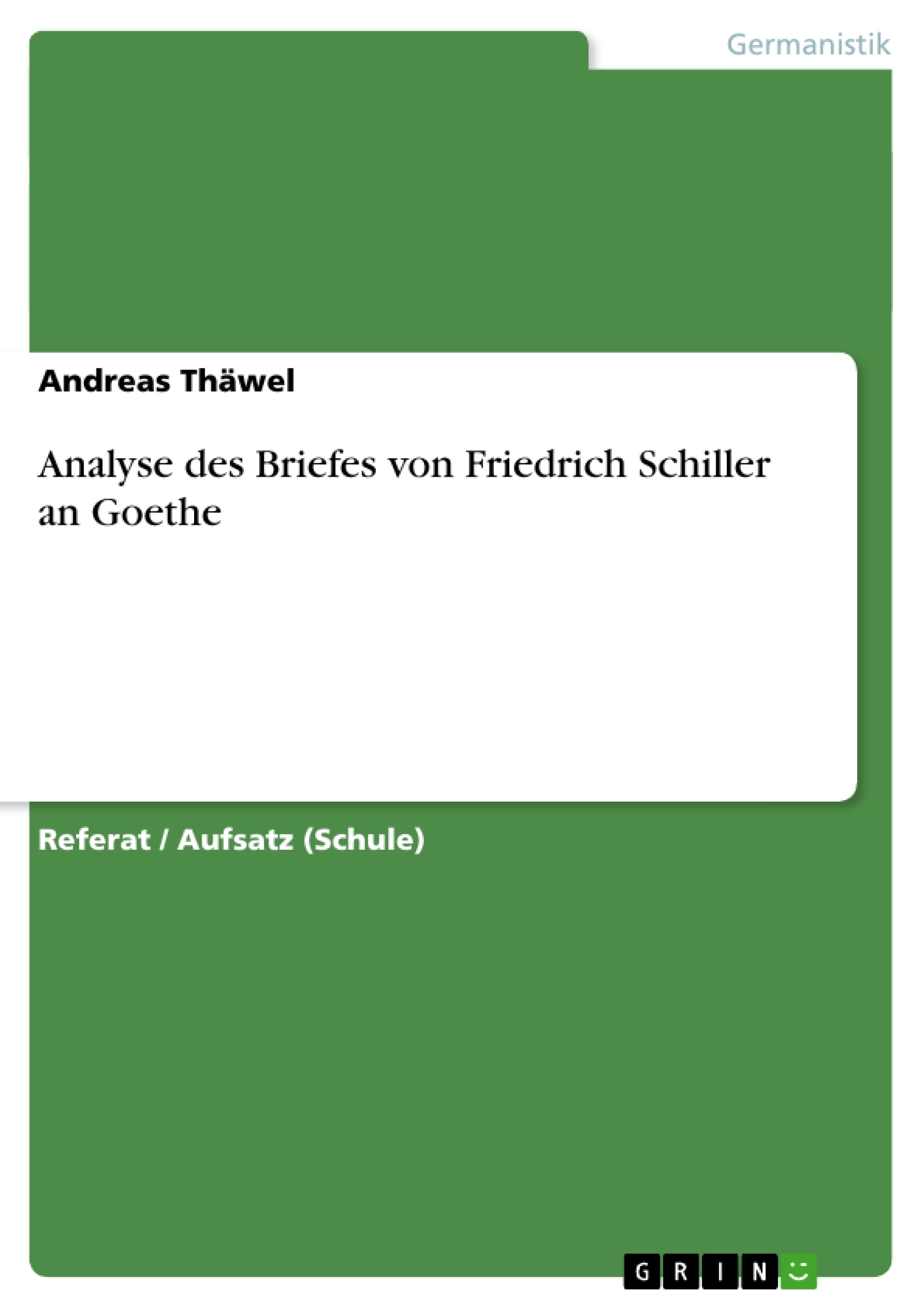„…Ich dachte mich selbst zu verlieren, und verliere nun einen Freund und in demselben die Hälfte meines Daseins…“[1]. Diese Worte verfasst Goethe nach dem Tod Schillers an einen Freund. Denn zu Lebzeiten Schillers verband die Beiden eine enge Freundschaft und so entstand der zu analysierende Brief Schillers an Goethe aus dem Jahre 1802, in welchem er das Drama „Iphigenie auf Tauris“ kritisiert. Selbiges war von Goethe im Jahre 1779 verfasst worden, wobei Goethe es später in Versform überarbeitete und erneut veröffentlichte.
Das Drama handelt von einer Griechin Namens „Iphigenie“, die in der Antike lebte und den Göttern geopfert werden soll. Die Göttin Diane verhindert dies jedoch und bringt sie auf die Insel „Tauris“ (V. 56), auf welcher Iphigenie fortan als Priesterin der Diane lebt (vgl. v. 40f). Später muss sie sich jedoch entscheiden, ob sie ihren Bruder opfern möchte, oder den König Thoas, der für sie wie ein Vater ist, betrügen um den Tantalidenfluch, der auf ihrer Familie lastet zu durchbrechen. Eine humane und dialektische Lösung trägt zum Schluss jedoch dazu bei, dass der König Thoas Iphigenie und ihren Bruder mit den Worten „So geht!“ (V. 2151) ziehen lässt....
Inhaltsverzeichnis
- Analyse des Briefes von Friedrich Schiller an Goethe
- Kritik an der Länge des Dramas
- Kritik an der Spannungslosigkeit des Dramas
- Kritik an der Figur des Orest
- Schillers Rolle als Kritiker
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert einen Brief von Friedrich Schiller an Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahre 1802, in welchem Schiller das Drama „Iphigenie auf Tauris“ von Goethe kritisiert. Die Analyse beleuchtet die Kritikpunkte Schillers, die Art und Weise seiner Argumentation sowie die Beziehung zwischen den beiden Weimarer Klassikern.
- Schillers Kritik an der Länge, der Spannungslosigkeit und der Figur des Orest in „Iphigenie auf Tauris“
- Die Analyse der rhetorischen Mittel und stilistischen Möglichkeiten, die Schiller in seinem Brief verwendet
- Die Beziehung zwischen Schiller und Goethe, die sich in der Kritik Schillers widerspiegelt
- Die Rolle Schillers als Kritiker und seine Bemühungen, Goethe konstruktiv zu helfen
- Die Analyse der dramatischen Elemente des Stückes „Iphigenie auf Tauris“ im Kontext der Kritik Schillers
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Analyse beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der Handlung von „Iphigenie auf Tauris“ und stellt die zentralen Figuren und Konflikte des Dramas vor.
- Schillers Kritik an der Länge des Dramas wird im Detail untersucht, wobei die Argumente Schillers und seine Formulierungen analysiert werden.
- Die Kritik an der Spannungslosigkeit des Dramas wird beleuchtet, mit dem Fokus auf die Punkte, die Schiller in diesem Zusammenhang anmerkt.
- Die Analyse der Kritik Schillers an der Figur des Orest fokussiert auf die Argumente, die Schiller vorbringt, und die möglichen Implikationen für das Drama.
- Die Arbeit untersucht die Rolle Schillers als Kritiker, die Art und Weise seiner Argumentation und seine Beziehung zu Goethe.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, „Iphigenie auf Tauris“, Kritik, Dramenanalyse, Weimarer Klassik, Literaturgeschichte, Rhetorik, Stilistik, Freundschaft, Kunst und Literatur.
- Arbeit zitieren
- Andreas Thäwel (Autor:in), 2012, Analyse des Briefes von Friedrich Schiller an Goethe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190571