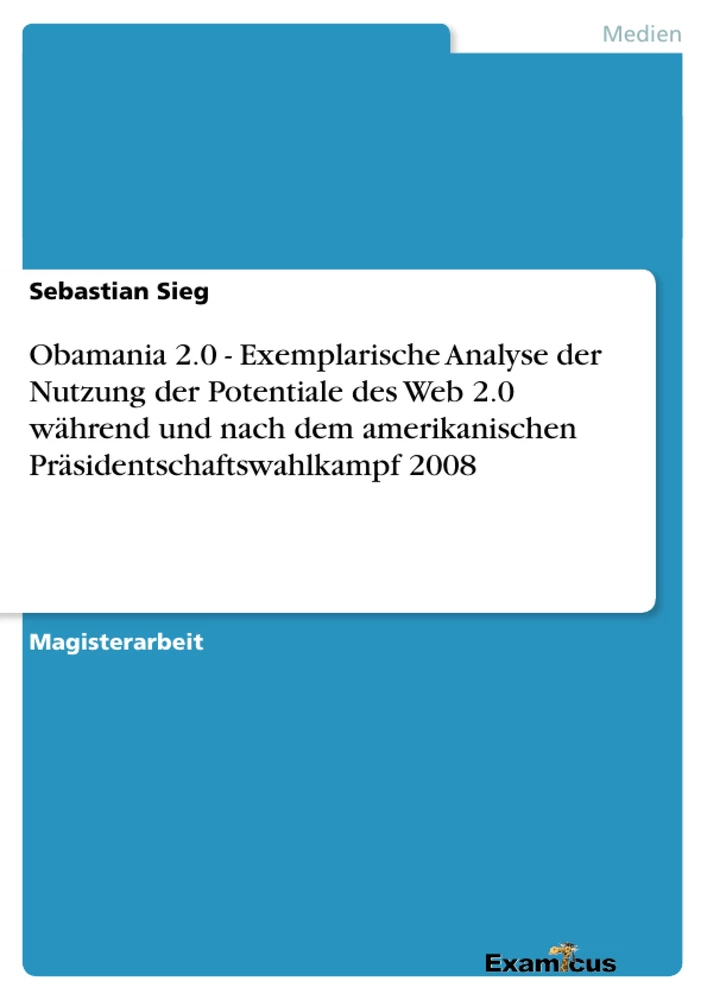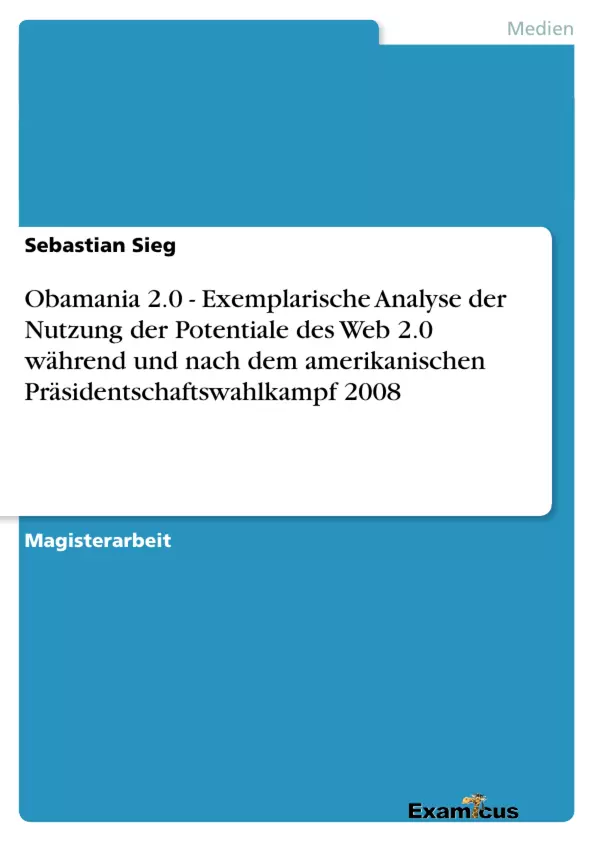Einheit (unity), Hoffnung (hope) und Wandel (change) – mit diesen drei Schlagwörtern zog Barack Obama die amerikanische Bevölkerung in seinen Bann. Bereits auf dem Parteitag der Demokraten im Juli 2004, auf dem damals John Kerry offiziell als Präsidentschaftskandidat der Demokraten vorgestellt werden sollte, betonte Obama in einer Grundsatzrede auf eindrucksvolle Art und Weise seine Position zum Thema Einheit:
„[...] there is not a liberal America and a conservative America -- there is the United States of America. There is not a Black America and a White America and Latino America and Asian America -- there’s the United States of America.“ (Barack Obama 2004, S. 4 – Auslassung durch den Autoren S.S.)
Seither galt Barack Obama als aufsteigender Stern der Demokraten, der mit der Nominierung für die Präsidentschaftswahlen 2008 eigentlich nur eine Bewährungschance erhalten sollte. Dass Obama tatsächlich zum US-Präsidenten gewählt wurde, ist seiner Persönlichkeit, Authentizität, Rhetorik und der strategischen Nutzung des Internet zu verdanken. Letzteres markiert den Themenbereich dieser Arbeit.
Mit der Entwicklung des Internet (2008: 223 Millionen Nutzer in den USA ) als Konkurrenzmedium zu den etablierten Medien (Presse/Rundfunk/Fernsehen) verlagerten sich Teile der Kommunikation politischer Inhalte zunehmend in den virtuellen Raum. Im Jahr 2008 verwendeten 60 Prozent der Internetnutzer den virtuellen Raum als Nachrichtenquelle (Smith 2009). Für 59 Prozent der 18-29 Jährigen entwickelte sich das Internet sogar neben dem Fernsehen zur Hauptinformationsquelle (Pew 2008c). Die Medien und Politik befinden sich in einem Wandlungsprozess.
Wie Rosenberg/Leyden (2007) ausführen, lassen sich in diesem Zusammenhang Parallelen zum Amtsantritt Franklin Delano Roosevelts (FDR) im Jahr 1933 ziehen. FDR löste Herbert Clark Hoover als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ab. Er begann nicht nur eine neue Ära der Politik, sondern auch einen neuen Umgang mit dem damals neuen Medium Radio. Durch die Radioübertragungen seiner fireside chats erreichte FDR potentiell jeden Amerikaner in seinem Wohnzimmer (Rosenberg/Leyden 2007). 76 Jahre später ist es Barack Obama, der mit Hilfe des Internet die direkte Ansprache potentieller Wähler im digitalen Zeitalter vollzieht.
Die Entwicklung des Internet bzw. des Web 2.0 vollzieht sich fortlaufend und unter exponentiellem Tempo. Diese Tatsache gibt Anlass dafür, einen genaueren Blick auf die Elemente des Web 2.0...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Präsident und die Wahlen
- Demokratieverständnis
- Parteiensystem
- Konstitutionelle Anforderungen für die Wahl eines US-Präsidenten
- Wahlen in den USA
- Nominierungsverfahren
- Vorwahlen (presidential primaries)
- Hauptwahl (general election)
- Wahlbeteiligung
- Die Generation der „Millenials“
- Der virtuelle Raum
- Eine Gesellschaft am Scheidepunkt – Internetnutzung in den USA
- Das Internet - Quelle politischer Informationen und Ort politischer Interaktion
- Das Internet als Konkurrenzmedium zu den etablierten Medien
- Altersklassenaufteilung der Interaktion mit politischen Inhalten im Internet
- Demokraten vs. Republikaner
- Zwischenfazit
- Web 2.0
- Aus Märkten werden Communitys
- Web 2.0 Definition
- Interaktivität und Partizipation
- Mobilisierung im Web 2.0
- Entwicklung des US-Wahlkampfes im Internet
- John McCain 2000
- Dean For America
- Innovationen der Dean-Kampagne
- Lehren aus der Dean-Kampagne
- Im Dialog mit den Wählern
- Wählerforschung
- Dialogmarketing – Definition und Vorteile
- Dialogmarketing im Wahlkampf
- The Big Data
- Datenbanken der Demokraten/Republikaner
- Catalist
- Datenarten
- Marktsegmentierung
- Internetmarketing
- Instrumente und Definition
- Search Marketing
- Suchoptimierung („natural search“)
- Platzierung von Werbung („paid search“)
- Online-Werbung
- Werbung in Webblogs
- Grenzen der direkten Kundenansprache
- Wahlkampffinanzierung
- Formen der Einnahmen
- Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) von 2002
- Öffentliche Wahlkampffinanzierung
- Private Wahlkampffinanzierung
- Spendenstrategie Obama/Clinton/McCain
- Ausgaben
- Nutzung der Potentiale des Web 2.0
- Obamas Team im virtuellen Raum
- Web-Traffic-Analyse
- Anzahl der individuellen Besucher (unique visitors)
- Die Elemente des Web 2.0 der Obama-Kampagne
- Webblogs
- Motivation und Entstehung von Blogs
- Wachstum und Entwicklung von Blogs
- Blogosphäre vs. Journalismus
- Die Blogosphäre als Mitspieler im Wahlkampf
- Die neue Online-Elite
- Spaltung der Blogs
- Obamas Vernetzung in der Blogosphäre
- Ausrichtung der Kampagnen auf die Blogosphäre
- Webvideos
- Kategorien
- Nutzung von Webvideos
- Fallbeispiele
- User-generated content
- Virale Webvideos
- Soziale Netzwerke
- Sozialkapital
- Sozialkapital 2.0
- Interessengemeinschaften
- Nutzergruppen
- Obamas Netzwerke
- http:///www.My.BarackObama.com (MyBO)
- Rückkopplungseffekte
- Aktivitätsindex - Motivation durch Transparenz
- MyBO – Ziele und Ergebnisse
- Der MyBO-Faktor
- Obama – Microtargeting
- Webblogs
- Zieldimensionen der Obama Kampagne
- Differenzierung der Ziele
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit „Obamania 2.0“ analysiert exemplarisch die Nutzung der Potentiale des Web 2.0 während und nach dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008. Sie zielt darauf ab, die Bedeutung neuer Kommunikationstechnologien im politischen Kontext zu beleuchten und die Erfolgsfaktoren der Obama-Kampagne im digitalen Raum zu identifizieren.
- Entwicklung und Nutzung des Web 2.0 im politischen Kontext
- Die Rolle von Social Media und Online-Plattformen im Wahlkampf
- Die Strategie der Obama-Kampagne im digitalen Raum
- Die Auswirkungen von Web 2.0 auf die politische Kommunikation und die Wahlbeteiligung
- Die Bedeutung von Datenanalyse und Microtargeting im Wahlkampf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt den Kontext des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes 2008 vor. Anschließend werden die zentralen Aspekte der politischen Landschaft in den USA beleuchtet, darunter das Demokratieverständnis, das Parteiensystem, die konstitutionellen Anforderungen für die Wahl eines US-Präsidenten und das Wahlsystem. Im Anschluss wird der virtuelle Raum und die Bedeutung des Internets in der amerikanischen Gesellschaft fokussiert. Die Arbeit befasst sich mit der Nutzung des Internets als Quelle politischer Informationen, als Ort politischer Interaktion und als Konkurrenzmedium zu den etablierten Medien.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Web 2.0 und seinen Potenzialen im Wahlkampf. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des US-Wahlkampfes im Internet, insbesondere die Strategien der Kandidaten John McCain und Howard Dean. Die verschiedenen Elemente des Web 2.0, wie z. B. Blogs, Webvideos und soziale Netzwerke, werden im Detail betrachtet und auf ihre Bedeutung im Wahlkampf eingegangen. Die Arbeit analysiert die Nutzung dieser Instrumente durch die Obama-Kampagne und zeigt, wie sie zur Mobilisierung von Wählern und zur Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit eingesetzt wurden.
Darüber hinaus wird die Wahlkampffinanzierung in den USA beleuchtet und die verschiedenen Formen der Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Die Arbeit geht auf die Bedeutung von Spendenstrategien und Datenanalyse im Wahlkampf ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Web 2.0, politische Kommunikation, Wahlkampfstrategie, Social Media, Online-Marketing, Microtargeting, Datenanalyse, Wahlkampffinanzierung, Obama-Kampagne, amerikanisches Parteiensystem, Demokratieverständnis und Wahlbeteiligung.
- Citar trabajo
- Sebastian Sieg (Autor), 2009, Obamania 2.0 - Exemplarische Analyse der Nutzung der Potentiale des Web 2.0 während und nach dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190465