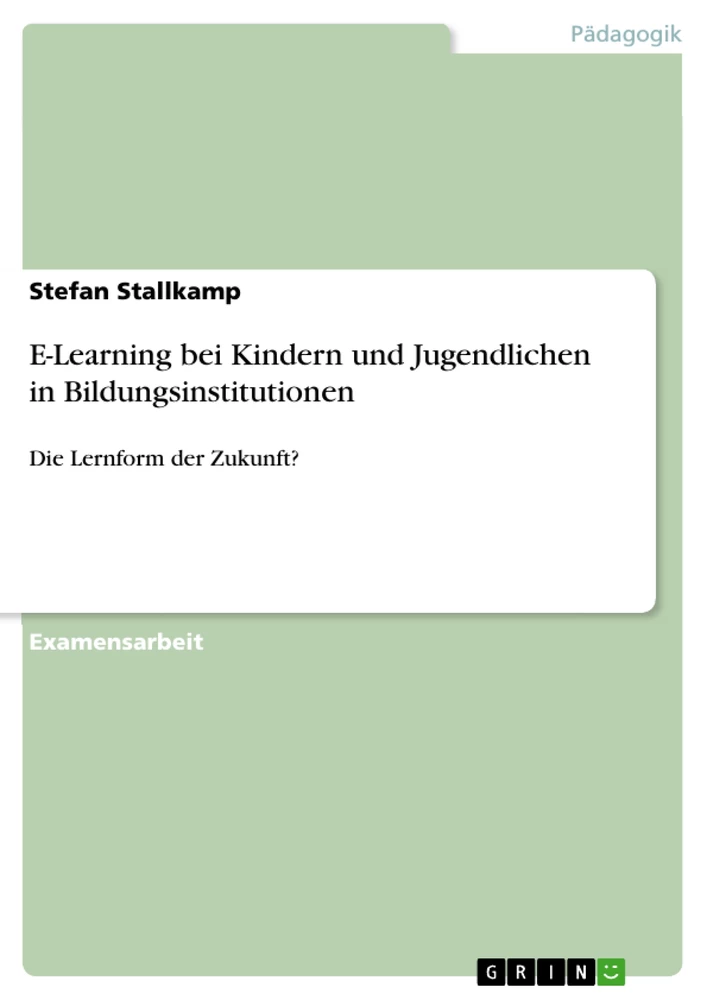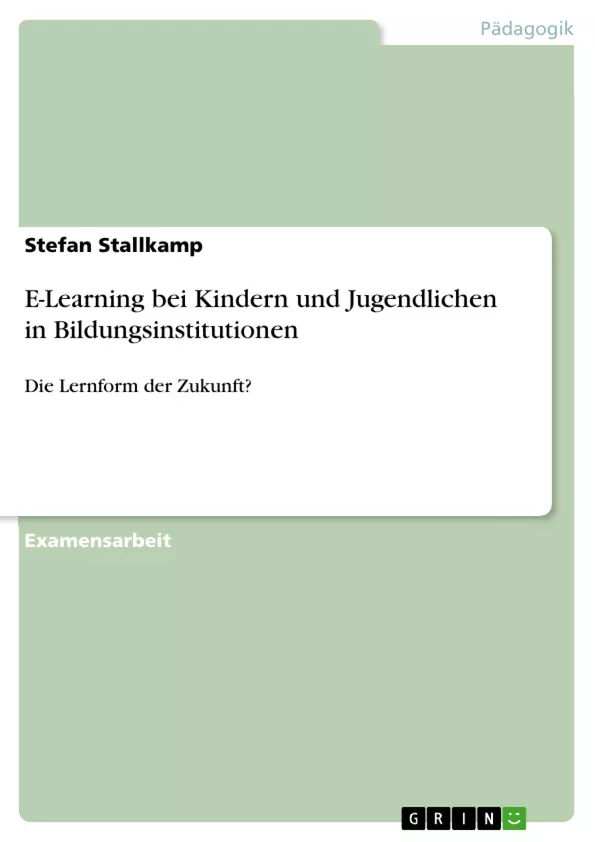Im Rahmen dieser Arbeit soll E-Learning als Ansatz für die Unterstützung und
Gestaltung der Bildungsprozesse bei Kindern und Jugendlichen dargestellt und
bewertet werden.
Dazu sollen der Begriff, die Vorrausetzungen und die Anwendung des E-Learning
aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden und seine potenzielle
Relevanz für die Jugendlichen herausgestellt werden.
Ferner wird diskutiert, ob es aus gesellschaftlich-bildungspolitischer Sicht überhaupt
sinnvoll ist, diese technischen Innovationen in zentrale Lernorte bzw.
Bildungsinstitutionen zu integrieren und inwiefern das E-Learning traditionelle
Lernformen ersetzen bzw. die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen erheblich
verbessern kann.
Grenzen und Möglichkeiten des E-Learning werden somit kenntlich gemacht.
E-Learning mag auf den ersten Blick viele Vorteile bieten, beispielsweise eine Raumund
Zeitunabhängigkeit, und mag für den Lernenden sehr flexibel und nützlich
erscheinen. Dennoch sollte man einen umfassenden Bildungsbegriff als einen
gesamthaften Prozess verstehen, der auch gesteigerten Wert auf
Persönlichkeitsentwicklung und soziale Kompetenzen legt, die man nicht
unberücksichtigt lassen sollte, wenn man die Jugendlichen adäquat auf die
schwierigen Anforderungen einer globalisierten Welt vorbereiten will. Insofern
impliziert das E-Learning nicht nur eine Chance, sondern stellt insbesondere eine
Herausforderung für die Bildungsinstitutionen dar, die es aufzuzeigen gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Inhalte und Begrifflichkeiten
- Definition E-Learning
- E-Learning und Medienkompetenz
- Konstitutive Merkmale des E-Learning
- Interaktivität
- Multimedialität
- Adaptivität
- E-Learning und seine Bedeutung für das Bildungswesen
- Die Informations- und Wissensgesellschaft
- Neue Lehr-/Lernkultur
- Neue Medien im Bildungsprozess
- Lerntheoretische Strömungen und E-Learning
- Der Behaviorismus
- Theoretische Grundannahmen des Behaviorismus
- Behaviorismus und E-Learning
- Die Programmierte Instruktion
- Der kybernetische Ansatz
- Fazit: E-Learning Programme auf behavioristischer Basis
- Der Kognitivismus
- Theoretische Grundannahmen des Kognitivismus
- Kognitivismus und E-Learning
- Intelligente tutorielle Systeme
- Interface Agenten
- Fazit der kognitivistischen Programme
- Der Konstruktivismus
- Theoretische Grundannahmen des Konstruktivismus
- Konstruktivismus und E-Learning
- E-Learning Programme auf Basis des Konstruktivismus
- Anchored Instruction
- Der Cognitive Apprenticeship Ansatz
- Der Cognitive Flexibility Ansatz
- Die drei lerntheoretischen Strömungen im Vergleich
- Vor- und Nachteile von E-Learning
- Nachteile von E-Learning
- Vorteile von E-Learning
- Resümee der Vor- und Nachteile Diskussion
- Gesamtfazit und Ausblick
- Schlusswort mit persönlicher Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema E-Learning im Kontext der Bildungsprozesse bei Kindern und Jugendlichen. Das Ziel ist es, E-Learning als Ansatz zur Unterstützung und Gestaltung dieser Prozesse zu analysieren und zu bewerten. Dabei werden der Begriff, die Voraussetzungen und die Anwendung des E-Learning aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, sowie die potenzielle Relevanz für Jugendliche hervorgehoben. Die Arbeit hinterfragt kritisch, ob und inwiefern die Integration von E-Learning in Bildungsinstitutionen sinnvoll ist und ob es traditionelle Lernformen ersetzen oder die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen verbessern kann.
- Definition und Bedeutung von E-Learning im Bildungsbereich
- Analyse der konstitutiven Merkmale von E-Learning
- Einfluss von E-Learning auf die Lernkultur und das Bildungswesen
- Bewertung der Vor- und Nachteile von E-Learning
- Relevanz von E-Learning für die Herausforderungen der Informationsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema E-Learning ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der digitalen Transformation im Bildungsbereich.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit zentralen Begriffen und Konzepten des E-Learning. Es wird die Definition des Begriffs E-Learning gegeben, der Zusammenhang mit Medienkompetenz hergestellt und die konstitutiven Merkmale von E-Learning (Interaktivität, Multimedialität, Adaptivität) erläutert.
Kapitel 3 analysiert verschiedene lerntheoretische Strömungen und deren Relevanz für E-Learning. Es werden die Grundannahmen des Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus dargestellt und die jeweiligen E-Learning-Programme und -Methoden beleuchtet, die sich auf diese Strömungen stützen.
Kapitel 4 diskutiert Vor- und Nachteile von E-Learning. Es werden sowohl die Potenziale als auch die Risiken des E-Learning für Kinder und Jugendliche aufgezeigt und die Diskussion über die zukünftige Rolle von E-Learning im Bildungssystem eingeleitet.
Schlüsselwörter
E-Learning, Medienkompetenz, Bildungsprozesse, Kinder, Jugendliche, Informationsgesellschaft, Lerntheorien, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken, digitale Transformation, Bildungswesen, Lernkultur.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernmerkmale von E-Learning?
Zu den konstitutiven Merkmalen gehören Interaktivität (Austausch mit dem System), Multimedialität (Kombination von Text, Bild, Ton) und Adaptivität (Anpassung an das Lernniveau).
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus beim E-Learning?
Der Konstruktivismus sieht Lernen als aktiven Aufbau von Wissen. E-Learning unterstützt dies durch problemorientierte Umgebungen wie "Anchored Instruction" oder "Cognitive Apprenticeship".
Was sind die Vorteile von E-Learning für Jugendliche?
Vorteile sind zeitliche und räumliche Flexibilität, die Förderung von Medienkompetenz und die Möglichkeit zum individuellen, selbstgesteuerten Lernen.
Welche Nachteile hat E-Learning im Bildungswesen?
Mögliche Nachteile sind soziale Isolation, die Vernachlässigung der Persönlichkeitsentwicklung und die Gefahr, dass technisches Wissen über pädagogische Ziele gestellt wird.
Was ist Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien kritisch, reflektiert und verantwortungsbewusst zu nutzen, was in einer Informationsgesellschaft eine zentrale Schlüsselqualifikation darstellt.
- Quote paper
- Stefan Stallkamp (Author), 2009, E-Learning bei Kindern und Jugendlichen in Bildungsinstitutionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190308