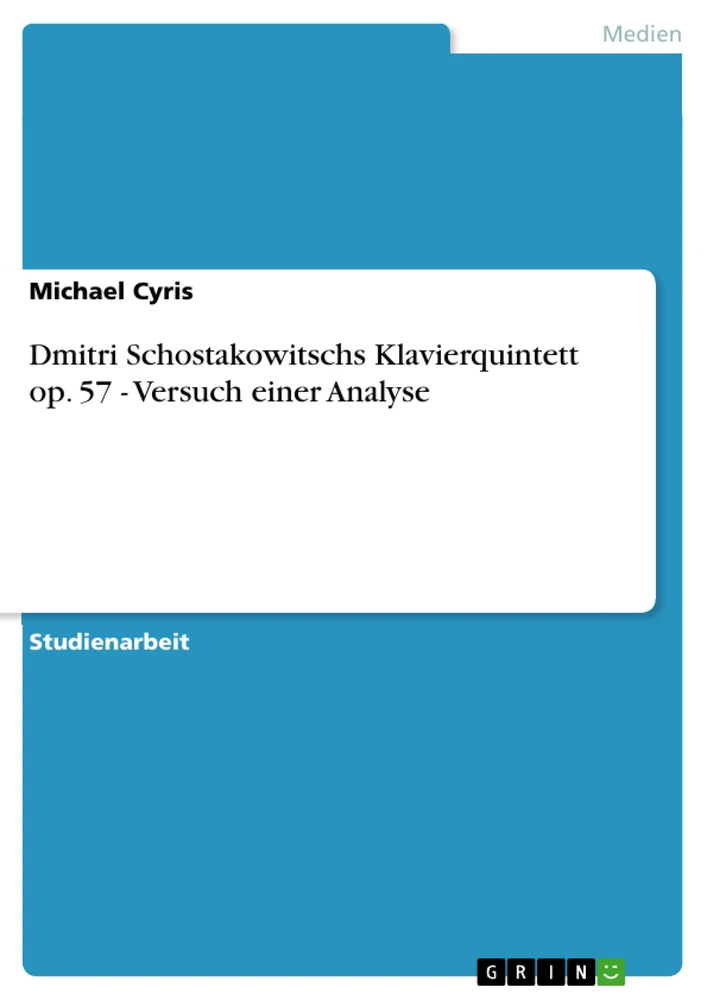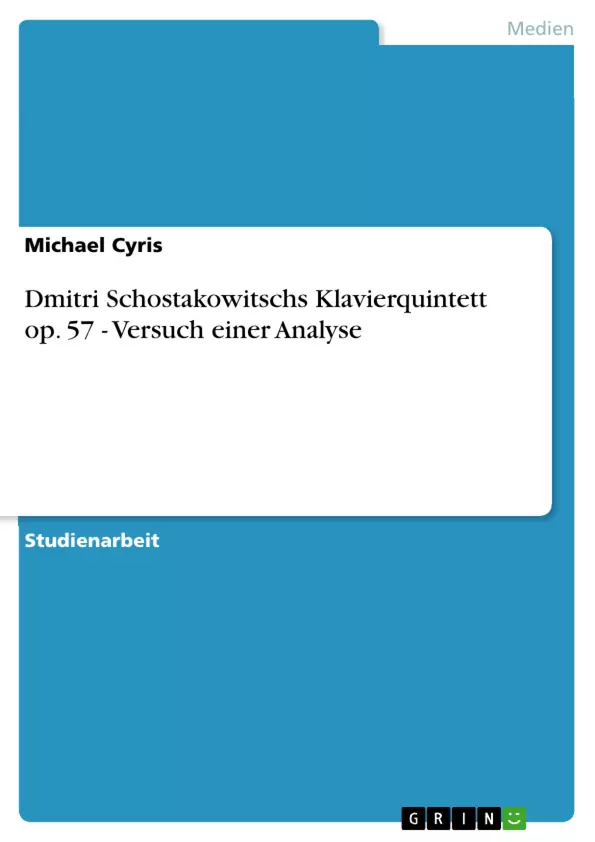„Man muß Schostakowitsch Gerechtigkeit widerfahren lassen: Dem allgemeinen Eindruck nach enthält seine Fuge unglaublich viel Neues [...]“
So äußert sich der ebenfalls sowjetische Komponist Sergei Prokofjew zu einem der Sätze aus Schostakowitschs Klavierquintett g-Moll op. 57 aus dem Jahr 1940. Auch wenn die Formulierung „dem allgemeinen Eindruck nach“ etwas abfällig daherkommt scheint der Schöpfer von „Peter und der Wolf“ doch dieses Kompliment recht ernst zu meinen.
Auch über die anderen Sätze bildet sich Schostakowitschs Komponistenkollege eine Meinung. Der an zweiter Stelle erscheinende Fugensatz steche jedoch wie gesagt hervor.
Aus der bachschen Tradition heraus unternahmen die Komponisten der nachfolgenden Generationen vielerlei Versuche originelle Fugen zu schreiben und dem damit dieser traditionellen Form ein gewisses Maß an Neuartigkeit beizubringen. Im Bezug hierauf räumt Prokofjew allenfalls Hindemith das Gelingen dieses Versuchs ein, der in seinen Sonaten ebenfalls mit fugenartigen Strukturen experimentierte. (Meyer 1998, S.173)
Nicht vergessen werden darf, abgesehen von der Analyse einzelner Teilsätze des Werks auch der historische Kontext der Entstehung und Rezeption des Klavierquintetts.
Aus der Musikgeschichte heraus muss man Schostakowitsch ohnehin immer als Komponisten vor einem rumorenden politischen Hintergrund der Stalin-Ära sehen und verstehen. Man denke hierbei etwa an die beiden Sinfonien, die Salingrader und die Leningrader Sinfonie.
Ob es sich bei dem vorliegenden Werk ebenfalls um ein stark politisch konnotiertes und damit entweder revolutionäres oder traditionsbewusstes Werk handelt will die vorliegende Arbeit ergründen. Dabei erfolgt zunächst die Erörterung des Entstehungshintergrunds des Werkes und seine Rezeption um dann gefolgt von der Analyse (eines, zweier) Sätze zu einer möglichen Interpretation des Werkes zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werkgeschichte und Entstehungshintergrund
- Analyse
- Überblick über die Anlage des Gesamtwerks nach Smallman
- Analyse des zweiten Satzes (Fuge)
- Analyse des Scherzo
- Rezeption und Wirkung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Dmitri Schostakowitschs Klavierquintett g-Moll op. 57 aus dem Jahr 1940. Das Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte des Werkes zu beleuchten, seine Rezeption zu analysieren und die verschiedenen Aspekte seiner musikalischen Struktur zu untersuchen.
- Der historische Kontext der Entstehung des Klavierquintetts und die politische Situation der Stalin-Ära
- Die musikalische Struktur des Werkes, insbesondere die Verwendung von Fugenformen
- Die Rezeption des Werkes durch Zeitgenossen und Kritiker
- Die Analyse des zweiten Satzes (Fuge) als ein zentrales Element des Werkes
- Die Verbindung von musikalischer Form und politischer Aussage im Klavierquintett
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Klavierquintetts ein und beleuchtet die Bedeutung des Werkes im Kontext der Musikgeschichte. Der erste Abschnitt widmet sich der Entstehung des Werkes und dem historischen Kontext, in dem es entstand.
Der zweite Abschnitt stellt die Anlage des Gesamtwerks nach Basil Smallman dar, mit einem besonderen Fokus auf den zweiten Satz, die Fuge.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter für die Analyse von Schostakowitschs Klavierquintett op. 57 sind: Dmitri Schostakowitsch, Klavierquintett, Fuge, polyphone Musik, russische Musikgeschichte, Stalin-Ära, politische Konnotationen, musikalische Analyse, Kompositionsgeschichte, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Wann entstand das Klavierquintett op. 57 von Schostakowitsch?
Dmitri Schostakowitsch komponierte das Klavierquintett g-Moll im Jahr 1940, in einer politisch rumorenden Zeit der Stalin-Ära.
Was ist das Besondere an der Fuge in diesem Werk?
Der zweite Satz ist eine Fuge, die für ihre Neuartigkeit gelobt wurde. Schostakowitsch knüpft an die bachsche Tradition an, verleiht der Form aber eine moderne, originelle Struktur.
Welchen Einfluss hatte die Stalin-Ära auf die Komposition?
Die Arbeit untersucht, ob das Quintett als politisch konnotiertes Werk zu verstehen ist – ob es revolutionäre Tendenzen zeigt oder eher traditionsbewusst den Erwartungen der Zeit entsprach.
Wie wurde das Werk von Zeitgenossen aufgenommen?
Das Werk erhielt viel Aufmerksamkeit; sogar Komponistenkollegen wie Sergei Prokofjew äußerten sich (wenn auch teils ambivalent) lobend über die innovative Kraft der Fuge.
Welche Sätze stehen im Fokus der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich besonders auf den zweiten Satz (Fuge) und das Scherzo, eingebettet in einen Überblick über die Gesamtanlage des Werks.
- Citar trabajo
- Michael Cyris (Autor), 2010, Dmitri Schostakowitschs Klavierquintett op. 57 - Versuch einer Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188737