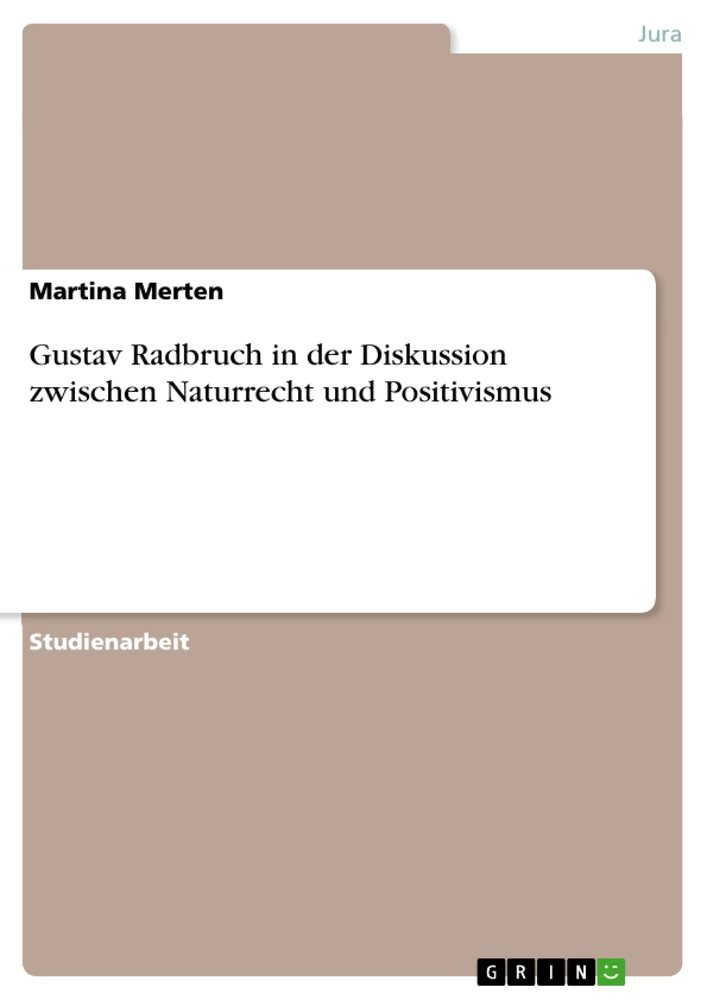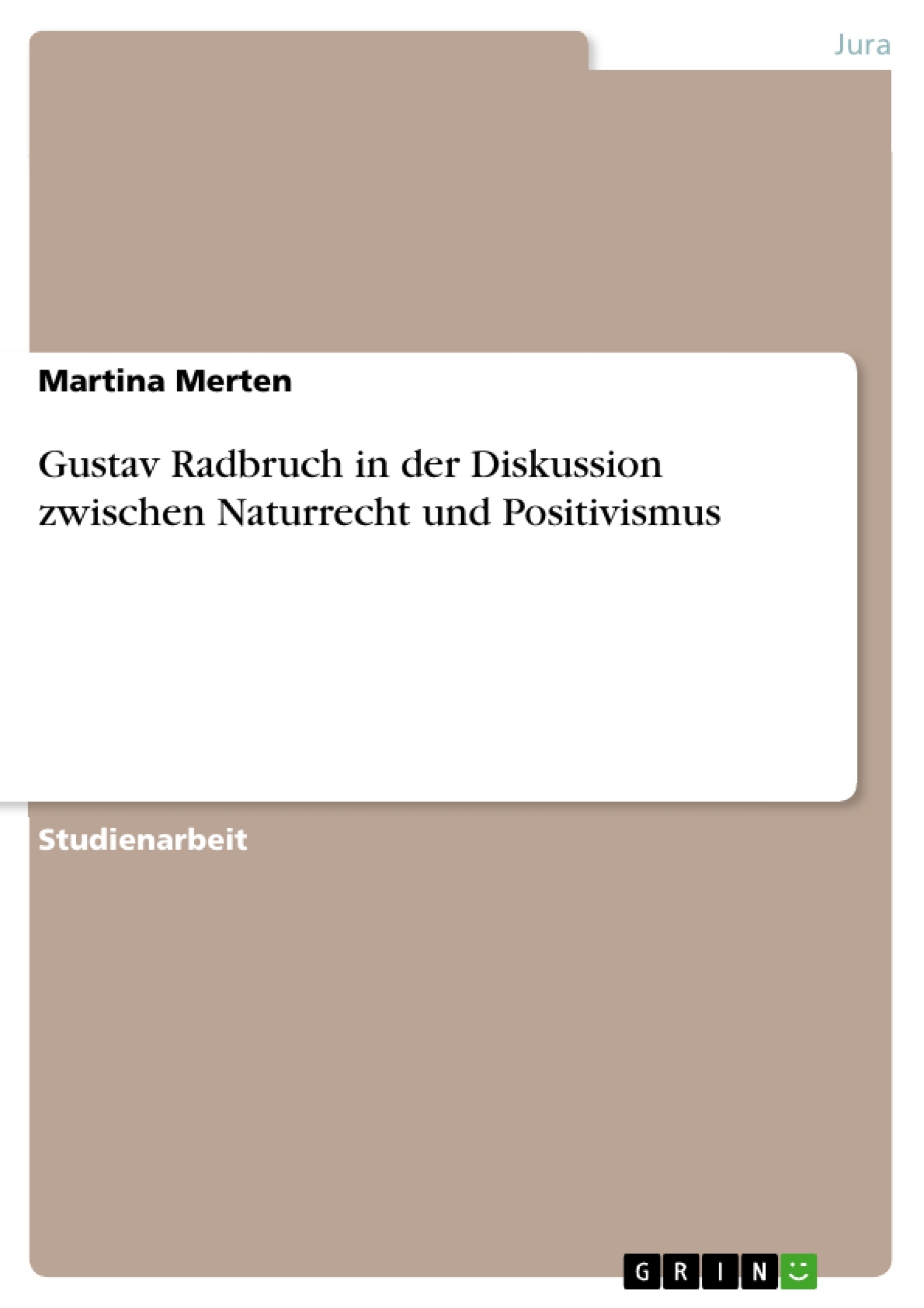Radbruchs Rechtsphilosophie entstammt dem Neukantianismus, der davon ausgeht, dass eine kategoriale Kluft zwischen Sein und Sollen besteht. Aus einem Sein kann, nach dieser Auffassung, niemals ein Sollen abgeleitet werden (so genannter „naturalistischer Trugschluss“). Kennzeichnend für den Heidelberger Neukantianismus, dem Radbruch anhing, war es, dass er zwischen die erklärenden Wissenschaften (Sein) und die philosophischen Wertlehren (Sollen) die wertbezogenen Kulturwissenschaften einschiebt.
Bezogen auf das Recht zeigt sich dieser Trialismus in den Teilbereichen Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie und Rechtsdogmatik. Die Rechtsdogmatik nimmt dabei eine Zwischenstellung ein. Gegenständlich richtet sie sich auf das positive Recht, wie es sich in der sozialen Realität darstellt und methodologisch auf den objektiv gesollten Sinn des Rechts, der sich durch wertbezogene Interpretation erschließt.
Kernstücke der Rechtsphilosophie Radbruchs sind auch seine Lehren vom Rechtsbegriff und von der Rechtsidee. Die Rechtsidee ist durch eine Trias von Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit definiert. Radbruch lässt dabei die Idee der Zweckmäßigkeit aus einer Analyse der Idee der Gerechtigkeit hervorgehen. Auf dieser Vorstellung basiert die Radbruchsche Formel, die bis heute heftig diskutiert wird. Der Rechtsbegriff ist für Radbruch nichts anderes als „die Gegebenheit, die den Sinn hat, der Rechtsidee zu dienen“.
Äußerst umstritten ist die Frage, ob Radbruch vor 1933 Rechtspositivist war und sich in seinem Denken, unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, eine innere Wende vollzog oder ob er lediglich unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Verbrechen die von ihm vor 1933 vertretene relativistische Wertlehre fortentwickelte.
Das Problem der Kontroverse zwischen Form und Inhalt der Gesetze ist in Deutschland durch die Mauerschützenprozesse (Befehlsnotstand) wieder in das Bewusstsein der Menschen gerückt. In diesem Zusammenhang wurden Radbruchs Theorien gegen die von Hans Kelsen und teilweise auch von Georg Jellinek vertretene rechtspositivistische Reine Rechtslehre ins Feld geführt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Gustav Radbruch: Das Konzept seiner Rechtsidee
- 1. Rechtswirklichkeit und Rechtsidee
- 2. Die Prinzipien der Rechtsidee
- a) Das Prinzip der Zweckmäßigkeit
- b) Das Prinzip der Gerechtigkeit
- c) Das Prinzip der Rechtssicherheit
- 3. Unbedingte Rechtssicherheit - Die Radbruchsche Auffassung bis 1933
- a) Die Macht der Gesetze durch die Rechtssicherheit
- b) Die Schwäche der Zweckmäßigkeit
- c) Die Rolle der Gerechtigkeit
- d) Die Bedingung und Antinomie der Rechtsidee
- 4. Eine Formel gegen gesetzliches Unrecht (nach 1933)
- a) Die Forderung nach Gerechtigkeit
- b) Der Rücktritt der Zweckmäßigkeit
- c) Der Erhalt der Rechtssicherheit
- 5. Natur der Sache zur Bestimmung der Idee (1947)
- 6. Die verborgene Religiösität (Kontinuität zur Sache)
- II. Radbruch in der Diskussion zwischen Naturrecht und Positivismus
- 1. Philosophie und Positivismuskontroverse
- 2. Vom Naturrecht zum Positivismus
- a) Die Definition des Naturrechtsbegriffs
- b) Zum Begriff des Positivismus
- 3. Einflüsse auf Radbruchs Rechtsphilsophie (vor 1933)
- 4. Jurisprudenz 1933 - ethische Perversion durch „legitime“ Gesetze
- 5. Rechtsmoralismus - „Radbruchsche Formel“ (nach 1945)
- a) Rechtsmoralismus zur Prävention vor gesetzlichem Unrecht
- b) Radbruch als Vertreter des „dritten Weges“
- 6. Die Fortsetzung der Diskussion seit den fünfziger Jahren
- 7. Berücksichtigung von „Grundwerten“ in Entscheidungen der BRD
- 8. Naturrechts-/Positivismusdiskussion - persönliche Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Konzept der Rechtsidee von Gustav Radbruch und untersucht seine Position im Spannungsfeld zwischen Naturrecht und Positivismus. Dabei wird Radbruchs Entwicklung von einem Vertreter der Rechtssicherheit hin zu einem Verfechter der materialen Gerechtigkeit im Kontext der NS-Zeit betrachtet.
- Die Entwicklung von Radbruchs Rechtsidee
- Die Bedeutung der Prinzipien der Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit
- Radbruchs Auseinandersetzung mit dem Naturrechtsgedanken und dem Rechtspositivismus
- Die Entstehung und Relevanz der Radbruchschen Formel
- Der Einfluss von Radbruchs Werk auf die Rechtsphilosophie und die Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Dieses Kapitel stellt das Konzept der Rechtsidee von Gustav Radbruch vor. Es analysiert die drei zentralen Prinzipien der Rechtsidee: Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die Veränderungen von Radbruchs Position im Kontext der NS-Zeit beleuchtet.
- Kapitel II: In diesem Kapitel wird die Debatte um Naturrecht und Positivismus behandelt. Radbruchs Position im Spannungsfeld zwischen beiden Denkschulen wird untersucht, insbesondere seine Entwicklung von einem eher positivistischen Ansatz hin zu einem stärker naturrechtlichen Denken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Rechtsphilosophie: Rechtsidee, Naturrecht, Positivismus, Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, Rechtssicherheit, Radbruchsche Formel, NS-Zeit, Rechtsmoralismus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Radbruchsche Formel"?
Die Formel besagt, dass positives Recht dann der Gerechtigkeit weichen muss, wenn der Widerspruch des Gesetzes zur Gerechtigkeit ein unerträgliches Maß erreicht.
Welche drei Prinzipien bilden Radbruchs "Rechtsidee"?
Die Rechtsidee wird durch die Trias von Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit definiert.
War Gustav Radbruch ein Rechtspositivist?
Vor 1933 betonte er stark die Rechtssicherheit; unter dem Eindruck der NS-Verbrechen vollzog er eine Wende hin zu materialen Gerechtigkeitswerten.
Was ist der "naturalistische Trugschluss" im Neukantianismus?
Die Auffassung, dass aus einem bloßen "Sein" (Fakten) niemals ein "Sollen" (Normen/Werte) abgeleitet werden kann.
Warum sind Radbruchs Theorien für die Mauerschützenprozesse relevant?
Seine Formel wurde herangezogen, um gesetzliches Unrecht (wie Schießbefehle) juristisch zu bewerten, auch wenn dieses zum Zeitpunkt der Tat formalem Recht entsprach.
Wie unterscheidet sich Radbruch von Hans Kelsen?
Kelsen vertrat die "Reine Rechtslehre" (Positivismus), während Radbruch eine wertbezogene Interpretation des Rechts forderte, die über die reine Form hinausgeht.
- Quote paper
- M.A. Martina Merten (Author), 1998, Gustav Radbruch in der Diskussion zwischen Naturrecht und Positivismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1886