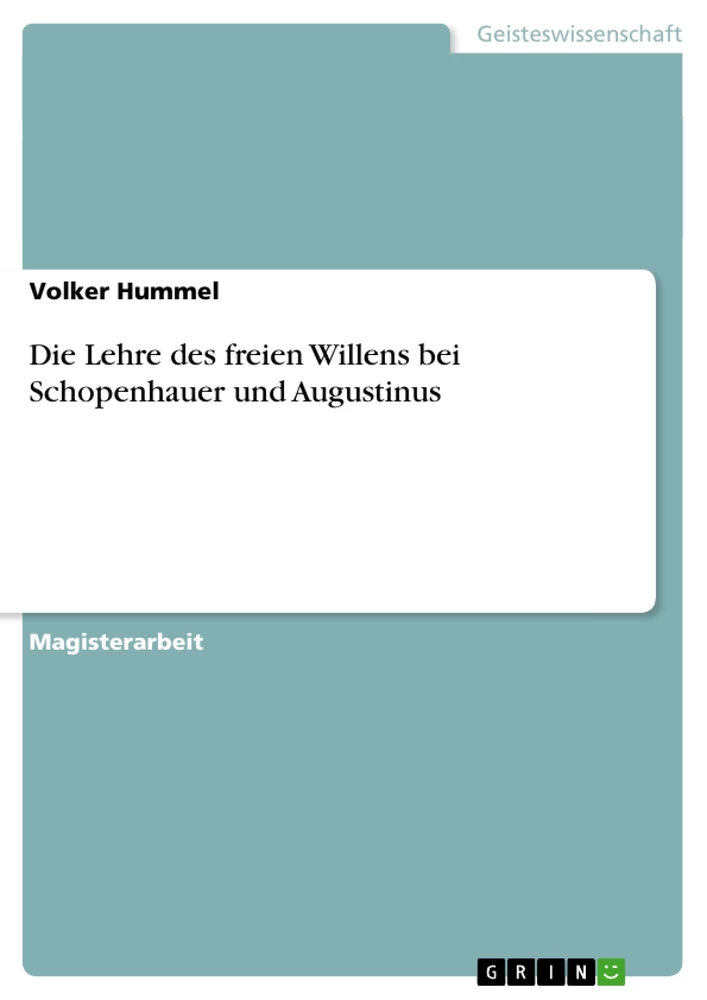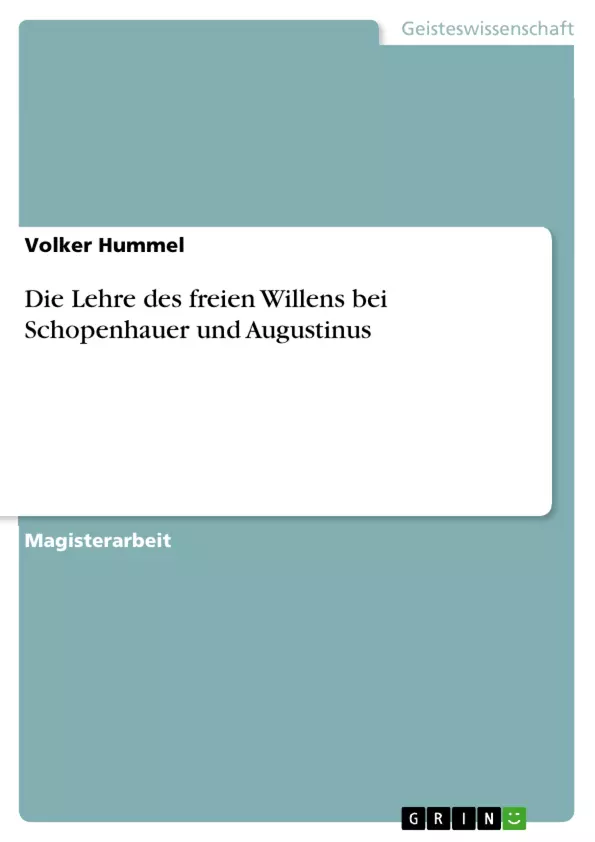1. Einleitung
Anlass für die folgende Untersuchung ist das fortwährende philosophische Problem der Willensfreiheit, welches aktuell insbesondere durch die Neurowissenschaften an Schärfe zunimmt. Diese Untersuchung will hingegen nicht das Vokabular der verschiedenen Disziplinen aufnehmen und verwischen, sondern möchte zu den Quellen zurückgreifen, die das Problem der Willensfreiheit, der Ansicht des Verfassers nach, am ergiebigsten beleuchtet haben.
[...]
1.1. Vorgehensweise
Zuerst wird Schopenhauers Preisschrift über die Freiheit des Willens näher vorgestellt, um somit die grundlegendsten Ansichten Schopenhauers hinsichtlich der Willensfreiheit nachvollziehen zu können. Dies wird noch nicht in der erforderlichen Tiefe geschehen, doch im Laufe der Überlegungen und in Rücksicht auf Schopenhauers gesamtes Werk nachgeholt.
Daraufhin folgt die Darstellung von Augustinus' Lehre über den freien Willen, wobei hier hauptsächlich die Werke De libero arbitrio und die Confessiones zu Rate gezogen werden. Im Anschluss wird eine kurze Zusammenführung der vorgestellten Lehren gegeben.
Um die daraus gewonnenen Einsichten vertiefen zu können, wird ein Bezug der schopenhauerschen Lehre der Bejahung des Willens mit der augustinischen Erbsündenlehre hergestellt, da beide für die Unfreiheit des Willens zu sprechen scheinen. Dabei wird die Erbsündenlehre selbst nicht direkt untersucht, vielmehr soll durch die Ontologie der Abfall des Menschen von Gott und seine darauffolgende Realität der Existenz verständlich gemacht werden.
Um die Freiheit des Willens geht es in der Verbindung der schopenhauerschen Verneinung des Willens mit der augustinischen Gnadenlehre.
Danach konzentriert sich die Arbeit ausschließlich auf Schopenhauer und das Problem der Willensverneinung. Die Möglichkeit der Willensverneinung soll anhand der Erkenntnis und der Ideenlehre veranschaulicht werden. Ein etwas spekulatives Denken über den Willen als Ding an sich beschließt diesen Punkt.
Am Schluss werden neuere Ansätze über die Freiheit kritisch vorgestellt, die deshalb interessieren, da sie zum einen selbst einen Bezug zu Augustinus herstellen, zum anderen deutlich machen, inwieweit Schopenhauer und Augustinus das Problem der Willensfreiheit schon durchdrungen haben.
Die Arbeit endet mit einem kleinen Überblick der zu erhoffenden, gewonnenen Einsichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorgehensweise
- 2. Der freie Wille
- 2.1. Schopenhauer: Preisschrift über die Freiheit des Willens
- 2.2. Augustinus: Voluntas
- 2.3. Zusammenführung
- 3. Bejahung des Willens und Erbsündenlehre
- 3.1. Eigenes Werk
- 3.2. Geschöpf
- 3.3. Zeitliches Gesetz
- 4. Verneinung des Willens und Gnadenlehre
- 4.1. Verneinung und Wille
- 4.2. Gnade und Wille
- 5. Das Problem der Willensverneinung bei Schopenhauer
- 5.1. Erlösung durch Erkenntnis
- 5.2. Der Wille als Ding an sich?
- 6. Vergleich mit neueren Ansätzen
- 6.1. Scheinproblem „Willensfreiheit“
- 6.2. Kompatibilismus
- 6.3. Selbstbestimmung
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Konzepte des freien Willens bei Arthur Schopenhauer und Augustinus. Das Hauptziel besteht darin, die scheinbar gegensätzlichen Positionen beider Denker zu vergleichen und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, indem die metaphysischen Grundlagen ihrer Argumentationen beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf Schopenhauer, wobei Augustinus' Werk zur kritischen Reflexion dient.
- Der freie Wille bei Schopenhauer und Augustinus
- Vergleich der metaphysischen Grundlagen beider Philosophien
- Die Rolle von Erkenntnis und Gnade im Verständnis des Willens
- Der scheinbare Gegensatz zwischen Willensbejahung und -verneinung
- Relevanz der Ansätze für moderne Debatten um die Willensfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Willensfreiheit ein und begründet die Auswahl von Schopenhauer und Augustinus als zentrale Bezugspunkte. Sie hebt die Bedeutung der Neurowissenschaften für die aktuelle Debatte hervor, betont aber den Fokus auf die philosophischen Quellen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten der beiden Denker trotz scheinbarer Gegensätze aufzuzeigen, wobei der Schwerpunkt auf Schopenhauer liegt und Augustinus zur kritischen Reflexion dient. Die Vorgehensweise der Arbeit wird skizziert.
2. Der freie Wille: Dieses Kapitel präsentiert zunächst Schopenhauers Definitionen von Freiheit und Willensfreiheit aus seiner Preisschrift, um Missverständnisse zu vermeiden. Schopenhauers Leugnung der Willensfreiheit in der empirischen Welt wird erläutert, wobei seine Betonung des Verantwortungsgefühls als Hinweis auf eine höhere moralische Freiheit herausgestellt wird. Anschließend wird Augustinus' Lehre vom freien Willen vorgestellt, mit Fokus auf dessen christliche Perspektive und die Bedeutung des Konzepts der Voluntas. Die Kapitel endet mit einer ersten Zusammenführung der beiden Positionen.
3. Bejahung des Willens und Erbsündenlehre: Dieses Kapitel untersucht die Parallelen zwischen Schopenhauers Bejahung des Willens und Augustinus' Erbsündenlehre, beides Ansätze, die scheinbar die Unfreiheit des Willens unterstützen. Die Analyse konzentriert sich auf die ontologischen Aspekte des Abfalls vom Göttlichen und die daraus resultierende menschliche Existenz.
4. Verneinung des Willens und Gnadenlehre: Hier wird der Fokus auf die scheinbar gegensätzliche Verbindung zwischen Schopenhauers Verneinung des Willens und Augustinus' Gnadenlehre gelegt. Die Untersuchung beleuchtet, wie beide Konzepte die Frage der Willensfreiheit adressieren.
5. Das Problem der Willensverneinung bei Schopenhauer: Dieses Kapitel analysiert Schopenhauers Konzept der Willensverneinung im Detail. Es beleuchtet die Rolle der Erkenntnis und der Ideenlehre sowie spekuliert über den Willen als Ding an sich.
6. Vergleich mit neueren Ansätzen: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert kritisch neuere Ansätze zur Willensfreiheit, die sowohl Bezüge zu Augustinus herstellen als auch die Tiefgründigkeit von Schopenhauers und Augustinus' Auseinandersetzung mit dem Problem der Willensfreiheit beleuchten.
Schlüsselwörter
Willensfreiheit, Schopenhauer, Augustinus, Determinismus, Erbsündenlehre, Gnadenlehre, Voluntas, Erkenntnis, Wille als Ding an sich, metaphysische Freiheit, Kompatibilismus, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Schopenhauer und Augustinus – Eine vergleichende Untersuchung des Willensbegriffs
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht und vergleicht die Konzepte des freien Willens bei Arthur Schopenhauer und Augustinus. Sie beleuchtet die metaphysischen Grundlagen beider Philosophien und sucht nach Gemeinsamkeiten trotz scheinbarer gegensätzlicher Positionen. Der Schwerpunkt liegt auf Schopenhauer, während Augustinus' Werk zur kritischen Reflexion dient.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den freien Willen bei Schopenhauer und Augustinus, vergleicht die metaphysischen Grundlagen beider Philosophien, analysiert die Rolle von Erkenntnis und Gnade im Verständnis des Willens, untersucht den scheinbaren Gegensatz zwischen Willensbejahung und -verneinung und bewertet die Relevanz der Ansätze für moderne Debatten um die Willensfreiheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Vorgehensweise. Kapitel 2 (Der freie Wille) präsentiert die Definitionen des freien Willens bei Schopenhauer und Augustinus. Kapitel 3 (Bejahung des Willens und Erbsündenlehre) untersucht Parallelen zwischen Schopenhauers Willensbejahung und Augustinus' Erbsündenlehre. Kapitel 4 (Verneinung des Willens und Gnadenlehre) befasst sich mit der scheinbaren Gegensätzlichkeit von Schopenhauers Willensverneinung und Augustinus' Gnadenlehre. Kapitel 5 (Das Problem der Willensverneinung bei Schopenhauer) analysiert Schopenhauers Konzept der Willensverneinung im Detail. Kapitel 6 (Vergleich mit neueren Ansätzen) diskutiert neuere Ansätze zur Willensfreiheit. Kapitel 7 (Schlusswort) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Willensfreiheit, Schopenhauer, Augustinus, Determinismus, Erbsündenlehre, Gnadenlehre, Voluntas, Erkenntnis, Wille als Ding an sich, metaphysische Freiheit, Kompatibilismus, Selbstbestimmung.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Schriften Schopenhauers, insbesondere seine Preisschrift über die Freiheit des Willens, und auf die Werke Augustinus'. Sie bezieht sich außerdem auf neuere Ansätze zur Willensfreiheit, die im sechsten Kapitel diskutiert werden.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel besteht darin, die scheinbar gegensätzlichen Positionen Schopenhauers und Augustinus' zum freien Willen zu vergleichen und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, indem die metaphysischen Grundlagen ihrer Argumentationen beleuchtet werden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist systematisch aufgebaut, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln, die die Konzepte des freien Willens bei Schopenhauer und Augustinus detailliert darstellen und vergleichen. Die Arbeit endet mit einem Schlusswort und einem Literaturverzeichnis (nicht im hier dargestellten HTML-Ausschnitt enthalten).
- Arbeit zitieren
- Volker Hummel (Autor:in), 2010, Die Lehre des freien Willens bei Schopenhauer und Augustinus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188594