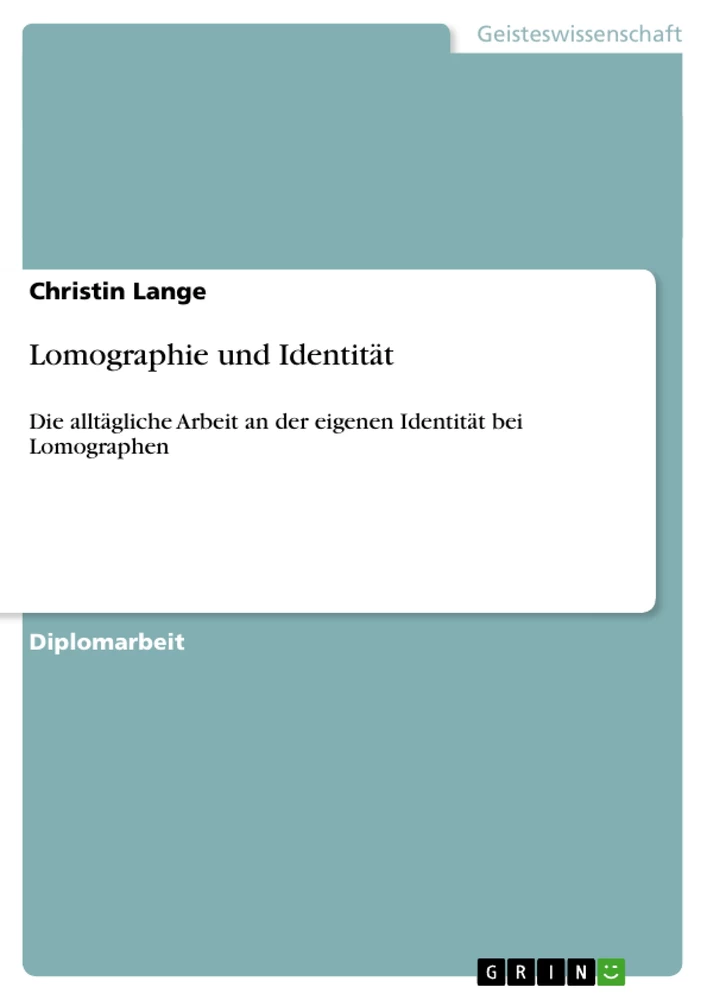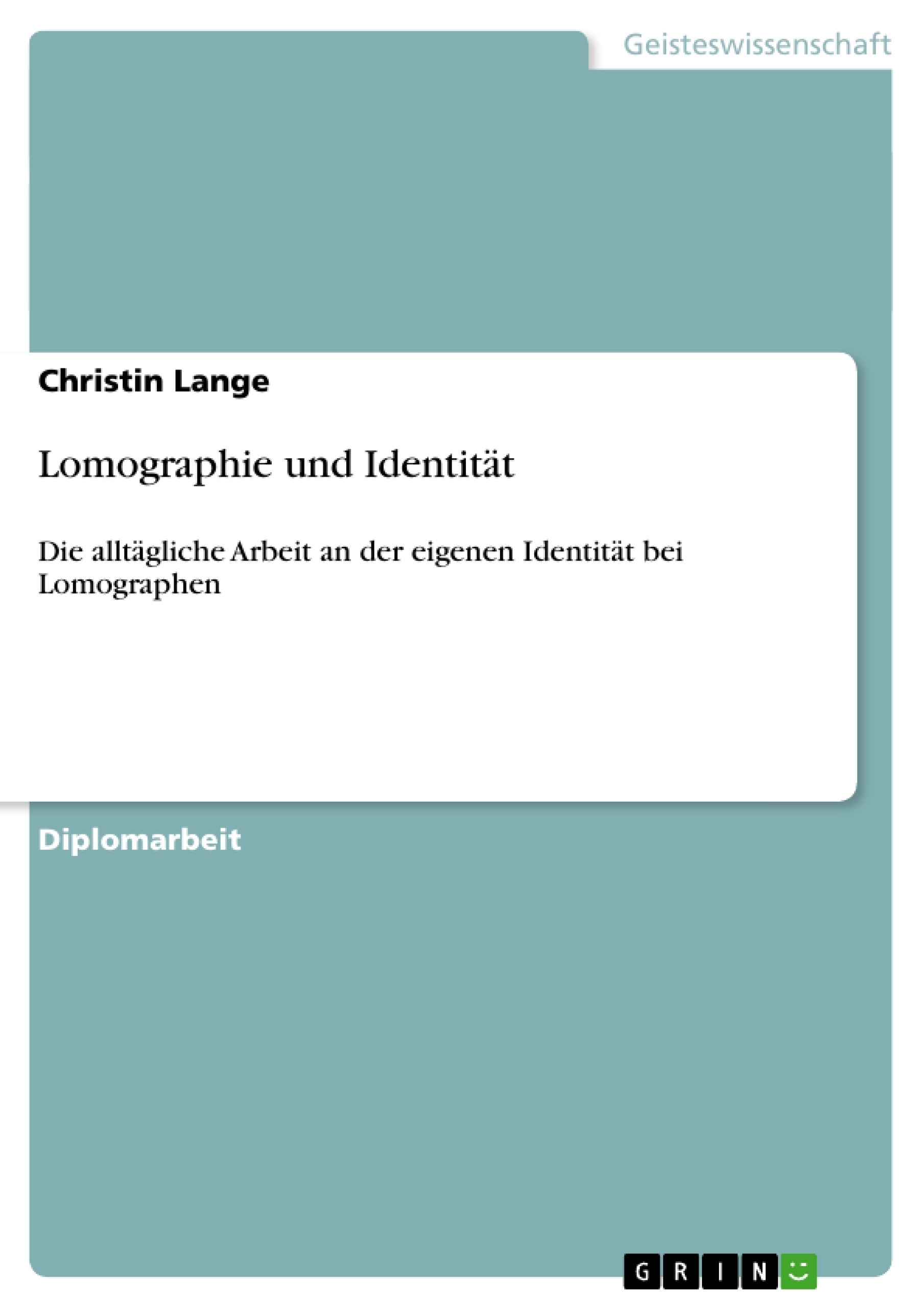Die ganze Welt ist unser Spiegel,
in dem wir uns betrachten müssen,
um den richtigen Blick für die Selbstbeobachtung zu bekommen.
Michel de Montaigne
In der gegenwärtigen sozialen Welt, die durch Veränderungen infolge von Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung geprägt ist, stellen sich die Menschen zunehmend die Frage „Wer bin ich?“. Eben noch im Kleid des „kollektiven Unbewußten“ (Abels 2006: 14) rückt die Frage nach der eigenen Identität dann in den Vordergrund, wenn das Bild von sich selbst mit dem Anderer verglichen wird. Wenn wir uns einem konkreten oder gedachten Anderen gegenüber sehen, blicken wir in einen Spiegel. Dann wird bewußt, was wir noch nicht sind oder nicht sein wollen bzw. nicht sein können. Auch wenn augenscheinlich ist, daß das Bild, das andere von uns haben sich von unserem Selbstbild unterscheidet, beginnen wir uns zu fragen wer wir sind und wer wir sein wollen (vgl. ebd.).
Die vorliegende Arbeit schreibt der (Selbst-)Wahrnehmung mittels photographischer Bilder und einer mit ihr verschränkten, soziokulturellen Lesart eine Schlüsselfunktion zu. Hierbei geht es um die Aneignung von Realitäten und die Selbstbeschreibung von Subjekten (vgl. Kröncke/ Nohr 2005: 7). Diesbezüglich ist zu klären, ob eine spezifische Art zu photographieren die Arbeit an der eigenen Identität beeinflußt. Untersucht wird dies am Beispiel von Lomographen , denen ein ,mechanisch-objektiver‘ Apparat als Mediensystem mit seiner Eigengesetzlichkeit gegenüber steht (vgl. ebd.: 9). Die Lomographie als spontane Schnappschußphotographie wird dabei als Medium zur Selbsterkundung und Inszenierung von Subjektivität betrachtet. Neben den Umgangsweisen und speziellen Praktiken der Lomographie werden auch die ihr eigenen Bildformen als das Produkt einer spezifischen technisch-medialen Konstellation angesehen (vgl. Kröncke/ Nohr 2005: 9). Die Lomographen sind für die Identitätsforschung aus zwei Gründen geeignet: Erstens, stellen sie ein interessantes Beispiel für die Verbindung alter (Photo-)Technik mit neuer Medialität dar, indem sie einerseits die analoge Photographie zelebrieren und diese andererseits in digitaler Form zur Selbstdarstellung nutzen. Zweitens sind die Lomographen eine Erscheinung der spätmodernen Medialität und Kulturalität. Damit stehen die Lomographen stellvertretend für andere gesellschaftliche Gruppen und ihre Mitglieder, die einem spezifischen kulturell engagierten Milieu angehören.......
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Das Patchwork der Identitäten in der Moderne
- Einordnung des Konzeptes „alltäglicher Identitätsarbeit“ in die aktuelle Identitätsdebatte
- Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die alltägliche Identitätsarbeit
- Strukturelle Aspekte des Modells alltäglicher Identitätsarbeit
- Situative Selbstthematisierungen
- Konstruktionen der Identitätsarbeit
- Teilidentitäten
- Identitätsgefühl
- Biographische Kernnarrationen
- Handlungsfähigkeit
- Zusammenfassung des Modells alltäglicher Identitätsarbeit
- Abgrenzung der Untersuchungsgruppe
- Was ist Lomographie? – Entstehungsgeschichte und Philosophie
- Charakterisierung der Lomographen
- Fokus der Untersuchung
- Empirische Untersuchung
- Forschungsfragen
- Methodisches Vorgehen
- Datenerhebung
- Erhebungsinstrument
- Datenauswertung
- Auswahl der Befragten
- Überblick über die Stichprobe
- Methodendiskussion
- Ergebnisse
- Kommentar zu den Fallportraits
- Beispiel Fallportrait
- Vergleichende Fallanalyse
- Situative Selbstthematisierungen der Lomographen
- Die Bündelung der Selbstthematisierungen in lomographischen Situationen unter verschiedenen Identitätsperspektiven
- Die Ebene der Teilidentitäten
- Teilidentitätsentwürfe und Teilidentitätsprojekte
- Teilidentitätsstandards
- Die Metaidentitäts-Ebene
- Dominierende Teilidentität
- Biographische Kernnarrationen
- Identitätsgefühl
- Handlungsfähigkeit
- Zusammenfassung der vergleichenden Fallanalyse
- Lomographen-Typen
- Diskussion
- Diskussion der Ergebnisse zum Thema Identität
- Lomographisch geprägte Identitätskonstruktionen
- Typen
- Diskussion zum Thema Medialität und Alltag
- Diskussion der Ergebnisse zum Thema Identität
- Fazit und Ausblick
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Konstruktion von Identität im Kontext der Lomographie, einer Subkultur, die sich durch den Einsatz von analogen Sofortbildkameras auszeichnet. Die Arbeit fokussiert auf die Identitätsarbeit von Lomographen in Deutschland und untersucht, wie die Lomographie in ihre alltäglichen Identitätskonstruktionen eingebunden wird.
- Das Konzept der „alltäglichen Identitätsarbeit“ und seine Relevanz in der modernen Gesellschaft
- Der Einfluss der Lomographie auf die alltägliche Identitätsarbeit von Lomographen
- Die unterschiedlichen Ebenen der Identitätskonstruktion, insbesondere die situative Ebene, die Teilidentitätsebene und die Metaidentitätsebene
- Die Rolle der Lomographie in der Entwicklung von Teilidentitäten und Biographischen Kernnarrationen
- Die Handlungsfähigkeit von Lomographen im Kontext ihrer lomo-geprägten Identitätskonstruktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der alltäglichen Identitätsarbeit und ihrer Bedeutung in der modernen Gesellschaft. Dabei wird das Patchwork-Identitätsmodell von Heiner Keupp als theoretischer Rahmen für die Analyse der Identitätskonstruktionen von Lomographen genutzt. Es werden die strukturellen Aspekte des Modells, wie situative Selbstthematisierungen, Teilidentitäten, Identitätsgefühl und biographische Kernnarrationen, sowie die Handlungsfähigkeit im Kontext der Identitätsarbeit erläutert.
Im Anschluss daran erfolgt die Abgrenzung der Untersuchungsgruppe, indem die Lomographie und ihre Entstehungsgeschichte sowie die Charakterisierung der Lomographen als Subkultur näher beleuchtet werden. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Frage, ob sich bei Lomographen ähnliche, von der Lomographie geprägte Identitätskonstruktionen feststellen lassen.
Im Kapitel zur empirischen Untersuchung werden das methodische Vorgehen, die Datenerhebung und die Auswertung der gewonnenen Daten detailliert dargestellt. Die Auswahl der Befragten und der Überblick über die Stichprobe werden ebenfalls erläutert. Schließlich werden die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, die sich auf die Fallportraits der Befragten konzentrieren.
Die Ergebnisse der vergleichenden Fallanalyse werden in den folgenden Abschnitten präsentiert. Dabei werden die situativen Selbstthematisierungen der Lomographen, die Bündelung der Selbstthematisierungen in lomographischen Situationen unter verschiedenen Identitätsperspektiven, die Ebene der Teilidentitäten, die Metaidentitätsebene und die Handlungsfähigkeit analysiert.
Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert, wobei die Bedeutung der Lomographie für die Identitätskonstruktionen der Befragten und die Rolle der Medialität im Alltag im Vordergrund stehen. Die Arbeit endet mit einem Fazit und einem Ausblick auf weitere Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Lomographie, Identität, alltägliche Identitätsarbeit, Patchwork-Identität, Subkultur, Teilidentität, Metaidentität, Biographische Kernnarrationen, Handlungsfähigkeit, qualitative Forschung, Fallstudien, Interviewforschung, Deutschland.
- Citation du texte
- Christin Lange (Auteur), 2010, Lomographie und Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188523