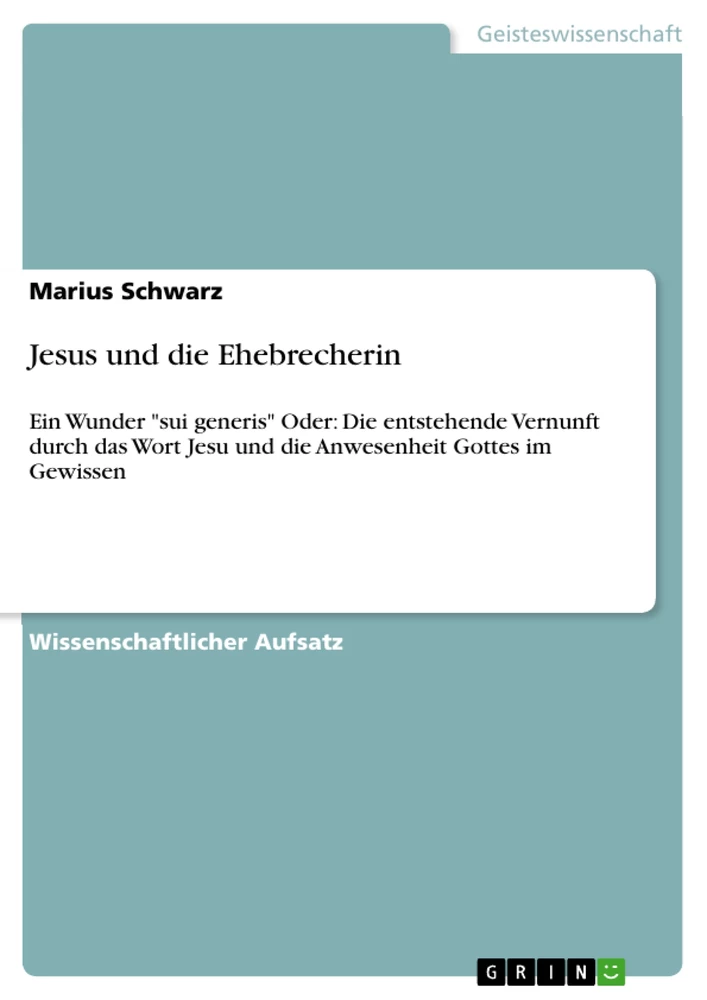Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, welche ein eindrücklicheres, tiefgründigeres und nachhaltigeres Bild von Jesus liefert als jenes, welches uns im Gleichnis von der Ehebrecherin begegnet.
Was ist es, was uns an diesem Gleichnis so berührt? Ist es lediglich die Vergebung, welche in diesem Gleichnis zum Ausdruck kommt? Ist es die Güte Jesu, die in diesen Augenblicken jeden Menschen, welcher sich seinen eigenen Verfehlungen bewusst wird, wie ein wärmendes Pflaster auf der manchmal ach so kalten Seele vorkommt? Oder ist es lediglich die subtile, ja fast schon logische zweite Chance im Leben eines Menschen, welche jedem Individuum, alleine schon aufgrund seines persönlichen Vorrechtes auf die Möglichkeit seiner Selbstentfaltung zukommen sollte? Richten wir unser Augenmerk aber nicht nur auf die Ehebrecherin. Auch andere Beteiligte stehen im Fokus des Evangelisten.
Inhaltsverzeichnis
- Das Gleichnis im Wortlaut der Einheitsübersetzung nach Johannes 7, 53 - 8, 11
- Hinführung zur Thematik und metaphysische Vorüberlegungen
- Die Gelassenheit Jesu. Jenseits von Rechtspositivismus und Rechtsnaturalismus
- Die sich entfernenden Ältesten - Ein Wunder „sui generis“
- Das Gewissen als Ort des Angerufenseins von Seiten Gottes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gleichnis der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium. Ziel ist es, über die offensichtliche Botschaft der Vergebung hinaus, die tieferen theologischen und philosophischen Implikationen dieses Gleichnisses zu ergründen. Die Analyse konzentriert sich auf die Bedeutung der Handlung Jesu im Kontext seiner Verkündigung und die Rolle des Gewissens.
- Jesu Gelassenheit und sein Umgang mit religiöser Gesetzestreue
- Die Bedeutung des Gewissens als Ort der Begegnung mit Gott
- Die Interpretation des Gleichnisses im Kontext der johanneischen Theologie
- Der Vergleich mit anderen Darstellungen Jesu im Neuen Testament
- Die zeitlose Relevanz des Gleichnisses für heutige ethische Fragestellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Gleichnis im Wortlaut der Einheitsübersetzung nach Johannes 7, 53 - 8, 11: Dieses Kapitel präsentiert den Text des Gleichnisses der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium in der Einheitsübersetzung. Es bildet die Grundlage für die anschließende theologische und philosophische Auseinandersetzung mit dem Text und dient als Ausgangspunkt für die Interpretation des Gleichnisses.
Hinführung zur Thematik und metaphysische Vorüberlegungen: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt grundlegende metaphysische Überlegungen an. Es erörtert die besondere Wirkung des Gleichnisses und fragt nach dem, was uns daran so berührt: Ist es die Vergebung, die Güte Jesu oder die implizite zweite Chance? Die Arbeit stellt die Frage nach dem besonderen Stellenwert dieses Gleichnisses im Kontext der Verkündigung Jesu und betont die zeitlose Relevanz der Geschichte, die über den historischen und kulturellen Kontext hinausgeht. Der Fokus liegt auf der inhaltlichen Bedeutung und dem „Sitz im Leben“ des Gleichnisses, mit dem Ziel, die Intention des Evangelisten Johannes zu verstehen.
Die Gelassenheit Jesu. Jenseits von Rechtspositivismus und Rechtsnaturalismus: Hier wird die einzigartige Gelassenheit Jesu im Umgang mit der Situation analysiert. Es wird untersucht, wie Jesus geschickt die Falle seiner Gegner umgeht und gleichzeitig alle Anwesenden mit der Frage nach ihrer eigenen Schuld konfrontiert. Der Text hinterfragt den Konflikt zwischen Rechtspositivismus und Rechtsnaturalismus und stellt Jesu Handlungsweise als einen Weg jenseits dieses Konflikts dar. Die einzigartige Reaktion Jesu wird als ein zentraler Aspekt des Gleichnisses hervorgehoben.
Die sich entfernenden Ältesten - Ein Wunder „sui generis“: In diesem Kapitel wird die Reaktion der Ältesten auf Jesu Frage analysiert. Ihr Weggang wird als ein "Wunder sui generis" interpretiert, das die Macht des Gewissens und die Wirkung von Jesu Worten verdeutlicht. Die Analyse konzentriert sich auf den Prozess der Selbstkonfrontation, der durch Jesu Frage ausgelöst wird und zur Selbstverurteilung der Ankläger führt. Die Bedeutung des Weggangs der Ältesten für die Botschaft des Gleichnisses wird eingehend untersucht.
Das Gewissen als Ort des Angerufenseins von Seiten Gottes: Das Kapitel fokussiert sich auf die Rolle des Gewissens im Gleichnis. Es wird argumentiert, dass das Gewissen der Ort ist, an dem der Mensch von Gott angerufen wird und seine eigene Schuld erkennt. Die Begegnung mit dem Gewissen wird als der entscheidende Schritt hin zur Vergebung und zur Möglichkeit der Selbstveränderung dargestellt. Die Bedeutung des Gewissens als Ort der Begegnung mit Gott wird im Kontext des gesamten Gleichnisses beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jesus, Ehebrecherin, Johannesevangelium, Gleichnis, Vergebung, Gewissen, Rechtspositivismus, Rechtsnaturalismus, Selbstkonfrontation, Gott, Liebe, Verurteilung, zweite Chance.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Johannesevangelium: Das Gleichnis von der Ehebrecherin
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium (Johannes 7,53-8,11). Sie geht über die offensichtliche Botschaft der Vergebung hinaus und untersucht die tieferen theologischen und philosophischen Implikationen. Die Analyse konzentriert sich auf Jesu Handeln im Kontext seiner Verkündigung und die Rolle des Gewissens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Jesu Gelassenheit und Umgang mit religiöser Gesetzestreue, die Bedeutung des Gewissens als Ort der Begegnung mit Gott, die Interpretation des Gleichnisses im Kontext der johanneischen Theologie, der Vergleich mit anderen neutestamentlichen Darstellungen Jesu und die zeitlose Relevanz des Gleichnisses für heutige ethische Fragestellungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Das Gleichnis im Wortlaut der Einheitsübersetzung; 2. Hinführung zur Thematik und metaphysische Vorüberlegungen; 3. Die Gelassenheit Jesu. Jenseits von Rechtspositivismus und Rechtsnaturalismus; 4. Die sich entfernenden Ältesten - Ein Wunder „sui generis“; 5. Das Gewissen als Ort des Angerufenseins von Seiten Gottes.
Was ist die Kernaussage des ersten Kapitels?
Das erste Kapitel präsentiert den Gleichnistext in der Einheitsübersetzung und bildet die Grundlage für die folgende Interpretation.
Worauf konzentriert sich das zweite Kapitel?
Das zweite Kapitel führt in die Thematik ein, stellt metaphysische Überlegungen an und untersucht die besondere Wirkung und Relevanz des Gleichnisses, sowie die Intention des Evangelisten Johannes.
Was wird im dritten Kapitel analysiert?
Das dritte Kapitel analysiert Jesu Gelassenheit im Umgang mit der Situation und untersucht, wie er die Falle seiner Gegner umgeht und gleichzeitig alle Anwesenden mit ihrer eigenen Schuld konfrontiert. Es hinterfragt den Konflikt zwischen Rechtspositivismus und Rechtsnaturalismus.
Worum geht es im vierten Kapitel?
Das vierte Kapitel analysiert die Reaktion der Ältesten als ein "Wunder sui generis", das die Macht des Gewissens und die Wirkung von Jesu Worten verdeutlicht. Der Fokus liegt auf der Selbstkonfrontation und Selbstverurteilung der Ankläger.
Was ist der Schwerpunkt des fünften Kapitels?
Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Rolle des Gewissens als Ort, an dem der Mensch von Gott angerufen wird und seine Schuld erkennt. Die Begegnung mit dem Gewissen wird als entscheidender Schritt zur Vergebung und Selbstveränderung dargestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jesus, Ehebrecherin, Johannesevangelium, Gleichnis, Vergebung, Gewissen, Rechtspositivismus, Rechtsnaturalismus, Selbstkonfrontation, Gott, Liebe, Verurteilung, zweite Chance.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse theologischer und philosophischer Themen im Kontext des Johannesevangeliums.
- Quote paper
- Dipl. Theol. Marius Schwarz (Author), 2012, Jesus und die Ehebrecherin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188460