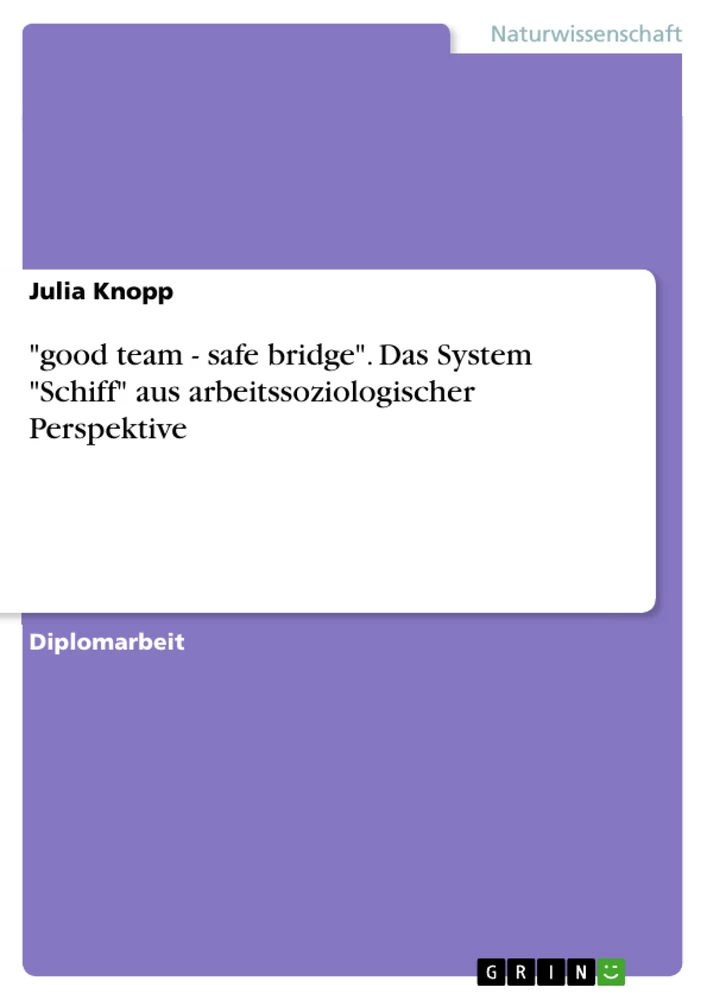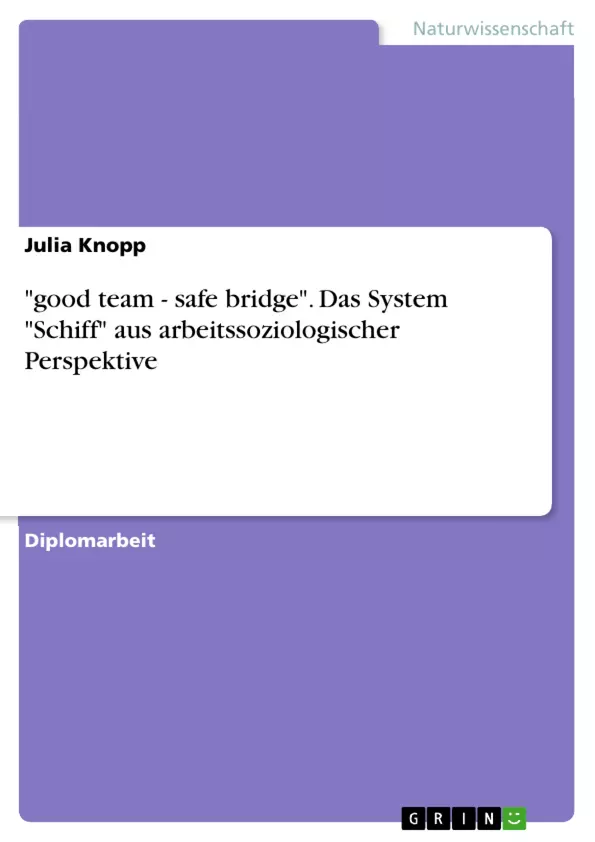Die Vielfalt der Grundvoraussetzungen einer zur See fahrenden Führungskraft wird aufgezählt
und in den Zusammenhang der an Bord befindlichen Praxis gebracht. Der nautische
Offizier wird als Planer und Gestalter des Bordlebens und des Arbeitssystems „Schiff“
verstanden, dazu werden seine Werkzeuge betrachtet hinsichtlich der Auswirkungen auf
Leistung und Gesundheit seiner Untergebenen.
Alle Maßnahmen seitens der Gesetzgebung zielen letztlich auf die Gewährleistung der
Schiffsicherheit. Diese Maxime findet sich auch in der Umsetzung der „Guten Seemannschaft“
wieder. Neben der „Guten Seemannschaft“ existieren eine Vielzahl von Strategien
und Abläufen, die unterschiedliche Auswirkungen auf den Bordbetrieb haben, als Beispiel
wird das International Safety Management aufgeführt.
Auf welche Weise die nautischen Führungskräfte letztlich selektiert und positioniert werden,
wird in Frage gestellt. Es lassen sich Selektionspunkte vor, während und nach der
Ausbildung ausfindig machen. Eine bedeutsame Rolle spielen hierbei die Crewing Abteilungen
der Reedereien. Dreißig deutsche Reedereien werden mit einem Befragungsbogen
zum Thema „Sozialkompetenz und Schiffsicherheit“ befragt.
In der Befragung zu sozialen Kompetenzen und Schiffsicherheit ist die vorherrschende
Meinung eindeutig. „Soft skills“ haben einen hohen Stellenwert in der Ausübung des Berufes
eines Schiffoffiziers. Dennoch werden diese in Bewerbungsgesprächen bei den Reedereien
nicht standardisiert evaluiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die allgemeinen Grundlagen der Schiffsführung
- 3 Anforderung an nautisches Führungspersonal
- 3.1 Gesundheitliche Anforderungen
- 3.1.1 Hören und Sehen
- 3.1.2 Körperliche Voraussetzungen
- 3.2 STCW und „soft skills“
- 3.1 Gesundheitliche Anforderungen
- 4 An Bord: Einflussfaktoren und soziale Umwelt
- 4.1 Der Bordalltag und seine Probleme
- 4.1.1 Ein Beispiel für „unüberlegtes Handeln“ an Bord eines Mehrzweckfrachters in indonesischer Küstennähe:
- 4.1.2 Positive Erlebnisse im Umgang mit nautischen Offizieren:
- 4.2 Die Landseite- Evaluierung sozialer Kompetenzen
- 4.1 Der Bordalltag und seine Probleme
- 5 Exkurs: Rechtliche Konsequenzen eines Seeschiffunfalles nach dt. Gesetzgebung
- 6 Der nautische Ausbildungssektor und soziale Kompetenzen
- 6.1 Was ist soziale Kompetenz, welche brauchen wir?
- 6.2 Welche Kompetenzen sind gefragt?
- 7 Arbeitssoziologische Betrachtung
- 7.1 Studien und Erkenntnisse
- 7.2 Stress am Arbeitsplatz
- 7.3 DIN EN ISO 10075, Grundlagen aus der Arbeitspsychologie
- 7.4 Stressverursachender Faktor: Der Chef und seine Werkzeuge
- 7.4.1 Das Hauptwerkzeug der Zusammenarbeit: Kommunikation
- 7.4.2 Der Führungsstil
- 7.5 Grundlagen der Menschenführung- der innere Dialog
- 8 Schlüsselaspekt „Teamfähigkeit“
- 9 Aus der Sicht der Personalabteilungen und der erfahrenen Seeleuten
- 9.1 Befragung zum Thema
- 9.1.1 Samplestruktur
- 9.1.2 Erstellung des Befragungsbogens
- 9.2 Ergebnis der Befragung „Frage 2“
- 9.3 Ergebnis der Befragung „Frage 1“
- 9.4 Vergleichende Analyse
- 9.1 Befragung zum Thema
- 10 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Arbeitssystem „Schiff“ unter arbeitssoziologischen Aspekten, insbesondere die Rolle sozialer Kompetenzen und Führungsstile in Bezug auf Schiffsicherheit. Sie untersucht, wie sich eine Selektion von nautischem Führungspersonal anhand sozialer und Führungskompetenzen rechtfertigen lässt. Die physischen und psychischen Anforderungen internationaler Richtlinien werden betrachtet.
- Der Einfluss von „human factors“ auf die Schiffsicherheit
- Der Stellenwert sozialer Kompetenzen von nautischem Führungspersonal
- Die Selektion und Evaluierung von sozialen Kompetenzen in der nautischen Ausbildung und bei Reedereien
- Die Auswirkungen von Führungsstil und Kommunikation auf das Arbeitsklima und die Stressbelastung an Bord
- Die Bedeutung von Teamfähigkeit für die Schiffsicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung: Die Arbeit stellt das Thema der Schiffsicherheit unter arbeitssoziologischen Gesichtspunkten vor. Sie erläutert die Bedeutung von „human factors“ und die Forschungsfrage: Welchen Stellenwert haben soziale Kompetenzen von nautischem Führungspersonal im Schiffsbetrieb?
- Kapitel 2: Die allgemeinen Grundlagen der Schiffsführung: Dieses Kapitel behandelt die Organisation des Brückenteams und die Bedeutung von Gesetzen und Richtlinien wie der Seeschifffahrtsstraßenordnung (SeeSchStrO) und der Kollisionsverhütungsregeln (CollReg) für den sicheren Schiffsbetrieb. Es wird gezeigt, dass die Einhaltung dieser Regeln eine Vielzahl von Kompetenzen des nautischen Führungspersonals erfordert.
- Kapitel 3: Anforderung an nautisches Führungspersonal: Die Anforderungen an nautisches Führungspersonal, vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung der Schiffsicherheit, werden im Detail dargestellt. Dazu gehören die gesundheitlichen Anforderungen an Hören und Sehen sowie die körperlichen Voraussetzungen, die im STCW Code festgehalten sind.
- Kapitel 4: An Bord: Einflussfaktoren und soziale Umwelt: Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die das Leben und Arbeiten an Bord beeinflussen, wie Zeitdruck, räumliche Enge, Schlafmangel und persönliche Konflikte. Es wird ein Beispiel für „unüberlegtes Handeln“ („human error“) an Bord eines Mehrzweckfrachters in indonesischer Küstennähe vorgestellt und positive Erlebnisse mit nautischen Offizieren gegenübergestellt.
- Kapitel 5: Exkurs: Rechtliche Konsequenzen eines Seeschiffunfalles nach dt. Gesetzgebung: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Konsequenzen eines Seeschiffunfalles nach deutscher Gesetzgebung, insbesondere das Sicherheitsuntersuchungsgesetz (SUG) und die Rolle der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU). Es wird gezeigt, dass die Untersuchung von Unfällen nicht nur die technischen Aspekte, sondern auch die Personen und ihre geistigen und psychischen Zustände umfasst.
- Kapitel 6: Der nautische Ausbildungssektor und soziale Kompetenzen: Hier wird die Bedeutung von sozialen Kompetenzen in der nautischen Ausbildung und im Berufsleben erörtert. Es werden verschiedene Definitionen von Sozialkompetenz und die wichtigsten Kompetenzen, die im nautischen Kontext gefragt sind, vorgestellt. Das STCW 2010 und verschiedene Publikationen, die sich mit der Thematik befassen, werden beleuchtet.
- Kapitel 7: Arbeitssoziologische Betrachtung: Dieses Kapitel beleuchtet die arbeitssoziologischen Aspekte der Schiffsführung. Es wird der Zusammenhang zwischen Stress am Arbeitsplatz und den Faktoren, die von der Führungskraft beeinflusst werden, beleuchtet, wie z.B. Kommunikation, Führungsstil und Arbeitsorganisation. Es werden die Grundlagen aus der Arbeitspsychologie, insbesondere die DIN EN ISO 10075, sowie der „innere Dialog“ der Führungskraft im Hinblick auf die Gestaltung des Arbeitsklimas und die Motivation der Crew vorgestellt.
- Kapitel 8: Schlüsselaspekt „Teamfähigkeit“: Die Teamfähigkeit wird als Schlüsselfaktor für die Schiffsicherheit betrachtet. Die verschiedenen Aspekte der Teamfähigkeit im Kontext des Bordgeschehens werden erläutert und die Bedeutung von Vertrauen und Authentizität für die Teambildung hervorgehoben.
- Kapitel 9: Aus der Sicht der Personalabteilungen und der erfahrenen Seeleuten: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung von Personalabteilungen von Reedereien vorgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass soziale Kompetenzen bei der Einstellung und Bewertung von nautischem Führungspersonal einen hohen Stellenwert haben, aber die Evaluierung dieser Kompetenzen häufig nicht systematisch und stringent erfolgt.
Schlüsselwörter
Schiffsicherheit, human factors, soziale Kompetenzen, Führungsstil, Kommunikation, Teamarbeit, Stress, Arbeitssoziologie, nautische Ausbildung, STCW, ISM, Reederei, Crewing, Schiffsbesetzung, Arbeitsergebnis, Bordklima, innerer Dialog, Teamfähigkeit, Personalabteilung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen "Soft Skills" in der Schiffsführung?
Soft Skills wie Kommunikation und Teamfähigkeit haben einen hohen Stellenwert für die Schiffsicherheit, werden jedoch bei der Einstellung oft nicht standardisiert geprüft.
Was sind die größten Stressfaktoren an Bord eines Schiffes?
Zu den Belastungen zählen Zeitdruck, räumliche Enge, Schlafmangel sowie Konflikte innerhalb der Crew und der Führungsstil der Offiziere.
Was bedeutet "Gute Seemannschaft" im Kontext der Sicherheit?
Es ist eine Maxime, die alle Maßnahmen umfasst, die über die reine Gesetzgebung hinausgehen, um die Sicherheit des Schiffes, der Besatzung und der Umwelt zu gewährleisten.
Wie wird nautisches Führungspersonal selektiert?
Die Selektion erfolgt vor, während und nach der Ausbildung, wobei die Crewing-Abteilungen der Reedereien eine entscheidende Rolle spielen.
Was untersucht die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU)?
Die BSU untersucht Seeunfälle nicht nur auf technischer Ebene, sondern analysiert auch menschliche Faktoren sowie die geistigen und psychischen Zustände der Beteiligten.
- Arbeit zitieren
- Julia Knopp (Autor:in), 2012, "good team - safe bridge". Das System "Schiff" aus arbeitssoziologischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188097