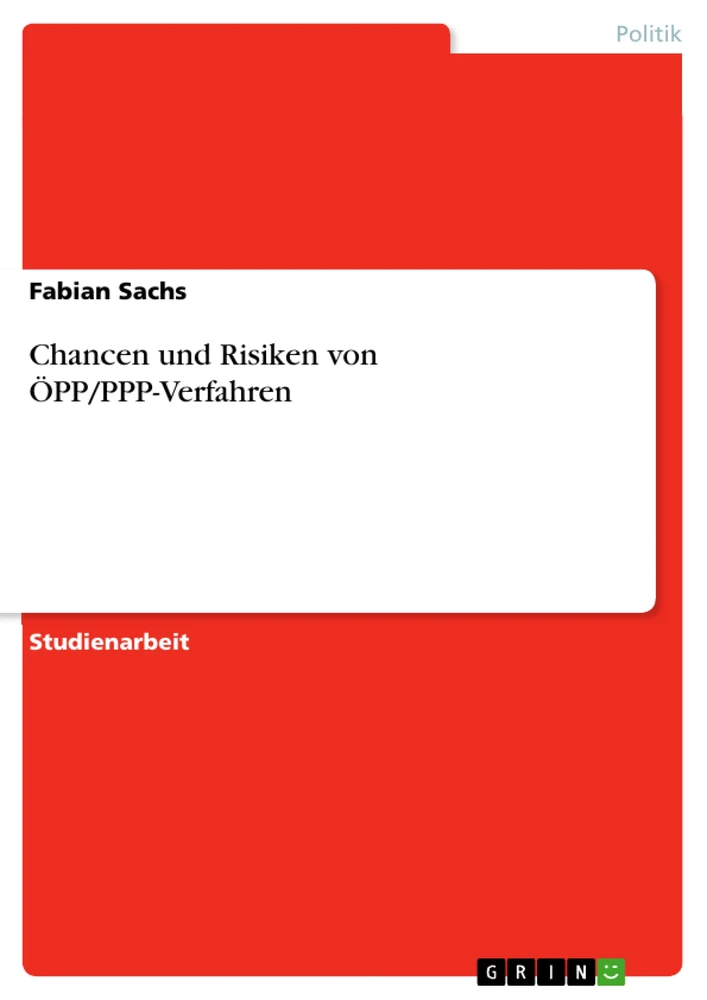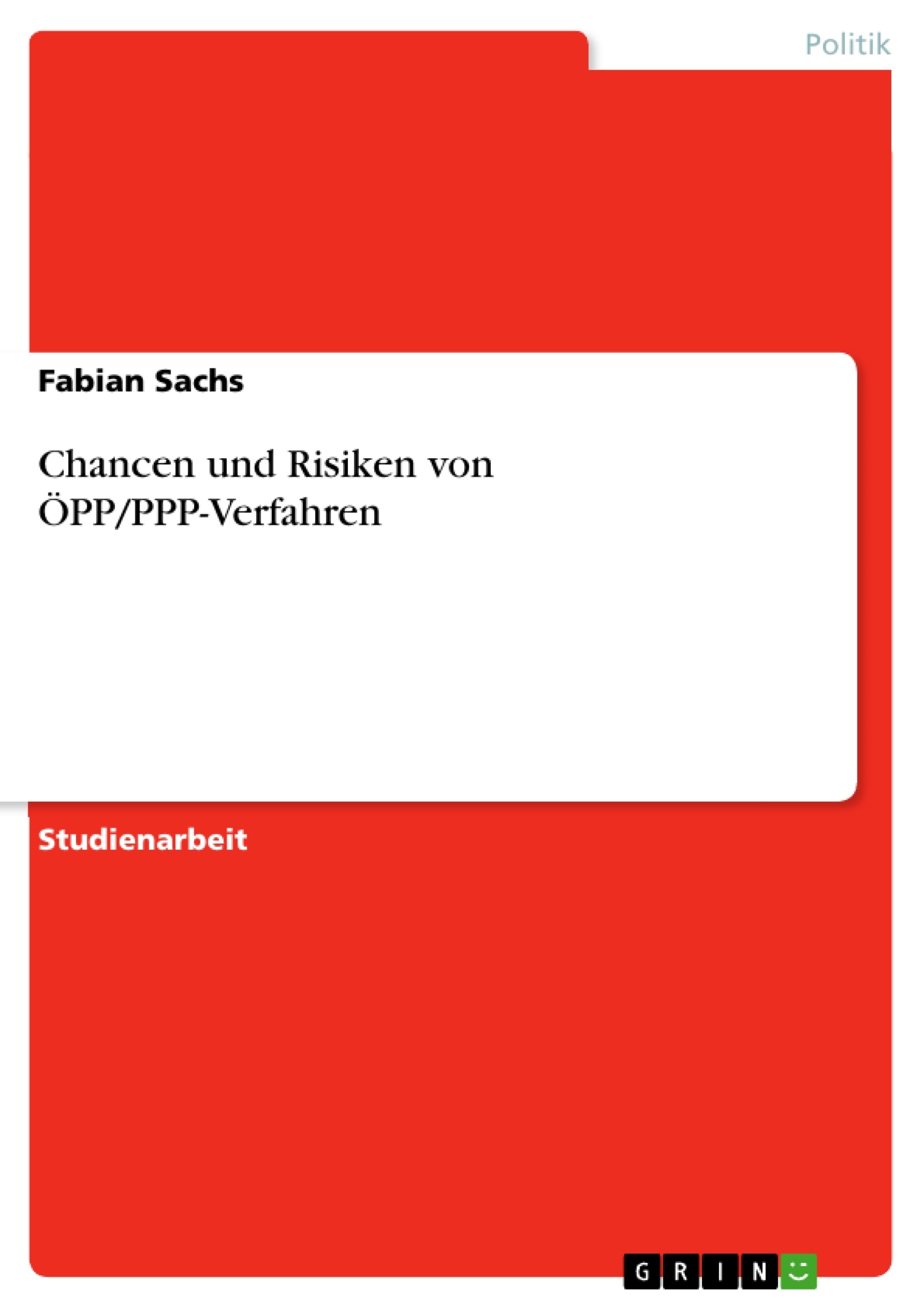Das Konzept von Public Privat Partnership (PPP) entwickelt sich in unzähligen Ländern zu einem effektiven Werkzeug zur Bereitstellung von öffentlichen Leistungen. Dabei ist allerdings eine klare Definition des Public Private Partnership (PPP) in der Praxis in Bezug auf Outsourcing-Projekte schwer möglich. Dies betrifft insbesondere Steuerungs- und Preismodelle oder aber auch den Personaltransfer. Der Anstieg von PPP-Projekten wird in der Bundesrepublik Deutschland durch den immer stärker ausgeprägten demographischen Wandel, der Haushaltslage und der Reorganisation von Prozessen maßgeblich beeinflusst und fördert den Fortschritt des PPP‘s in Deutschland. In den alten Bundesländern nimmt PPP einen höheren Stellenwert ein, als bei den neuen Bundesländern, welcher bei 10,5% liegt. Das Deutsche Institut für Urbanistik (DIfU) hat den Bedarf kommunaler Investitionen der nächsten zehn Jahre berechnet. Dabei liegt der Investitionsbedarf der alten Bundesländer bei 475 Milliarden Euro und in den neuen Bundesländern doppelt so hoch wie bei den alten Bundesländern. Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf, welcher Chancen und Risiken beinhaltet. Die folgende Arbeit soll einen Überblick der PPP Verfahren sowie Chancen und Risiken aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren
- I. Begriffsbestimmung
- 1. Entstehung des PPP im angelsächsischen Raum
- 2. Entstehung des PPP in Deutschland
- 3. Abgrenzung zum Sponsoring
- II. Anwendungsgebiete
- 1. Kooperationsmanagement
- 1.1 Kennzahlenbasierende Steuerungssysteme
- 1.2 Monitoring-Team
- 1.3 Kommunikationsstruktur
- 1.4 Organisations- und Mitarbeiterebene
- 2. ÖPP-Modelle
- 1.1 Preismodelle
- 1.2 Vertragsmodelle
- 1.2.1 Erwerbermodell
- a) Vertraglicher Leistungsumfang
- aa) Planungsphase
- bb) Herstellungsphase
- cc) Finanzierungsphase
- dd) Betriebsphase
- ee) Verwertungsphase
- c) Risikoverteilung
- aa) Herstellungs- und Planungsphase
- cc) Finanzierungsphase
- dd) Betriebsphase
- ee) Verwertungsphase
- ff) Vertragslaufzeit
- d) Anwendbares Recht
- aa) Planungs- und Herstellungsphase
- bb) Betriebsphase
- cc) Finanzierungsphase
- dd) Verwertungsphase
- 1.2.2 Gesellschaftsmodell
- a) Kapitalgesellschaften
- aa) GmbH
- bb) AG
- b) Personengesellschaften
- aa) GbR
- bb) OHG
- cc) KG
- c) Anwendung auf öffentlich Private Partnerschaftsprojekte
- 1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen bei kommunalen Unternehmen
- III. Negativbeispiele und Gefahren von ÖPP/PPP-Verfahren
- 1. „Sale-and-lease-back“-Verträge
- 2. Die Müllverbrennungsanlage der Stadt Köln
- 3. Die Privatisierung der Bundesdruckerei
- C. Fazit
- Begriffsbestimmung und Entstehung von ÖPP/PPP-Verfahren
- Anwendungsgebiete und verschiedene ÖPP/PPP-Modelle
- Risikoverteilung und rechtliche Rahmenbedingungen
- Analyse von Negativbeispielen und Gefahren
- Bewertung der Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Chancen und Risiken von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP/PPP)-Verfahren. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser Verfahren zu entwickeln und sowohl positive als auch negative Aspekte aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einführung: Dieses Kapitel dient als Einleitung in die Thematik der Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP/PPP). Es legt den Fokus auf die Bedeutung und Relevanz des Themas im Kontext von Infrastrukturprojekten und öffentlichen Dienstleistungen. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben und die zentrale Fragestellung definiert, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden soll.
B. Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und befasst sich eingehend mit den Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren. Es beginnt mit einer klaren Begriffsbestimmung und historischer Einordnung von PPPs im angelsächsischen Raum und in Deutschland, differenziert diese von Sponsoring und beleuchtet verschiedene Anwendungsgebiete und Kooperationsmodelle. Im Detail werden unterschiedliche Vertrags- und Preismodelle analysiert, die jeweils mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden sind. Die Kapitel untersuchen die Risikoverteilung in den verschiedenen Phasen eines ÖPP/PPP-Projekts (Planung, Herstellung, Finanzierung, Betrieb, Verwertung) und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen. Abschließend werden ausgewählte Negativbeispiele detailliert untersucht, um die potenziellen Gefahren von ÖPP/PPP-Verfahren aufzuzeigen. Die Analyse fokussiert auf die Fallstudien, um die komplexen Zusammenhänge zu verdeutlichen und die Ergebnisse zu belegen.
Schlüsselwörter
Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), PPP, Chancen, Risiken, Risikoverteilung, Vertragsmodelle, Preismodelle, Kooperationsmanagement, Rechtliche Rahmenbedingungen, Negativbeispiele, Kommunale Unternehmen, Sale-and-lease-back.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Chancen und Risiken von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP/PPP)-Verfahren"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert umfassend die Chancen und Risiken von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP/PPP)-Verfahren. Sie beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Betrachtung der Chancen und Risiken, verschiedene Anwendungsgebiete und Modelle, die Risikoverteilung, rechtliche Rahmenbedingungen und eine Analyse von Negativbeispielen. Ziel ist es, ein vollständiges Verständnis von ÖPP/PPP-Verfahren zu vermitteln.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Begriffsbestimmung und Entstehung von ÖPP/PPP-Verfahren (inklusive Vergleich mit Sponsoring), Anwendungsgebiete und verschiedene ÖPP/PPP-Modelle (mit detaillierter Betrachtung von Vertrags- und Preismodellen), Risikoverteilung in verschiedenen Projektphasen (Planung, Herstellung, Finanzierung, Betrieb, Verwertung), rechtliche Rahmenbedingungen, Analyse von Negativbeispielen (z.B. "Sale-and-lease-back"-Verträge, Müllverbrennungsanlage Köln, Privatisierung der Bundesdruckerei), und eine abschließende Bewertung der Chancen und Risiken.
Welche Arten von ÖPP/PPP-Modellen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene ÖPP-Modelle, fokussiert auf Vertrags- und Preismodelle. Im Detail werden das Erwerbermodell und das Gesellschaftsmodell (mit Unterteilung in Kapital- und Personengesellschaften) analysiert, inklusive Betrachtung der jeweiligen Risikoverteilung und des anwendbaren Rechts in allen Projektphasen.
Welche Negativbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Negativbeispiele wie "Sale-and-lease-back"-Verträge, die Müllverbrennungsanlage der Stadt Köln und die Privatisierung der Bundesdruckerei, um die potenziellen Gefahren von ÖPP/PPP-Verfahren aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), PPP, Chancen, Risiken, Risikoverteilung, Vertragsmodelle, Preismodelle, Kooperationsmanagement, Rechtliche Rahmenbedingungen, Negativbeispiele, Kommunale Unternehmen, Sale-and-lease-back.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Eine Einführung, einen Hauptteil mit detaillierter Analyse der Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren, und ein Fazit. Der Hauptteil umfasst die Begriffsbestimmung, Anwendungsgebiete, Modelle, Risikoverteilung, rechtliche Aspekte und die Analyse von Negativbeispielen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Navigation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis von ÖPP/PPP-Verfahren zu schaffen und sowohl die Chancen als auch die Risiken dieser Verfahren aufzuzeigen. Die Arbeit soll dazu beitragen, die Komplexität von ÖPP/PPP-Projekten besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der Planung, Umsetzung oder Bewertung von öffentlich-privaten Partnerschaften befassen, einschließlich Studierender, Wissenschaftler, Praktiker im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft sowie politischen Entscheidungsträgern.
- Citar trabajo
- Fabian Sachs (Autor), 2012, Chancen und Risiken von ÖPP/PPP-Verfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187475