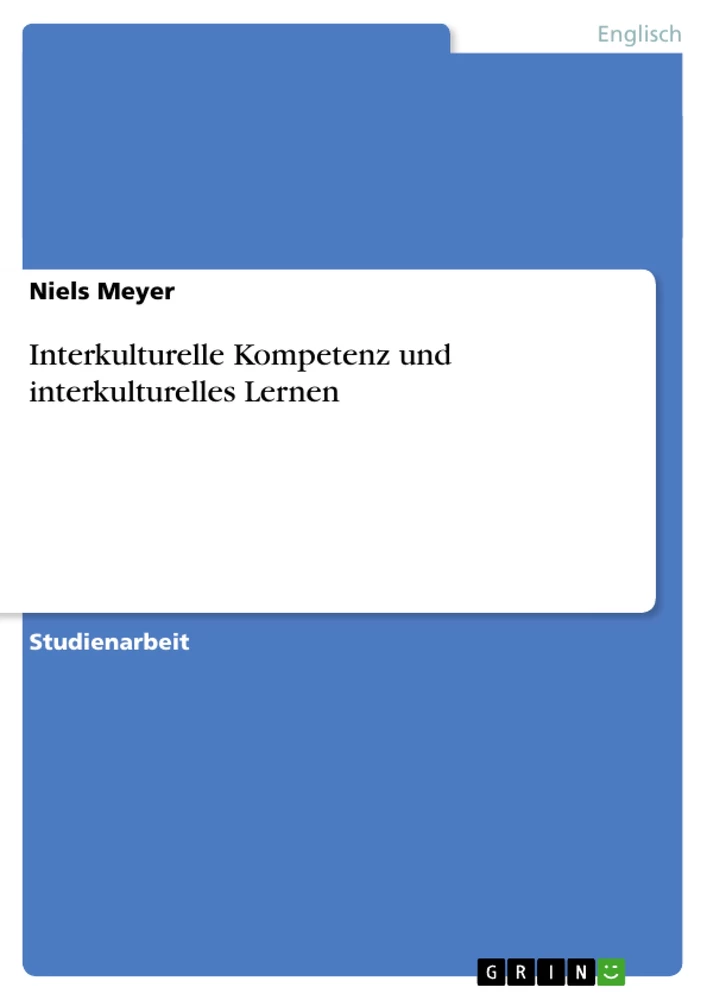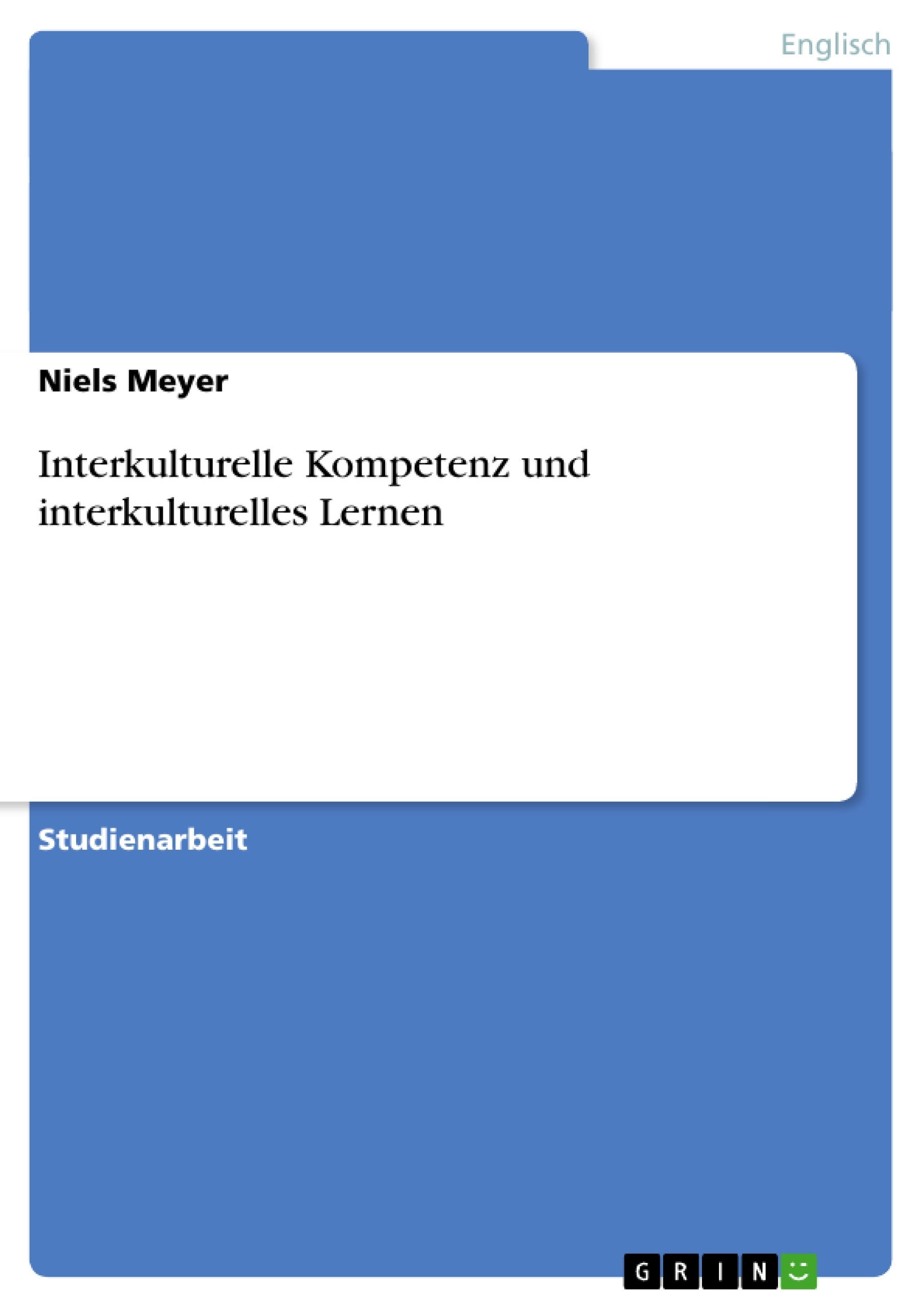In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Ausgangssituation für die Bildungspolitik in der
Bundesrepublik, aber auch in anderen Staaten in- und außerhalb Europas stark gewandelt. Die
westlichen, stark industrialisierten Nationen sind für viele Menschen aus Ländern der so genannten
Dritten Welt, aber auch den Staaten des ehemaligen Ostblocks, zu lockenden Zielen
geworden, die Wohlstand und Frieden, kurzum ein besseres Leben verheißen.
Die Migrationsbewegungen, die in den 50er Jahren einsetzten, haben sich im Laufe der Jahrzehnte
weiterhin verstärkt, zu wirtschaftlichen Motiven sind für einen Großteil der Migrantengruppen
Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg, Terror und Hunger hinzugekommen. Dies bedeutet
innerhalb der Migrantengruppen eine größere Aufsplitterung in verschiedene Nationalitäten,
zu den ursprünglich vorwiegend europäischen Zuwanderern sind Gruppen aus Afrika, dem
Nahen Osten oder Asien hinzugekommen. Im Jahr 2001 lebten ca. 730000 Mitbürger nicht
deutscher Staatsangehörigkeit in Deutschland1, die sich auf die verschiedensten Nationalitäten
verteilten. Viele dieser Menschen haben inzwischen in Deutschland Familien, das heißt ihre
Kinder wachsen auf in einem kulturell ungesicherten Umfeld. Sie sind einerseits geprägt von
der Heimatkultur ihrer Eltern, andererseits jedoch auch zu großen Teilen von der sie umgebenden
Lebensweise in Mitteleuropa beziehungsweise Deutschland.
Aber auch innerhalb der „ursprünglichen“ deutschen Bevölkerung finden Differenzierungsbewegungen
und -prozesse statt. Ökonomische, ökologische, politische und soziale Entwicklungen
greifen tief ein in die Bevölkerungsstruktur und deren Selbstempfinden. Die großen
Veränderungen und Erschütterungen in den wirtschaftlichen Grundlagen des Landes, weg von
der Industriegesellschaft, hin zur postindustriellen Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft
führen zu großen sozialen Spannungen. Arbeit, so Donnerstag2, ist, jetzt wo sie nicht
mehr wie selbstverständlich für jeden zur Verfügung steht, nicht mehr der Leitbegriff der jüngeren
Generationen. Vielmehr ist das Erlebnis als Lebensziel für den Einzelnen ins Zentrum
des Interesses gerückt. Dies ist aber wiederum kein völlig einheitlich ablaufender Prozess. [...]
1 Quelle: Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/basis/d/bevoe/bevoetab7.htm
2 Donnerstag 1999: 241f.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen
- 1.1 Ausgangsituation
- 1.2 Die Situation der Schulen
- 1.3 Bedeutung für den Englischunterricht
- 1.4 Literatur im Fremdsprachenunterricht
- 2. Fallbeispiel - „Myop“ von Alice Walker
- 2.1 Mögliche Herangehensweise für den Unterricht
- 2.1.1 Vorüberlegungen
- 2.1.2 „The Flowers“ im Unterricht
- 2.2 Fazit
- 3. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung interkultureller Kompetenz und interkulturellen Lernens im Englischunterricht vor dem Hintergrund der zunehmenden kulturellen Vielfalt in Deutschland. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich daraus für die Schule ergeben, und zeigt anhand eines Fallbeispiels – der Kurzgeschichte „Myop“ von Alice Walker – mögliche didaktische Ansätze auf.
- Wandel der Ausgangslage in der deutschen Bildungspolitik aufgrund von Migration und gesellschaftlichen Veränderungen.
- Die Rolle der Schule im Umgang mit kultureller Vielfalt.
- Die Bedeutung interkultureller Kompetenz im Englischunterricht.
- Didaktische Ansätze für den Umgang mit interkulturellen Themen im Englischunterricht.
- Analyse des Fallbeispiels „Myop“ von Alice Walker.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der Ausgangslage in der deutschen Bildungspolitik im Hinblick auf die steigende kulturelle Vielfalt. Die zunehmende Migration aus verschiedenen Teilen der Welt und die sozialen Veränderungen innerhalb Deutschlands führen zu einer komplexen und heterogenen Gesellschaft. Der Text beleuchtet die Herausforderungen, die sich daraus für Schulen ergeben, und betont die Notwendigkeit eines bewussten und verantwortungsvollen Umgangs mit dieser neuen Realität. Die Veränderungen in der Arbeitswelt und die zunehmende Medienvielfalt werden als Faktoren genannt, die zur Ausdifferenzierung kultureller Formen und Subkulturen beitragen.
1.1 Ausgangsituation: Der Abschnitt beschreibt die demografischen Veränderungen in Deutschland durch Migration und die damit einhergehenden Herausforderungen für das Bildungssystem. Die Zunahme von Migranten aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen verändert die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft und stellt neue Anforderungen an den Unterricht. Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen innerhalb Deutschlands, wie der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, werden als weitere Faktoren genannt, die zu einer kulturellen Vielfalt beitragen.
1.2 Die Situation der Schulen: Dieser Teil analysiert die Auswirkungen der kulturellen Vielfalt auf das deutsche Schulsystem. Mit einem Anteil ausländischer Schüler von 9,7% im Schuljahr 2000/01 wird die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs mit dieser Situation deutlich gemacht. Der Text beleuchtet frühere Ansätze der Kultusministerkonferenz, welche sich vorwiegend auf den Spracherwerb konzentrierten und die kulturellen Aspekte vernachlässigten. Die Ereignisse der 90er Jahre mit Übergriffen auf ausländische Mitbürger werden als Beispiel für den Mangel an Verständnis für kulturelle Andersartigkeit in Teilen der Bevölkerung genannt. Der Abschnitt verweist auf die Rahmenrichtlinien für Englischunterricht in Niedersachsen, die die Berücksichtigung des sich internationalisierenden Umfelds der Schüler fordern.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Interkulturelles Lernen, Migration, Kulturelle Vielfalt, Englischunterricht, Didaktik, Fallbeispiel, Alice Walker, „Myop“, gesellschaftlicher Wandel, Bildungspolitik, Integration.
Häufig gestellte Fragen zu: Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen im Englischunterricht anhand des Fallbeispiels „Myop“
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung interkultureller Kompetenz und interkulturellen Lernens im Englischunterricht in Deutschland vor dem Hintergrund zunehmender kultureller Vielfalt. Sie analysiert die Herausforderungen für Schulen und präsentiert didaktische Ansätze anhand des Fallbeispiels „Myop“ von Alice Walker.
Welche Aspekte der kulturellen Vielfalt werden behandelt?
Die Arbeit betrachtet den Wandel der Ausgangslage in der deutschen Bildungspolitik aufgrund von Migration und gesellschaftlichen Veränderungen. Sie beleuchtet die Rolle der Schule im Umgang mit kultureller Vielfalt, die Bedeutung interkultureller Kompetenz im Englischunterricht und analysiert didaktische Ansätze für den Umgang mit interkulturellen Themen. Der demografische Wandel durch Migration, wirtschaftliche und soziale Veränderungen sowie die zunehmende Medienvielfalt werden als Faktoren für die kulturelle Vielfalt genannt.
Welche Herausforderungen für Schulen werden angesprochen?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden kulturellen Vielfalt für das deutsche Schulsystem ergeben. Sie erwähnt den hohen Anteil ausländischer Schüler und die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs damit. Frühere Ansätze der Kultusministerkonferenz, die sich vorwiegend auf den Spracherwerb konzentrierten, werden kritisch beleuchtet. Der Mangel an Verständnis für kulturelle Andersartigkeit in Teilen der Bevölkerung wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielt das Fallbeispiel „Myop“ von Alice Walker?
Die Kurzgeschichte „Myop“ dient als Fallbeispiel, um mögliche didaktische Ansätze für den Umgang mit interkulturellen Themen im Englischunterricht aufzuzeigen. Die Arbeit beschreibt eine mögliche Herangehensweise im Unterricht, inklusive Vorüberlegungen und der Integration von „The Flowers“ (vermutlich ein weiteres Werk von Alice Walker, näher spezifiziert im Text).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: 1. Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen (mit Unterkapiteln zu Ausgangslage, Situation der Schulen und Bedeutung für den Englischunterricht sowie Literatur im Fremdsprachenunterricht); 2. Fallbeispiel - „Myop“ von Alice Walker (mit Unterkapiteln zu möglichen Unterrichtsansätzen und Fazit); und 3. Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kompetenz, Interkulturelles Lernen, Migration, Kulturelle Vielfalt, Englischunterricht, Didaktik, Fallbeispiel, Alice Walker, „Myop“, gesellschaftlicher Wandel, Bildungspolitik, Integration.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung interkultureller Kompetenz und interkulturellen Lernens im Englischunterricht aufzuzeigen und didaktische Ansätze für den Umgang mit interkultureller Vielfalt im Unterricht zu präsentieren. Sie möchte die Herausforderungen der kulturellen Vielfalt im deutschen Schulsystem beleuchten und Lösungsansätze aufzeigen.
- Quote paper
- Niels Meyer (Author), 2003, Interkulturelle Kompetenz und interkulturelles Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18742