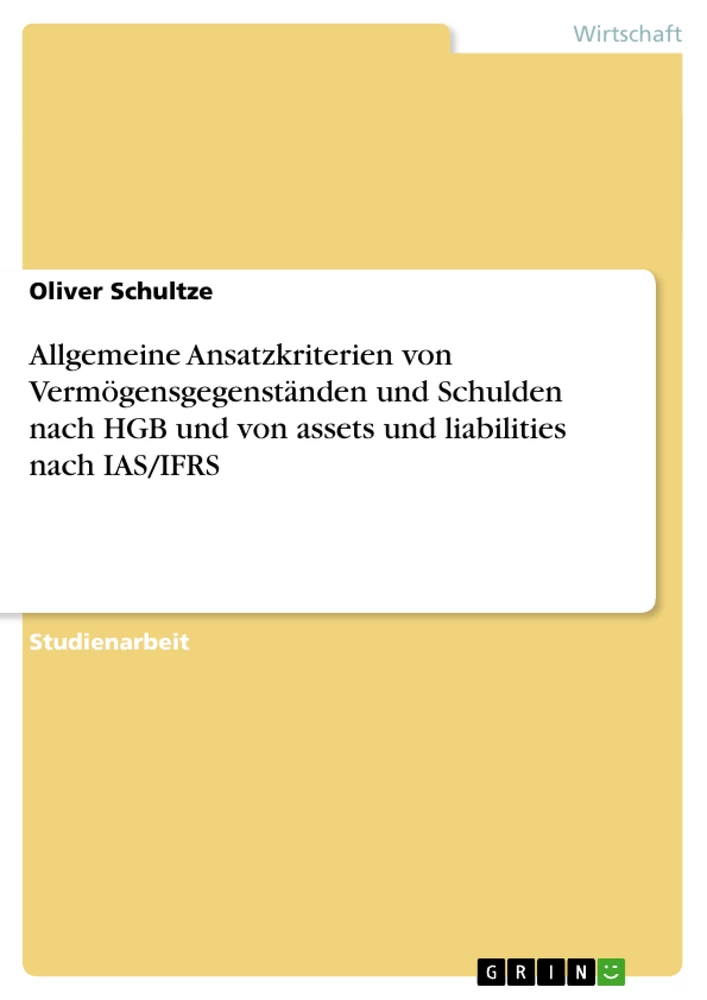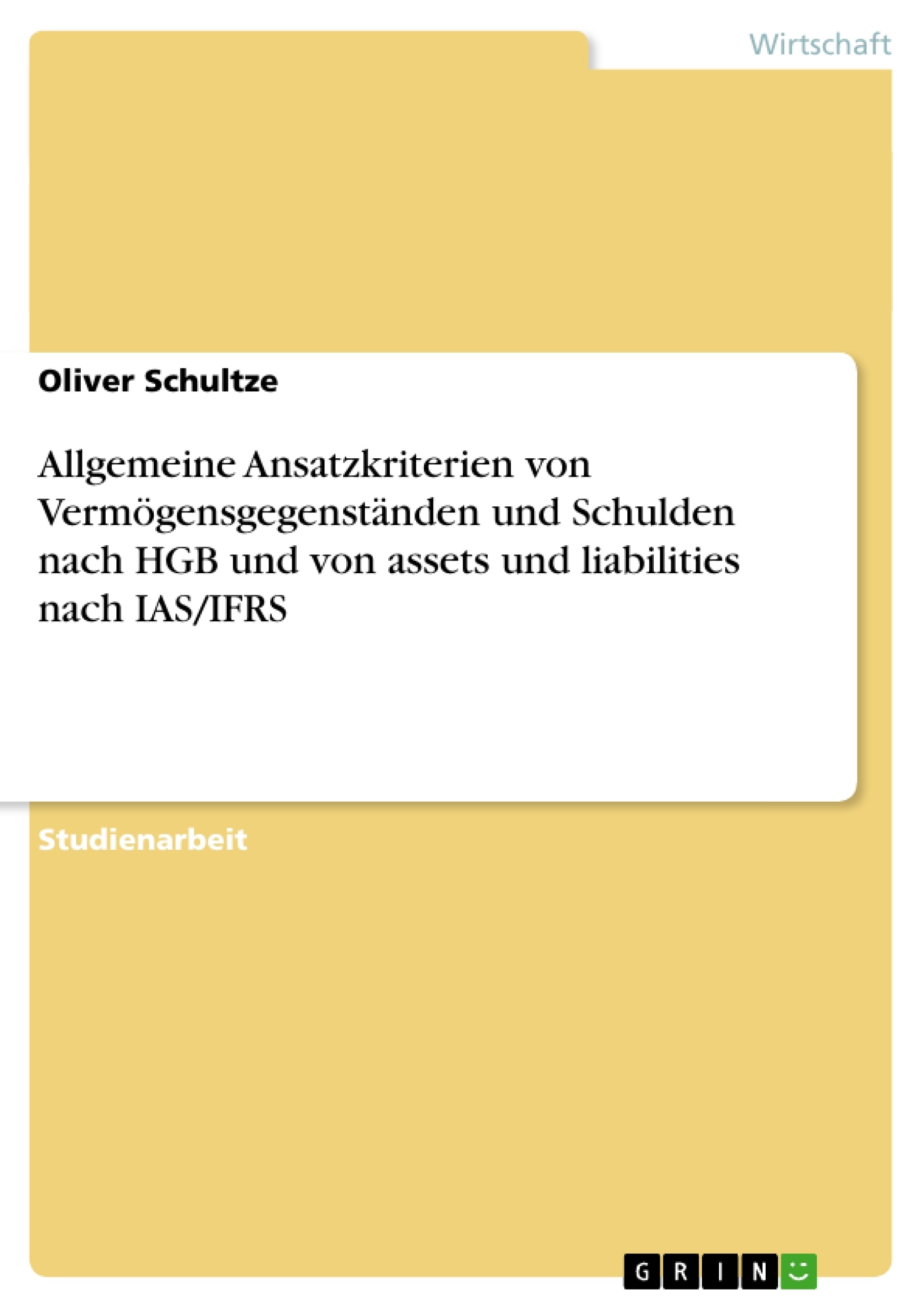Im Rahmen dieses Referats erfolgt eine Behandlung des Themas: „Allgemeine Ansatzvorschriften von Vermögensgegenständen und Schulden gemäß dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie von assets (Vermögenswerte) und liabilities (Schulden) nach den Vorschriften der IAS/IFRS“. Anhand einer Gegenüberstellung der verschiedenen Ansatzkriterien beider Rechnungslegungssysteme sollen die Besonderheiten und Unterschiede beider Systeme verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Prüfung der abstrakten und der konkreten Bilanzierungsfähigkeit
- 3. Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit im Handelsrecht
- 3.1 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstands
- 3.2 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit einer Schuld
- 4. Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines assets und einer liability gemäß den International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS)
- 4.1 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines assets
- 4.2 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit einer liability
- 5. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Vermögensgegenständen und assets bzw. Schulden und Liabilities
- 6. Der Grundsatz der konkreten Bilanzierungsfähigkeit
- 7. Die konkrete Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstands bzw. einer Schuld
- 8. Bilanzierungsverbote des Handelsrechts
- 9. Bilanzierungswahlrechte im Handelsrecht
- 10. Die konkrete Bilanzierungsfähigkeit eines assets und einer liability gemäß den International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS)
- 11. Bilanzierungsverbote der IAS/IFRS
- 12. Bilanzierungswahlrechte gemäß IAS/IFRS
- 13. Ablaufschema zu der abstrakten und der konkreten Bilanzierungsfähigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden
- 14. Ablaufschema zu der abstrakten und der konkreten Bilanzierungsfähigkeit von assets und liabilities
- 15. Schlussteil
- 16. Begriffserklärungen
- 17. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit hat zum Ziel, die allgemeinen Ansatzkriterien von Vermögensgegenständen und Schulden nach HGB und von Assets und Liabilities nach IAS/IFRS gegenüberzustellen und die Unterschiede der beiden Systeme zu verdeutlichen. Dies geschieht durch die Analyse der abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit.
- Abstrakte Bilanzierungsfähigkeit nach HGB und IAS/IFRS
- Konkrete Bilanzierungsfähigkeit nach HGB und IAS/IFRS
- Unterschiede in den Bilanzierungsvorschriften zwischen HGB und IAS/IFRS
- Bilanzierungsverbote und -wahlrechte nach HGB und IAS/IFRS
- Definition von Vermögensgegenständen, Schulden, Assets und Liabilities
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, nämlich die Gegenüberstellung der Ansatzkriterien von Vermögensgegenständen und Schulden nach HGB und IAS/IFRS. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einer vergleichenden Analyse beider Rechnungslegungssysteme beruht.
2. Die Prüfung der abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit: Dieses Kapitel erläutert den Begriff der Bilanzierungsfähigkeit und stellt das zweistufige Prüfungsschema vor, bestehend aus der Prüfung der abstrakten und der konkreten Bilanzierungsfähigkeit. Es wird die Bedeutung beider Prüfungsstufen für die korrekte Bilanzierung herausgestellt und der grundlegende Ablauf des Prozesses skizziert.
3. Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit im Handelsrecht: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit im Kontext des Handelsgesetzbuches (HGB). Es definiert die Begriffe Vermögensgegenstand und Schuld und erläutert die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein Objekt oder Vorgang als solcher klassifiziert werden kann. Die Bedeutung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) wird im Zusammenhang mit der Definition von Vermögensgegenständen und Schulden hervorgehoben.
3.1 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstands: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit den Kriterien für die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstands nach HGB. Er erklärt die Begriffe "selbständig bewertbar" und "selbständig verwertbar" und illustriert diese mit Beispielen. Die Bedeutung dieser Kriterien für den Gläubigerschutz wird besonders betont.
3.2 Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit einer Schuld: (Annahme: Kapitel 3.2 existiert und behandelt die Kriterien der abstrakten Bilanzierungsfähigkeit einer Schuld nach HGB, analog zu Kapitel 3.1 für Vermögensgegenstände. Eine Zusammenfassung muss hier eingefügt werden, die die Kriterien für die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit einer Schuld nach HGB erläutert und die Bedeutung dieser Kriterien im Kontext des HGB darlegt.)
4. Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit eines assets und einer liability gemäß den International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS): (Analog zu Kapitel 3, jedoch bezogen auf IAS/IFRS. Eine detaillierte Zusammenfassung, welche die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit von Assets und Liabilities nach IAS/IFRS erläutert und die Unterschiede zum HGB hervorhebt, muss hier eingefügt werden.)
5. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Vermögensgegenständen und assets bzw. Schulden und Liabilities: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels muss hier eingefügt werden, welche die wesentlichen Unterschiede zwischen den deutschen und internationalen Bilanzierungsbegriffen herausarbeitet und die praktischen Implikationen dieser Unterschiede beleuchtet.)
6. Der Grundsatz der konkreten Bilanzierungsfähigkeit: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels, die den Grundsatz der konkreten Bilanzierungsfähigkeit erläutert und dessen Bedeutung im Vergleich zur abstrakten Bilanzierungsfähigkeit darlegt, muss hier eingefügt werden.)
7. Die konkrete Bilanzierungsfähigkeit eines Vermögensgegenstands bzw. einer Schuld: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels, die die Kriterien der konkreten Bilanzierungsfähigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden detailliert beschreibt und ihre praktische Anwendung erläutert, muss hier eingefügt werden.)
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Abstrakte und Konkrete Bilanzierungsfähigkeit nach HGB und IAS/IFRS
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die Ansatzkriterien von Vermögensgegenständen und Schulden nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) mit denen von Assets und Liabilities nach den International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Fokus liegt auf der Analyse der abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit.
Welche Bilanzierungsfähigkeiten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die abstrakte und die konkrete Bilanzierungsfähigkeit sowohl nach HGB als auch nach IAS/IFRS. Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit prüft, ob ein Posten überhaupt bilanzierungsfähig ist, während die konkrete Bilanzierungsfähigkeit die Erfüllung weiterer Kriterien für die Bilanzierung untersucht.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind die abstrakte und konkrete Bilanzierungsfähigkeit nach HGB und IAS/IFRS, die Unterschiede in den Bilanzierungsvorschriften beider Systeme, Bilanzierungsverbote und -wahlrechte, sowie die Definition der relevanten Bilanzierungsbegriffe (Vermögensgegenstände, Schulden, Assets, Liabilities).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einleitung und einer Beschreibung der Zielsetzung. Es folgen Kapitel zur abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit nach HGB und IAS/IFRS, Kapitel zu den Unterschieden zwischen den Systemen, zu Bilanzierungsverboten und -wahlrechten, sowie abschließende Kapitel mit Ablaufschemata, Begriffserklärungen und Literaturverzeichnis.
Was wird unter abstrakter Bilanzierungsfähigkeit verstanden?
Die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit prüft, ob ein Posten (z.B. Vermögensgegenstand, Schuld, Asset, Liability) die grundlegenden Kriterien erfüllt, um überhaupt in der Bilanz berücksichtigt zu werden. Dies umfasst Kriterien wie die selbständige Bewertbarkeit und Verwertbarkeit (HGB).
Was wird unter konkreter Bilanzierungsfähigkeit verstanden?
Die konkrete Bilanzierungsfähigkeit prüft, ob ein Posten, der die abstrakte Bilanzierungsfähigkeit erfüllt, zusätzlich weitere, spezifische Kriterien erfüllt, um bilanziert zu werden. Dies kann z.B. die Zuverlässigkeit der Bewertung oder die Erfüllung von Anschaffungskostenkriterien umfassen.
Welche Unterschiede bestehen zwischen HGB und IAS/IFRS hinsichtlich der Bilanzierungsfähigkeit?
Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in den Definitionen und Kriterien der Bilanzierungsfähigkeit zwischen HGB und IAS/IFRS. Es werden sowohl Unterschiede in der abstrakten als auch in der konkreten Bilanzierungsfähigkeit detailliert beschrieben und analysiert.
Welche Bilanzierungsverbote und -wahlrechte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht sowohl die Bilanzierungsverbote als auch die Bilanzierungswahlrechte nach HGB und IAS/IFRS. Dabei werden die jeweiligen rechtlichen Grundlagen und ihre praktischen Auswirkungen erläutert.
Wie werden Vermögensgegenstände, Schulden, Assets und Liabilities definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe Vermögensgegenstände, Schulden, Assets und Liabilities und verdeutlicht die Unterschiede in den Definitionen zwischen HGB und IAS/IFRS. Diese Definitionen bilden die Grundlage für die Analyse der Bilanzierungsfähigkeit.
Gibt es Ablaufschemata zur Veranschaulichung der Bilanzierungsprozesse?
Ja, die Arbeit enthält Ablaufschemata, die den Prozess der Prüfung der abstrakten und konkreten Bilanzierungsfähigkeit sowohl für Vermögensgegenstände und Schulden nach HGB als auch für Assets und Liabilities nach IAS/IFRS veranschaulichen.
- Quote paper
- Oliver Schultze (Author), 2003, Allgemeine Ansatzkriterien von Vermögensgegenständen und Schulden nach HGB und von assets und liabilities nach IAS/IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18633