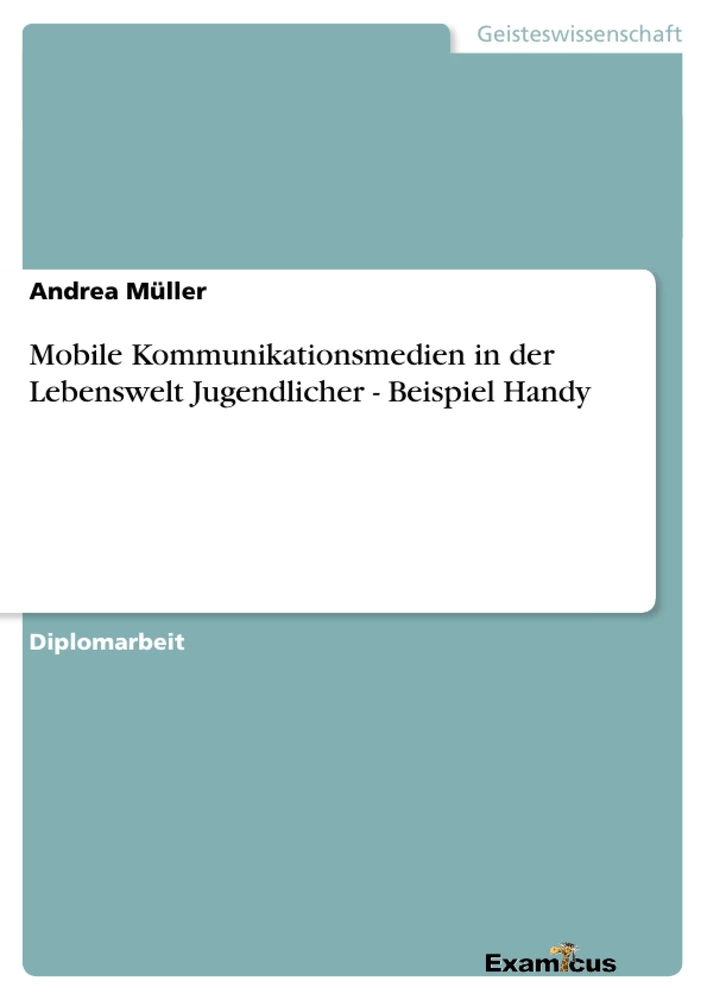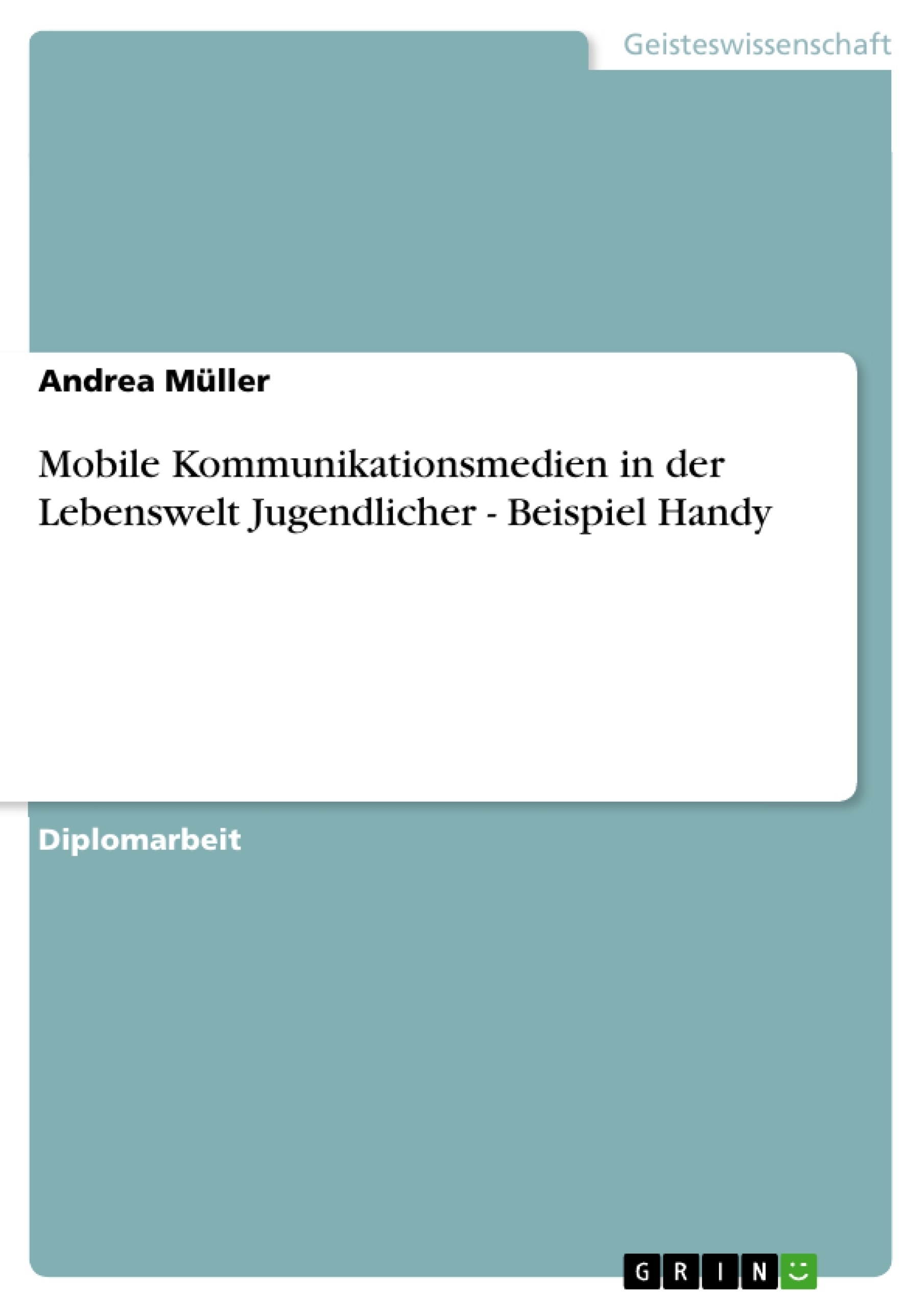In der vorliegenden Diplomarbeit wird das Kommunikationsmedium Handy in seinen unterschiedlichen Anwendungsfeldern betrachtet, hierbei liegt das Hauptaugenmerk bei dem Gebrauch innerhalb der Familie, sowie der jugendlichen Verwendung in der Peer-Group. Außerdem wird das Thema Handy als Schuldenfalle beleuchtet, einzelne Konfliktpunkte, welche durch die Nutzung entstehen, herausgearbeitet und die Entstehung einer SMS-Kultur thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definitionsgegenstand Handy
- 2.2 Entstehungsgeschichte des Mobiltelefons
- 2.2.1 Historischer Rückblick
- 2.2.2 Historie des Mobiltelefons
- 2.3 Verbreitung und Marktanteil der mobilen Kommunikation
- 2.4 Prepaid vs. Postpaid
- 2.4.1 Prepaidkarte
- 2.4.2 Postpaid - Vertragsbindung
- 3. Jugend um 2000 - Versuch des Porträts einer Jugendgeneration
- 3.1 Generation ? - Eine Generation ohne Namen?
- 3.2 Die Jugend von heute - Mobilität im Moratorium
- 3.3 Jugendliche Freizeitgestaltung um das Jahr 2000
- 3.4 Jugendliches Leben in der Peer-Group
- 4. Fokussierte Interviews mit Jugendlichen - Das Forschungsdesign
- 4.1 Die Forschungsfrage
- 4.2 Das Forschungsdesign - Methodenbeschreibung und Untersuchungsverlauf
- 4.3 Auswahl und Darstellung der Interviewpartner
- 4.3.1 Interview mit Marc
- 4.3.2 Interview mit Anna
- 4.3.3 Interview mit Martin
- 4.3.4 Interview mit Deniz und Babette
- 4.3.5 Interview mit Chris
- 4.4 Fazit
- 5. Mobile Kommunikation im Familiensystem
- 5.1 Familiäre Anschaffungsgründe für ein Mobiltelefon
- 5.2 Nutzen der familiären Mobilkommunikation
- 5.2.1 Sicherheitsfunktion in der Familie
- 5.2.2 Funktion emotionaler Stabilisierung
- 5.2.3 Organisationsfunktion: Das Mobiltelefon als Zeitressource
- 5.2.4 Erziehungsfunktion und soziale Kontrolle
- 6. Das Handy als Konfliktträger und Risikoquelle
- 6.1 Darstellung der unterschiedlichen Konfliktpunkte
- 6.1.1 Die Anschaffung des Handys
- 6.1.2 Konfliktpunkt: Soziale Kontrolle durch die Eltern
- 6.1.3 Konfliktpunkt: Die Nutzung des Handys im familialen Haushalt
- 6.1.4 Konfliktpunkt: Der Markenfetischismus der Jugendlichen
- 6.1.5 Die Kosten des Mobiltelefons - Das Handy als Schuldenfalle?
- 6.1.6 Konfliktpunkt: Das Erreichbarkeitsdilemma
- 6.1 Darstellung der unterschiedlichen Konfliktpunkte
- 7. Mobile Kommunikation in der Peer-Group
- 7.1 Das Mobiltelefon als Statussymbol
- 7.2 Jugendliche Handynutzung und deren Funktionen
- 7.3 SMS-Kultur in der Peer-Group
- 7.3.1 "Das Sammeln von Kurzmitteilungen und kollektive Kultur"
- 7.3.2 "Das Weiterleiten von Ketten-SMS"
- 7.3.3 "Kollektives Lesen und Verfassen von Textbotschaften"
- 7.4 "Beziehungen"
- 7.5 "Neue mobile Sprachstile"
- 7.6 "Das Repertoire persönlicher Kurzmitteilungen"
- 7.7 "Reziprozitätsnormen"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle mobiler Kommunikation, insbesondere des Handys, im Leben Jugendlicher um das Jahr 2000. Ziel ist es, die Nutzung des Handys in verschiedenen Kontexten zu analysieren und dessen Bedeutung für die soziale Interaktion, die Familienstrukturen und die Peer-Group zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Handys als Kommunikationsmittel für Jugendliche
- Der Einfluss des Handys auf die Familienkommunikation und -dynamik
- Das Handy als Statussymbol und Bestandteil der Peer-Group-Kultur
- Potentielle Konflikte und Risiken im Zusammenhang mit der Handynutzung
- Die soziale und kommunikative Funktion von SMS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der mobilen Kommunikation im Jugendalltag ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Es beschreibt die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Untersuchung und umreißt den methodischen Rahmen der fokussierten Interviews.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung fest. Es definiert den Begriff „Handy“, beleuchtet seine Entstehungsgeschichte und analysiert die Verbreitung und den Marktanteil mobiler Kommunikation. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich von Prepaid- und Postpaid-Verträgen und deren Relevanz im Kontext des jugendlichen Konsums. Es dient als Fundament für das Verständnis der technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Handynutzung.
3. Jugend um 2000 - Versuch des Porträts einer Jugendgeneration: Dieses Kapitel zeichnet ein umfassendes Bild der Jugendgeneration um das Jahr 2000. Es beleuchtet verschiedene Aspekte wie Mobilität, Freizeitgestaltung und die Bedeutung der Peer-Group. Es stellt den soziokulturellen Kontext dar, in dem die Handynutzung der Jugendlichen stattfindet, und bietet somit ein essentielles Hintergrundverständnis für die späteren Kapitel.
4. Fokussierte Interviews mit Jugendlichen - Das Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf fokussierten Interviews mit Jugendlichen basiert. Es erläutert die Forschungsfrage, das Forschungsdesign und den Ablauf der Untersuchung. Es präsentiert detaillierte Beschreibungen der Interviewpartner und ihrer soziodemografischen Merkmale, um die Repräsentativität der Stichprobe zu gewährleisten und die Ergebnisse einzuordnen.
5. Mobile Kommunikation im Familiensystem: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Handys innerhalb der Familie. Es untersucht die Gründe für die Anschaffung eines Handys durch Familien und beleuchtet den Nutzen der mobilen Kommunikation im familiären Kontext. Dabei werden Aspekte wie Sicherheit, emotionale Stabilisierung, Organisation und Erziehungsfunktion detailliert diskutiert und anhand von Beispielen aus den Interviews veranschaulicht.
6. Das Handy als Konfliktträger und Risikoquelle: Dieses Kapitel befasst sich mit den potenziellen Konflikten und Risiken, die mit der Handynutzung Jugendlicher verbunden sind. Es identifiziert verschiedene Konfliktpunkte, wie die Anschaffungskosten, die soziale Kontrolle durch Eltern, die Nutzung im Haushalt, Markenfetischismus und das Erreichbarkeitsdilemma. Die Analyse dieser Konfliktpunkte verdeutlicht die ambivalenten Aspekte der Handynutzung im jugendlichen Alltag.
7. Mobile Kommunikation in der Peer-Group: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Handys in der Peer-Group. Es analysiert das Handy als Statussymbol, beleuchtet die verschiedenen Funktionen der Handynutzung unter Jugendlichen und untersucht detailliert die SMS-Kultur, inklusive des Sammelns, Weiterleitens und kollektiven Lesens und Verfassens von Textnachrichten. Die Analyse beleuchtet die Bedeutung des Handys für die Beziehungspflege und die Entwicklung neuer mobiler Sprachstile.
Schlüsselwörter
Mobile Kommunikation, Handy, Jugendliche, Peer-Group, Familie, Soziale Interaktion, SMS-Kultur, Konflikt, Risiko, Statussymbol, Prepaid, Postpaid, Forschungsdesign, Fokussierte Interviews.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Mobile Kommunikation im Leben Jugendlicher um das Jahr 2000"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle mobiler Kommunikation, insbesondere des Handys, im Leben Jugendlicher um das Jahr 2000. Sie analysiert die Handynutzung in verschiedenen Kontexten (Familie, Peer-Group) und deren Bedeutung für soziale Interaktion und Familienstrukturen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung des Handys als Kommunikationsmittel, seinen Einfluss auf die Familienkommunikation, seine Rolle als Statussymbol in der Peer-Group, potentielle Konflikte und Risiken der Handynutzung, und die soziale und kommunikative Funktion von SMS. Die Entstehungsgeschichte des Mobiltelefons, Marktanteile und die Unterscheidung zwischen Prepaid und Postpaid-Verträgen werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf fokussierten Interviews mit Jugendlichen. Das Kapitel "Fokussierte Interviews mit Jugendlichen - Das Forschungsdesign" beschreibt detailliert die Forschungsfrage, den Ablauf der Untersuchung und die Auswahl der Interviewpartner (Marc, Anna, Martin, Deniz und Babette, Chris), um die Repräsentativität der Stichprobe zu gewährleisten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Jugend um 2000, Fokussierte Interviews, Mobile Kommunikation im Familiensystem, Das Handy als Konfliktträger und Risikoquelle, und Mobile Kommunikation in der Peer-Group. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlich beschrieben.
Wie wird die Familienkommunikation im Zusammenhang mit dem Handy betrachtet?
Das Kapitel "Mobile Kommunikation im Familiensystem" analysiert die Gründe für die Anschaffung eines Handys durch Familien und den Nutzen der mobilen Kommunikation im familiären Kontext. Es untersucht Aspekte wie Sicherheit, emotionale Stabilisierung, Organisation und Erziehungsfunktion.
Welche Konflikte und Risiken im Zusammenhang mit der Handynutzung werden thematisiert?
Das Kapitel "Das Handy als Konfliktträger und Risikoquelle" identifiziert verschiedene Konfliktpunkte, darunter Anschaffungskosten, soziale Kontrolle durch Eltern, die Nutzung im Haushalt, Markenfetischismus, und das Erreichbarkeitsdilemma. Diese Konfliktpunkte verdeutlichen die ambivalenten Aspekte der Handynutzung im jugendlichen Alltag.
Welche Rolle spielt das Handy in der Peer-Group?
Das Kapitel "Mobile Kommunikation in der Peer-Group" untersucht das Handy als Statussymbol, die verschiedenen Funktionen der Handynutzung unter Jugendlichen, und detailliert die SMS-Kultur (Sammeln, Weiterleiten, kollektives Lesen/Verfassen). Es beleuchtet die Bedeutung des Handys für Beziehungen und die Entwicklung neuer mobiler Sprachstile.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobile Kommunikation, Handy, Jugendliche, Peer-Group, Familie, Soziale Interaktion, SMS-Kultur, Konflikt, Risiko, Statussymbol, Prepaid, Postpaid, Forschungsdesign, Fokussierte Interviews.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle des Handys im Leben Jugendlicher um das Jahr 2000 zu untersuchen und dessen Bedeutung für die soziale Interaktion, Familienstrukturen und die Peer-Group zu beleuchten.
- Citation du texte
- Andrea Müller (Auteur), 2007, Mobile Kommunikationsmedien in der Lebenswelt Jugendlicher - Beispiel Handy, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186324