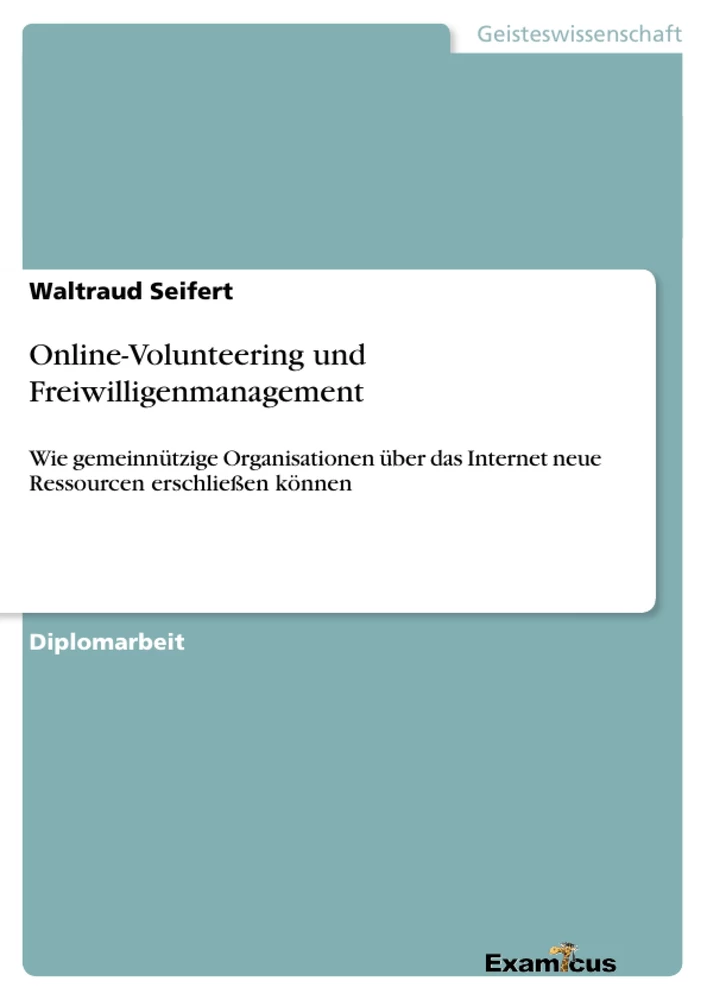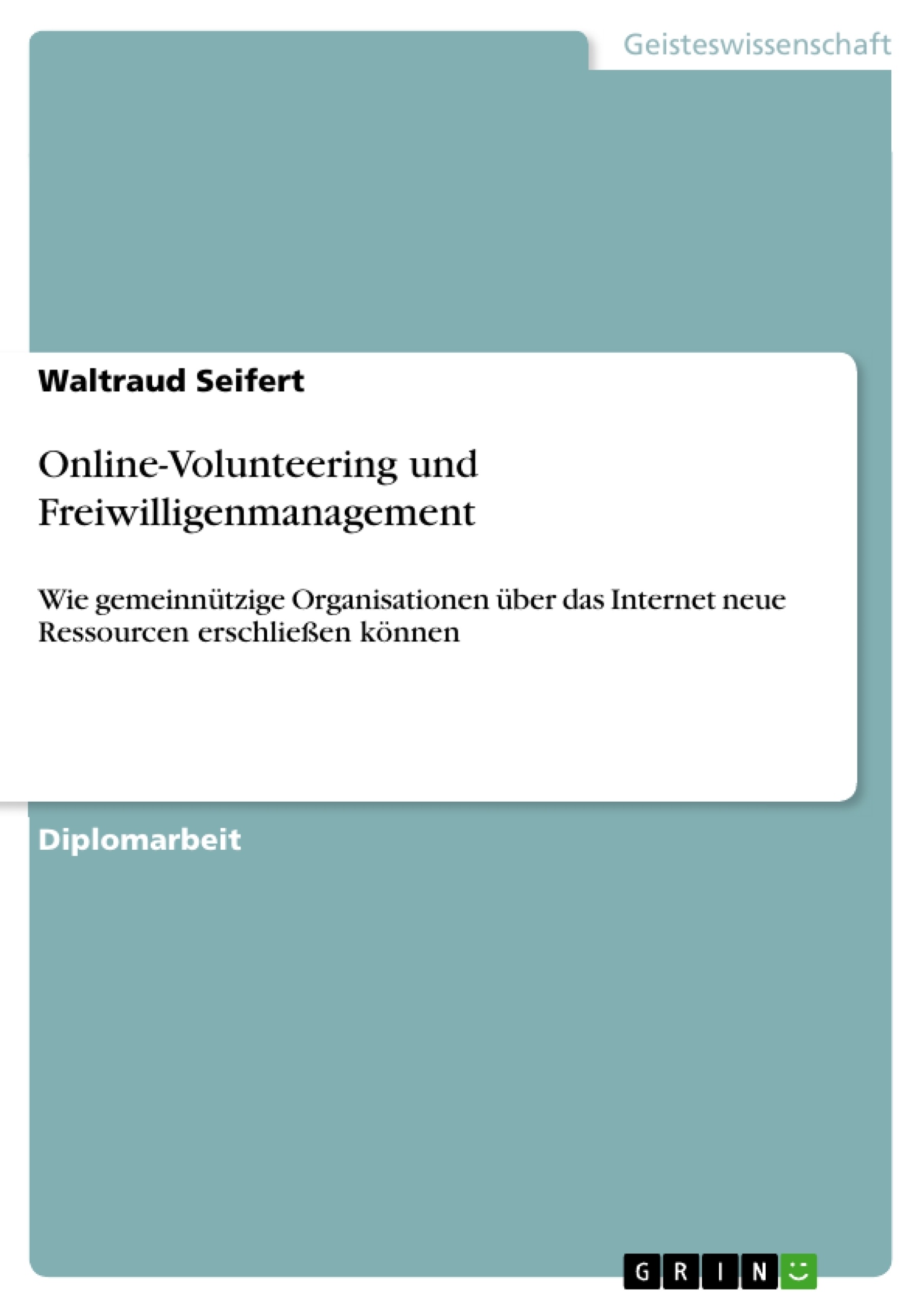Der vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem in Deutschland noch weitgehend unbekannten Phänomen: Mit dem Phänomen des freiwilligen Engagements von Menschen, die für gemeinnützige Organisationen unter Zuhilfenahme der technischen Möglichkeiten des Internets tätig sind. Die Gemeinwohlorganisation, deren Mitarbeiter und Klienten treffen sie dabei nur in seltenen Fällen von Angesicht zu Angesicht. Im anglo-amerikanischen Sprachraum stellt dieses Engagement bereits eine gängige Form freiwilligen Tätigseins dar, ist in Managementsysteme freiwilligen Engagements integriert und firmiert dort unter Namen wie "online volunteering" oder "virtual volunteering". Die Autorin stellt in den Mittelpunkt, wie Non-Profit-Organisationen aller Couleur über das Internet zusätzliche Ressourcen zielbewußt und langfristig für sich erschließen können. Sie gelangt zum Ergebnis, daß Online-Volunteering keine Kompensation für Aktivitäten vor Ort ist. Vielmehr beinhaltet es alle wesentlichen Merkmale, die den Kriterien zeitgemäßer freiwilliger Aktivitäten entsprechen. Online-Volunteering ist ein Ausdruck für den sich fortsetzenden Strukturwandel des Ehrenamts.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gesellschaftlicher Wandel und Strukturwandel des Ehrenamtes
- 3 Freiwilligenmanagement
- 3.1 Bedarfseinschätzung und Programmplanung
- 3.2 Aufgabenplanung
- 3.3 Anwerbung und Gewinnung
- 3.4 Erstgespräch und matching
- 3.5 Orientierung, Einarbeitung, Aus- und Fortbildung
- 3.6 Unterstützung, Begleitung und Motivation
- 3.7 Anerkennung
- 3.8 Auswertung
- 4 Die Bedeutung der Informationstechnologien für gemeinnützige Organisationen
- 4.1 Chance: Neue Vernetzung
- 4.2 Gefahr: Digitale Spaltung (Digital Divide)
- 5 Online-Volunteering: Ausgewählte Beispiele
- 5.1 Pioniere: Macdonald Youth Services, Winnipeg, Kanada
- 5.2 eMentoring/Telementoring: TeleMentoring NRW
- 5.3 E-Learning: PEOI
- 5.4 Entwicklungszusammenarbeit: www.nabuur.com
- 6 Das Management des Online-Volunteerings
- 6.1 Technische Voraussetzungen
- 6.2 Kommunikation über das Internet
- 6.3 Bedarfseinschätzung und Programmplanung
- 6.4 Aufgabenplanung
- 6.5 Anwerbung und Gewinnung
- 6.6 Erstgespräch und matching – und – Orientierung, Einarbeitung, Aus- und Fortbildung
- 6.7 Unterstützung, Begleitung und Motivation
- 6.8 Anerkennung
- 6.9 Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten, wie gemeinnützige Organisationen durch Online-Volunteering neue Ressourcen erschließen können. Sie beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel und den Strukturwandel des Ehrenamtes im Kontext der wachsenden Bedeutung des Internets. Die Arbeit analysiert das Management von Online-Volunteering und präsentiert ausgewählte Praxisbeispiele.
- Gesellschaftlicher Wandel und der Strukturwandel des Ehrenamtes
- Effektives Freiwilligenmanagement im digitalen Zeitalter
- Chancen und Herausforderungen von Online-Volunteering
- Best-Practice-Beispiele für Online-Volunteering
- Technische und organisatorische Voraussetzungen für erfolgreiches Online-Volunteering
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Online-Volunteering ein und betont die zunehmende Bedeutung des Internets als sozialen Handlungsraum. Sie stellt die Frage, wie gemeinnützige Organisationen diese neue Technologie nutzen können, um ihre Ressourcen zu erweitern und ihre Ziele zu erreichen. Die Arbeit wird als eine Untersuchung der Möglichkeiten und Herausforderungen von Online-Volunteering im Kontext des gesellschaftlichen Wandels positioniert.
2 Gesellschaftlicher Wandel und Strukturwandel des Ehrenamtes: Dieses Kapitel analysiert den gesellschaftlichen Wandel und seinen Einfluss auf das Ehrenamt. Es untersucht, wie sich die veränderten Lebensbedingungen und die zunehmende Digitalisierung auf die Verfügbarkeit und die Organisation ehrenamtlicher Tätigkeiten auswirken. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Chancen, die sich daraus für gemeinnützige Organisationen ergeben.
3 Freiwilligenmanagement: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des Freiwilligenmanagements, speziell im Hinblick auf Online-Volunteering. Es beschreibt detailliert die einzelnen Schritte des Prozesses, von der Bedarfseinschätzung und der Programmplanung über die Anwerbung und Gewinnung von Freiwilligen bis hin zur Anerkennung und Auswertung. Es betont die Bedeutung einer professionellen Organisation und Betreuung der Online-Freiwilligen.
4 Die Bedeutung der Informationstechnologien für gemeinnützige Organisationen: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Informationstechnologien für gemeinnützige Organisationen. Es untersucht sowohl die Chancen, die neue Vernetzungsmöglichkeiten durch das Internet bieten, als auch die Gefahren, wie die digitale Spaltung, die durch den unterschiedlichen Zugang zu Technologie entsteht. Es argumentiert für die Notwendigkeit, diese Technologie zu nutzen, um die Reichweite und Effizienz gemeinnütziger Arbeit zu erhöhen.
5 Online-Volunteering: Ausgewählte Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Beispiele für erfolgreiches Online-Volunteering aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Jugendhilfe, Mentoring und Entwicklungszusammenarbeit. Die Beispiele dienen dazu, die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten von Online-Volunteering zu illustrieren und Best-Practice-Modelle aufzuzeigen.
6 Das Management des Online-Volunteerings: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Herausforderungen des Managements von Online-Volunteering. Es untersucht die technischen Voraussetzungen, die Kommunikationsstrukturen, die Bedarfsplanung und die Organisation von Aufgaben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Betreuung und Motivation der Online-Freiwilligen und der Sicherstellung ihrer Anerkennung.
Schlüsselwörter
Online-Volunteering, Freiwilligenmanagement, gemeinnützige Organisationen, Internet, digitale Spaltung, Ehrenamt, gesellschaftlicher Wandel, Informationstechnologien, Vernetzung, Bedarfseinschätzung, Anwerbung, Motivation, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diplomarbeit über Online-Volunteering
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht, wie gemeinnützige Organisationen durch Online-Volunteering neue Ressourcen erschließen können. Sie beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel und den Strukturwandel des Ehrenamtes im Kontext der wachsenden Bedeutung des Internets und analysiert das Management von Online-Volunteering anhand ausgewählter Praxisbeispiele.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt verschiedene Themen ab, darunter der gesellschaftliche Wandel und der Strukturwandel des Ehrenamtes, effektives Freiwilligenmanagement im digitalen Zeitalter, Chancen und Herausforderungen von Online-Volunteering, Best-Practice-Beispiele und die technischen sowie organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiches Online-Volunteering.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Gesellschaftlicher Wandel und Strukturwandel des Ehrenamtes, Freiwilligenmanagement, Die Bedeutung der Informationstechnologien für gemeinnützige Organisationen, Online-Volunteering: Ausgewählte Beispiele und Das Management des Online-Volunteerings. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas Online-Volunteering.
Was wird im Kapitel "Freiwilligenmanagement" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die einzelnen Schritte des Freiwilligenmanagements für Online-Volunteering, von der Bedarfseinschätzung und Programmplanung über die Anwerbung und Gewinnung von Freiwilligen bis hin zur Anerkennung und Auswertung. Es betont die Bedeutung einer professionellen Organisation und Betreuung der Online-Freiwilligen.
Welche Beispiele für Online-Volunteering werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Beispiele für erfolgreiches Online-Volunteering aus unterschiedlichen Bereichen wie Jugendhilfe, Mentoring und Entwicklungszusammenarbeit (z.B. Macdonald Youth Services, TeleMentoring NRW, PEOI, www.nabuur.com), um die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten zu illustrieren.
Welche Herausforderungen beim Management von Online-Volunteering werden angesprochen?
Das Kapitel "Das Management des Online-Volunteerings" analysiert die spezifischen Herausforderungen, einschließlich der technischen Voraussetzungen, Kommunikationsstrukturen, Bedarfsplanung, Aufgabenorganisation, Betreuung und Motivation der Online-Freiwilligen und der Sicherstellung ihrer Anerkennung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Online-Volunteering, Freiwilligenmanagement, gemeinnützige Organisationen, Internet, digitale Spaltung, Ehrenamt, gesellschaftlicher Wandel, Informationstechnologien, Vernetzung, Bedarfseinschätzung, Anwerbung, Motivation und Anerkennung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten, wie gemeinnützige Organisationen durch Online-Volunteering neue Ressourcen erschließen können, und analysiert die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen im Kontext des gesellschaftlichen Wandels und der Digitalisierung.
- Citar trabajo
- Waltraud Seifert (Autor), 2007, Online-Volunteering und Freiwilligenmanagement, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186315