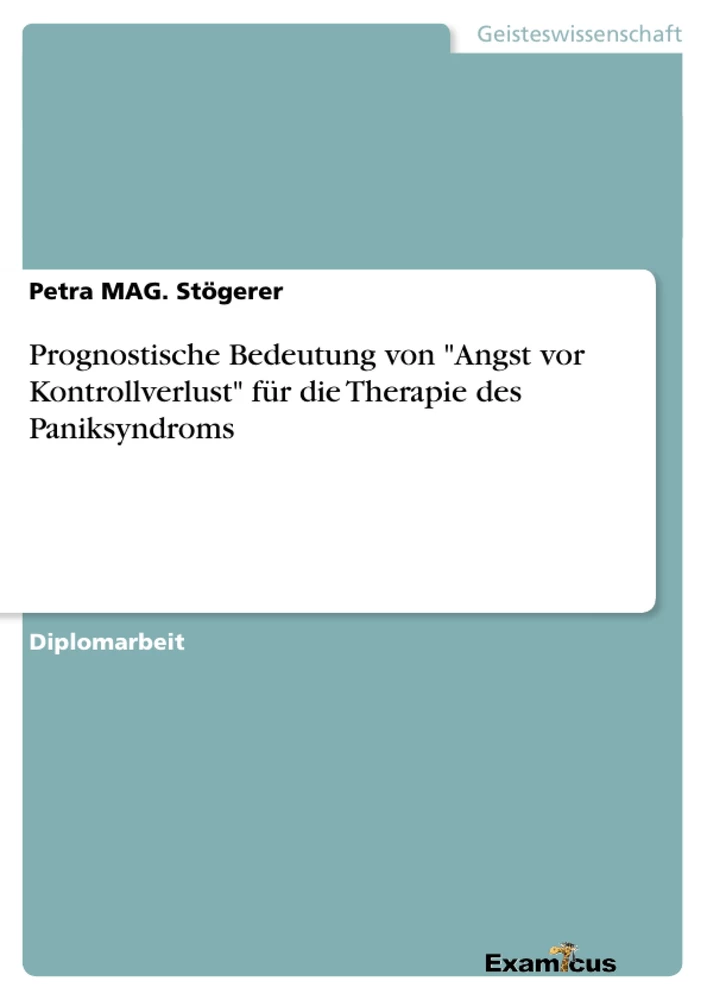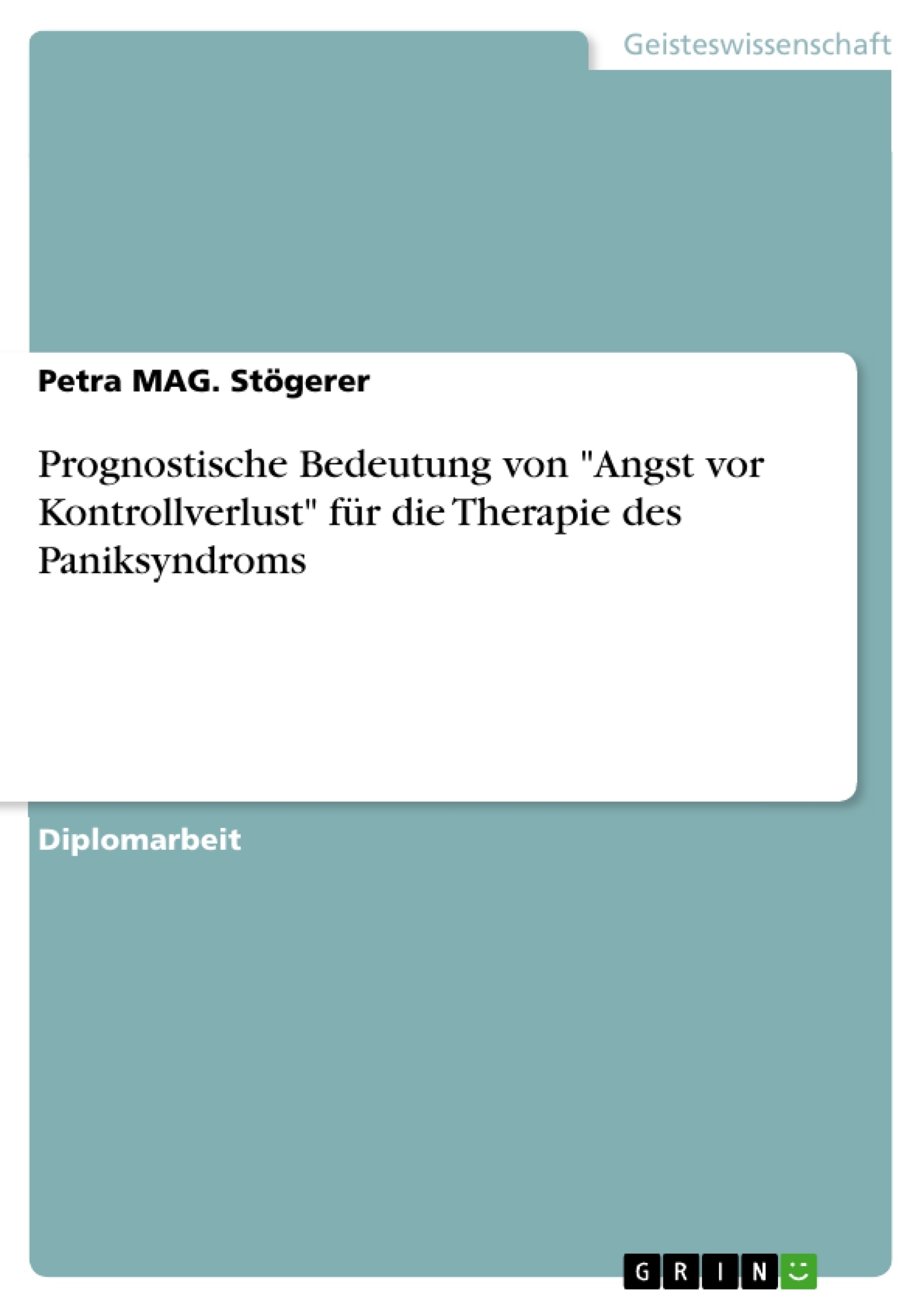Die Frage, ob spezifische Persönlichkeitsmerkmale die Auslösung verschiedener psychischer Erkrankungen, in diesem speziellen Falle die des Paniksyndroms, begünstigen, beschäftigt die Forschung schon seit langem. Phänomene wie Grundängstlichkeit (Kast, 1996) und Angstsensitivität (Taylor & Cox, 1998) werden als mögliche prädisponierende Faktoren für die Entstehung des Paniksyndroms genannt. McNally und Lorenz (1987) definieren Angstsensitivität als personenspezifisches und situationsüberdauerndes Persönlichkeitsmerkmal. Auch Reiss (1991) in seiner Erwartungstheorie, s. auch Reiss und McNally (1985), Reiss et al. (1986), Taylor (1995) und Cox, Parker und Swinson (1996), mißt der Angstsensitivität erhebliche Bedeutung bei der Entstehung des Paniksyndroms zu. Margraf und Schneider (1990) führen physiologische Prädispositionen sowie erhöhte Aufmerksamkeitszuwendung auf Gefahrenreize bzw. größere Akkuratheit der Interozeption an. Die Bedeutung von inadäquaten kognitiven Schemata sowie dysfunktionalen Kognitionen und Fehlattributionen bei der Auslösung von Panikattacken betonen Beck et al. (1985). Seligman (1971 und 1975) sowie Schneider und Margraf (1998) sehen die Variablen Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit als bedeutsam für die Entstehung von Angst an. Auch für Strian (1998) ist die Kontrolle über die Angst entscheidend. Selektive Informationsverarbeitung spielt laut Seligman (1975) ebenfalls eine wesentliche Rolle. Aus lerntheoretischer Sicht sind vor allem die Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrers (Schneider & Margraf, 1998), basierend auf klassischer und operanter Konditionierung, sowie der Teufelskreis der Angst (Margraf & Schneider, 1990) zu nennen. Überprotektive Eltern, allgemeine Ängstlichkeit, Selbstunsicherheit und Abhängigkeit werden von Margraf (1996) und Schneider und Margraf (1998) als möglicherweise die Ausbildung von Panikattacken begünstigende Faktoren erwähnt. Diese Theorien, ebenso wie jene von Goldstein und Chambless (1978), wurden jedoch nicht empirisch bestätigt. Auch neurobiologische Ansätze von Schneider und Margraf (1998) und Strian (1998) sowie die psychoanalytisch geprägte Darstellung von Marks (1970), daß Angst aufgrund des Konfliktes zwischen Autonomiestreben und Abhängigkeitswünschen entsteht, sind zu beachten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoretischer Teil
- Angstsensitivität
- Definition von Angst
- Angst und Angststörungen
- Prädispositionen zur Auslösung des Paniksyndroms
- Lerntheoretische und kognitive Modelle
- Neurobiologische Modelle
- Psychoanalytisch orientierte Modelle
- Integrierte Modelle
- Phänomenologie
- Diagnostik
- Paniksyndrom
- Differentialdiagnose
- Epidemiologie
- Komorbidität und Störungsbeginn
- Verlaufsform und Prognose
- Therapie
- Pharmakotherapie
- Kognitive Verhaltenstherapie
- Psychoanalytisch orientierte Psychotherapie
- Angstsensitivität
- II. Empirischer Teil
- Veränderungsmessung
- Wirksamkeitskontrollstudie
- Personengruppen
- Zeitlicher Ablauf der Untersuchung
- Untersuchungsinstrumente
- Soziodemographische Daten im Vergleich
- Ergebnisse des „Anxiety Sensitivity Index\" (ASI) im Vergleich
- Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe
- Fragestellungen und Ergebnisse
- Hypothesen
- Ergebnisse
- Beantwortung der Fragestellungen
- Interpretation der Ergebnisse
- Nebenfragestellungen
- Kritische Reflexion
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die prognostische Bedeutung von Angst vor Kontrollverlust für die Therapie des Paniksyndroms. Ziel ist es, den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen wie Angstsensitivität auf die Entstehung und den Verlauf des Paniksyndroms zu beleuchten und die Wirksamkeit von Therapieansätzen zu evaluieren.
- Angstsensitivität als prädisponierender Faktor für Panikstörungen
- Einfluss von kognitiven und lerntheoretischen Modellen auf die Entstehung von Panikattacken
- Wirkung verschiedener Therapiemethoden (Pharmakotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, psychoanalytische Psychotherapie)
- Auswertung empirischer Daten zur Veränderungsmessung im Kontext des Paniksyndroms
- Analyse soziodemografischer Daten und deren Korrelation mit dem Krankheitsverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss spezifischer Persönlichkeitsmerkmale, insbesondere der Angst vor Kontrollverlust, auf die Entstehung und den Verlauf des Paniksyndroms. Sie erwähnt verschiedene Theorien und Modelle, die die Entstehung von Panikattacken erklären, wie z.B. die Angstsensitivität, lerntheoretische Ansätze und neurobiologische Modelle, und verweist auf die Notwendigkeit empirischer Untersuchungen.
I. Theoretischer Teil: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die relevanten Theorien und Modelle zur Angstsensitivität, Angststörungen im Allgemeinen und speziell des Paniksyndroms. Es werden verschiedene Definitionen von Angst diskutiert, prädisponierende Faktoren analysiert (z.B. Grundängstlichkeit, Lerntheorien, kognitive Schemata) und unterschiedliche Therapieansätze vorgestellt. Der Abschnitt verbindet verschiedene Perspektiven (biologische, psychoanalytische, humanistische), um ein ganzheitliches Verständnis des Paniksyndroms zu ermöglichen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf kognitive und lerntheoretische Aspekte gelegt, wie die Zwei-Faktoren-Theorie und den Teufelskreis der Angst. Die Darstellung der verschiedenen Modelle dient als Grundlage für die empirische Untersuchung im zweiten Teil der Arbeit.
II. Empirischer Teil: Der empirische Teil beschreibt die Methodik und die Ergebnisse einer Wirksamkeitskontrollstudie. Es wird detailliert auf die eingesetzten Messinstrumente eingegangen (z.B. Anxiety Sensitivity Index, Panic Disorder Severity Scale, State-Trait Anxiety Inventory), die Versuchspersonen charakterisiert und der Ablauf der Untersuchung erläutert. Die Ergebnisse werden präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert. Es werden Vergleiche zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe hinsichtlich verschiedener Variablen (z.B. Schweregrad der Erkrankung, Angstlevel) gezogen und die soziodemografischen Daten der Probanden analysiert.
Schlüsselwörter
Paniksyndrom, Angstsensitivität, Angst vor Kontrollverlust, kognitive Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, prädisponierende Faktoren, Veränderungsmessung, Wirksamkeitskontrollstudie, Lerntheorie, Neurobiologische Modelle.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Prognostische Bedeutung von Angst vor Kontrollverlust für die Therapie des Paniksyndroms
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die prognostische Bedeutung von Angst vor Kontrollverlust für die Therapie des Paniksyndroms. Im Mittelpunkt steht der Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen, insbesondere der Angstsensitivität, auf Entstehung und Verlauf der Störung, sowie die Wirksamkeit verschiedener Therapieansätze.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil bietet einen umfassenden Überblick über Angstsensitivität, Angststörungen (insbesondere Paniksyndrom), verschiedene Definitionen von Angst, prädisponierende Faktoren (wie Grundängstlichkeit, Lerntheorien, kognitive Schemata), und diverse Therapieansätze (Pharmakotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, psychoanalytisch orientierte Psychotherapie). Es werden verschiedene theoretische Modelle (lerntheoretische, kognitive, neurobiologische, psychoanalytische, integrierte Modelle) verglichen und integriert, um ein ganzheitliches Verständnis des Paniksyndroms zu ermöglichen.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil verwendet?
Der empirische Teil beschreibt eine Wirksamkeitskontrollstudie. Es werden detailliert die eingesetzten Messinstrumente (z.B. Anxiety Sensitivity Index, Panic Disorder Severity Scale, State-Trait Anxiety Inventory) erläutert, die Versuchspersonen charakterisiert und der Ablauf der Untersuchung beschrieben. Die Ergebnisse werden präsentiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert. Vergleiche zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe bezüglich Erkrankungsschweregrad und Angstlevel werden gezogen, und soziodemografische Daten der Probanden analysiert.
Welche konkreten Fragestellungen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Angstsensitivität als prädisponierender Faktor für Panikstörungen, den Einfluss kognitiver und lerntheoretischer Modelle auf die Entstehung von Panikattacken, die Wirkung verschiedener Therapiemethoden (Pharmakotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, psychoanalytische Psychotherapie), und analysiert empirische Daten zur Veränderungsmessung im Kontext des Paniksyndroms sowie die Korrelation soziodemografischer Daten mit dem Krankheitsverlauf.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Wirksamkeitskontrollstudie, einschließlich der Ergebnisse des „Anxiety Sensitivity Index“ (ASI) im Vergleich zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe, Unterschiede in den soziodemografischen Daten und die Interpretation dieser Ergebnisse im Hinblick auf die Forschungsfragen. Neben den Hauptergebnissen werden auch Ergebnisse zu Nebenfragestellungen diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Paniksyndrom, Angstsensitivität, Angst vor Kontrollverlust, kognitive Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, prädisponierende Faktoren, Veränderungsmessung, Wirksamkeitskontrollstudie, Lerntheorie, Neurobiologische Modelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen empirischen Teil, eine kritische Reflexion und eine Zusammenfassung. Der theoretische Teil umfasst Kapitel zu Angstsensitivität, Phänomenologie, Diagnostik, Epidemiologie, Komorbidität und Störungsbeginn, Verlaufsform und Prognose, sowie Therapie. Der empirische Teil beinhaltet die Beschreibung der Veränderungsmessung und der Wirksamkeitskontrollstudie mit detaillierter Darstellung der Methodik, Ergebnisse und Interpretation.
- Citar trabajo
- Petra MAG. Stögerer (Autor), 2000, Prognostische Bedeutung von "Angst vor Kontrollverlust" für die Therapie des Paniksyndroms, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185732