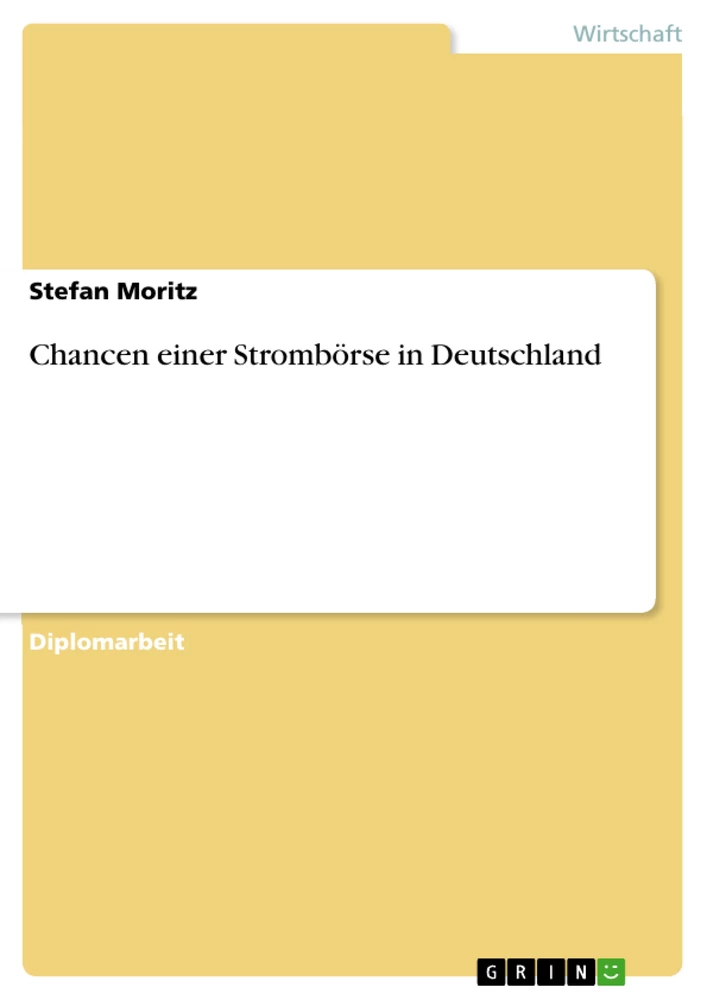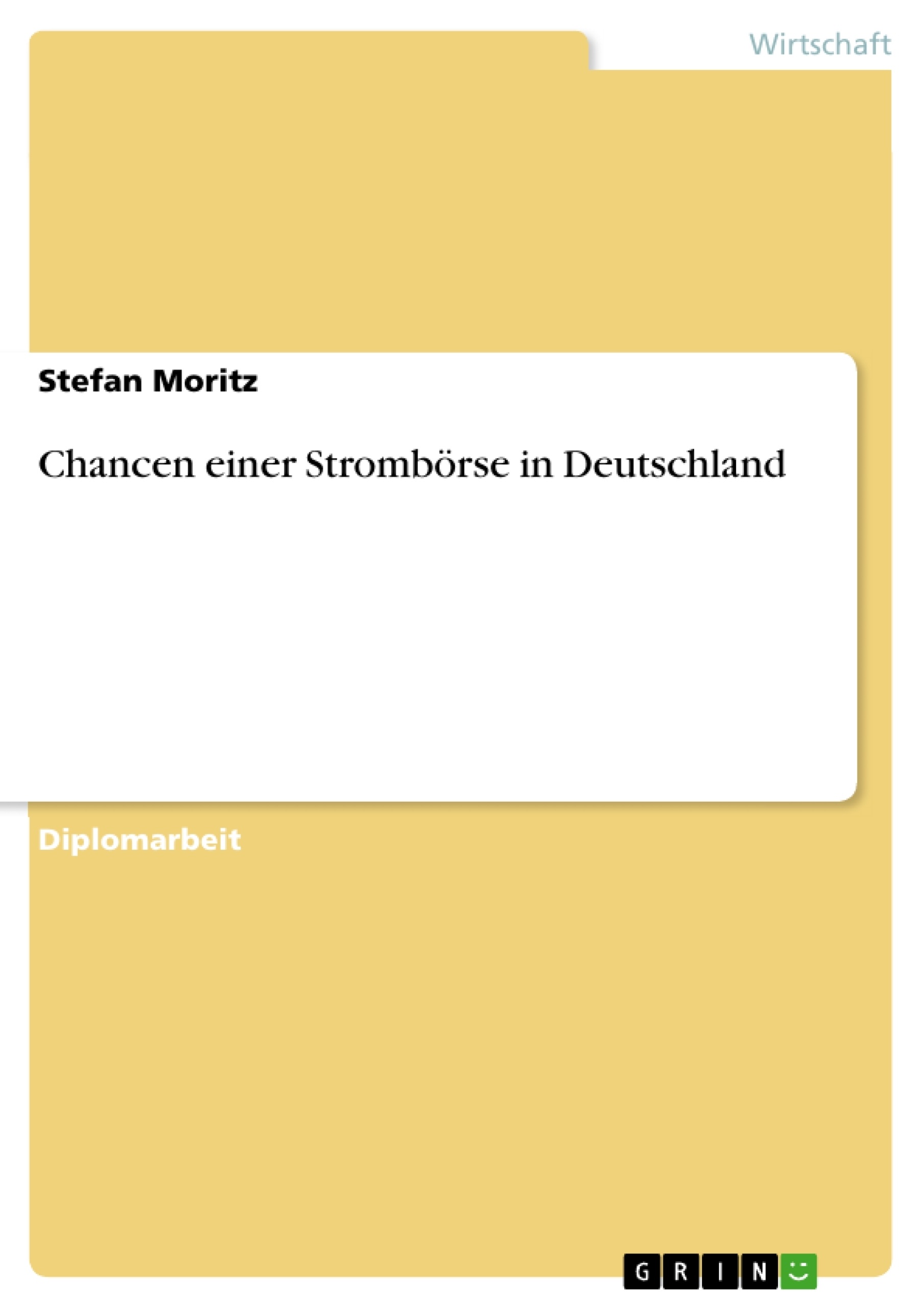Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, zu beurteilen, welche Chancen, auf Grund der vorgegebenen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz potenzieller Börsenteilnehmer, eine Strombörse mit Standort in Deutschland hat und damit auch, welche Chancen die Signalwirkungen, die von einer Strombörse ausgehen, haben.
Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit wettbewerbstheoretischen Grundlagen, wie dem Konzept des natürlichen Monopols, sowie mit drei unterschiedlichen Deregulierungs-modellen, die alle ihre Bedeutung für Deutschland haben. Die beiden vorgestellten NTPA-Modelle werden beide in der deutschen Umsetzung der EU-Richtlinie zur Liberalisierung des Energie- und Elektrizitätsmarktes als mögliche Umsetzungs-modelle erwähnt und das danach vorgestellte Konzept des Pool-Modells findet sich zumindest ansatzweise in den einzeln beschriebenen Strombörsen wieder.
Im 3. Kapitel wird eingangs eine kurze Zusammenfassung der geschichtlichen Entstehung der Struktur der Energiewirtschaft gezeigt, der dann die Beschreibung dieser Struktur folgt. Danach werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor und nach der Liberalisierung vorgestellt, welche einen starken Einfluss auf die Chancen einer deutschen Strombörse haben.
Mit Nord Pool, Amsterdam Power Exchange (APX) und California Power Exchange (CalPX) werden im 4. Kapitel drei existierende Strombörsen im Ausland vorgestellt. Es wird untersucht, welche Lehren Deutschland eventuell aus diesen ausländischen Beispielen ziehen könnte. Weiter beschäftigt sich dieses Kapitel mit den beiden Strombörsenkonzepten, dass der European Energy Exchange in Frankfurt und der Leipzig Power Exchange in Leipzig, die in Deutschland implementiert werden.
Mittels einer Befragung, die bei sechs ausgewählten Versorgungsunternehmen durch-geführt wurde und deren Ergebnisse in Kapitel 5 dargestellt werden, soll eine Tendenz ersichtlich werden, welche Erwartungen diese Unternehmen an eine deutsche Strombörse haben und welche Chancen sie ihr einräumen.
Die Gesamtarbeit wird mit einem Fazit zu den Chancen einer Strombörse in Deutschland in Kapitel 6 abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Das natürliche Monopol
- 2.1.1 Stromerzeugung als natürliches Monopol?
- 2.1.2 Stromtransport als natürliches Monopol?
- 2.2 Modelle zur Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft
- 2.2.1 Netzzugang auf Vertragsbasis (Negotiated Third Party Access)
- 2.2.2 Netzzugang auf Vertragsbasis und Einzelkäufer (Alleinkäufersystem)
- 2.2.3 Das Pool-Modell
- 2.2.4 Kriterien zur Beurteilung der Modelle
- 2.2.5 Beurteilung der Modelle
- 3 Rahmenbedingungen der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- 3.1 Aufbau und Struktur der Elektrizitätswirtschaft
- 3.1.1 Aufbau der Elektrizitätswirtschaft
- 3.1.2 Struktur der Elektrizitätswirtschaft
- 3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3.2.1 Ordnungsrahmen vor der Liberalisierung
- 3.2.1.1 Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- 3.2.1.2 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- 3.2.1.3 Konzessionsabgaben
- 3.2.2 Ordnungsrahmen nach der Liberalisierung
- 3.2.2.1 Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
- 3.2.2.2 Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
- 3.2.2.3 Konzessionsabgaben
- 3.2.2.4 Verbändevereinbarung
- 4 Strombörsen
- 4.1 Voraussetzungen und Funktionen einer Strombörse
- 4.1.1 Voraussetzungen
- 4.1.2 Funktionen
- 4.2 Ausländische Strombörsen
- 4.2.1 Nord Pool ASA
- 4.2.1.1 Entstehungsgeschichte
- 4.2.1.2 Aufbau und Organisation
- 4.2.1.3 Märkte
- 4.2.1.3.1 Spotmarkt (Elspot)
- 4.2.1.3.2 Finanzmarkt
- 4.2.1.3.2.1 Future- und Forwardmarkt (Eltermin)
- 4.2.1.3.2.2 Optionsmarkt (Eloption)
- 4.2.1.3.3 Elbas
- 4.2.1.4 Geschäftsentwicklung
- 4.2.2 Amsterdam Power Exchange (APX)
- 4.2.2.1 Entstehungsgeschichte
- 4.2.2.2 Aufbau und Organisation
- 4.2.2.3 Märkte
- 4.2.2.3.1 Spotmarkt
- 4.2.2.3.2 Märkte in der Entwicklung
- 4.2.3 California Power Exchange (CalPX)
- 4.2.3.1 Entstehungsgeschichte
- 4.2.3.2 Elektrizitätsmarktstruktur in Kalifornien
- 4.2.3.3 Märkte
- 4.2.3.3.1 Spotmarkt
- 4.2.3.3.2 Terminmarkt
- 4.2.3.4 Geschäftsentwicklung
- 4.2.4 Ansatzpunkte für eine deutsche Strombörse
- 4.3 Konzepte der beiden deutschen Strombörsen
- 4.3.1 Frankfurt/M.: European Energy Exchange (EEX)
- 4.3.1.1 Eigentümerstruktur
- 4.3.1.2 Zulassungsvoraussetzungen
- 4.3.1.3 Der EEX-Spotmarkt
- 4.3.1.4 Der EEX-Terminmarkt
- 4.3.2 Leipzig: Leipzig Power Exchange (LPX)
- 4.3.2.1 Eigentümerstruktur
- 4.3.2.2 Zulassungsvoraussetzungen
- 4.3.2.3 Der LPX-Spotmarkt
- 5 Befragung von Versorgungsunternehmen
- 5.1 Struktur und Ziele des Fragebogens
- 5.2 Befragte Unternehmen und Begründung für deren Auswahl
- 5.3 Ergebnisse der Befragung
- 5.3.1 Fragenkomplex: Ausländische Strombörsen
- 5.3.2 Fragenkomplex: Deutsche Konzepte
- 5.3.3 Fragenkomplex: Vorbereitungen
- 5.3.4 Fragenkomplex: Erwartungen und Akzeptanz
- 5.3.5 Gesamtergebnis der Befragung
- 6 Fazit der Gesamtarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Chancen einer Strombörse in Deutschland. Ziel ist es, die Voraussetzungen, Funktionen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung zu analysieren. Dabei werden ausländische Modelle als Vergleichsmaßstab herangezogen.
- Theoretische Grundlagen des Strommarktes und natürliche Monopole
- Modelle zur Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft
- Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland
- Analyse bestehender ausländischer Strombörsen
- Bewertung der Konzepte deutscher Strombörsen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Einleitung skizziert die Herausforderungen und Chancen der Liberalisierung des deutschen Strommarktes und die damit verbundene Frage nach der Etablierung einer Strombörse. Sie verdeutlicht den Bedarf an einer effizienten Marktstruktur und den Forschungsfokus dieser Arbeit.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es behandelt das Konzept des natürlichen Monopols im Kontext der Stromerzeugung und -verteilung und diskutiert verschiedene Modelle zur Deregulierung, wie z.B. Netzzugang auf Vertragsbasis und das Pool-Modell, unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Marktstrukturen und ihren Einfluss auf Wettbewerb und Effizienz.
3 Rahmenbedingungen der deutschen Elektrizitätswirtschaft: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Struktur der deutschen Elektrizitätswirtschaft vor und nach der Liberalisierung. Es analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), und deren Auswirkungen auf die Entwicklung eines wettbewerbsorientierten Strommarktes. Die Kapitel analysieren die Regulierungslandschaft und ihre Rolle bei der Gestaltung des Marktes.
4 Strombörsen: Dieses Kapitel analysiert die Funktionsweise und die Voraussetzungen für den Erfolg von Strombörsen. Es präsentiert detaillierte Fallstudien zu ausländischen Strombörsen wie Nord Pool ASA, Amsterdam Power Exchange (APX) und California Power Exchange (CalPX). Die Analyse umfasst deren Entstehungsgeschichte, Aufbau, Organisation, gehandelte Märkte (Spot- und Terminmärkte) und Geschäftsentwicklung. Die Erkenntnisse dienen als Grundlage für die Bewertung der Konzepte für deutsche Strombörsen.
5 Befragung von Versorgungsunternehmen: Dieses Kapitel beschreibt eine Befragung von deutschen Versorgungsunternehmen zu ihren Erwartungen und zur Akzeptanz von Strombörsen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Akzeptanz und die Herausforderungen bei der Einführung von Strombörsen in Deutschland aus der Perspektive der Marktteilnehmer. Die Kapitel untersuchen die Meinungen und Einschätzungen relevanter Akteure im deutschen Strommarkt.
Schlüsselwörter
Strombörse, Elektrizitätswirtschaft, Deregulierung, natürliches Monopol, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Wettbewerb, Marktdesign, Nord Pool ASA, Amsterdam Power Exchange (APX), California Power Exchange (CalPX), European Energy Exchange (EEX), Leipzig Power Exchange (LPX), Befragung, Versorgungsunternehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Chancen einer Strombörse in Deutschland"
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Chancen einer Strombörse in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Analyse der Voraussetzungen, Funktionen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung, wobei ausländische Modelle zum Vergleich herangezogen werden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Theoretische Grundlagen des Strommarktes und natürliche Monopole, Modelle zur Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland, Analyse bestehender ausländischer Strombörsen (Nord Pool ASA, APX, CalPX), Bewertung der Konzepte deutscher Strombörsen (EEX, LPX) und eine Befragung deutscher Versorgungsunternehmen zu ihren Erwartungen und der Akzeptanz von Strombörsen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept des natürlichen Monopols im Kontext der Stromerzeugung und -verteilung und diskutiert verschiedene Modelle zur Deregulierung, wie z.B. Netzzugang auf Vertragsbasis und das Pool-Modell, inklusive deren Vor- und Nachteile. Es wird analysiert, wie die Marktstrukturen Wettbewerb und Effizienz beeinflussen.
Welche rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Aufbau und die Struktur der deutschen Elektrizitätswirtschaft vor und nach der Liberalisierung. Im Detail werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), und deren Auswirkungen auf die Entwicklung eines wettbewerbsorientierten Strommarktes untersucht.
Welche ausländischen Strombörsen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Funktionsweise und den Erfolg von Strombörsen anhand von Fallstudien zu Nord Pool ASA, Amsterdam Power Exchange (APX) und California Power Exchange (CalPX). Die Analyse umfasst deren Entstehungsgeschichte, Aufbau, Organisation, gehandelte Märkte (Spot- und Terminmärkte) und Geschäftsentwicklung.
Welche deutschen Strombörsenkonzepte werden bewertet?
Die Arbeit bewertet die Konzepte der beiden deutschen Strombörsen, der European Energy Exchange (EEX) in Frankfurt und der Leipzig Power Exchange (LPX). Die Analyse umfasst Eigentümerstruktur, Zulassungsvoraussetzungen und die Funktionsweise der Spot- und Terminmärkte.
Wie wurden die Versorgungsunternehmen befragt?
Die Arbeit beschreibt eine Befragung deutscher Versorgungsunternehmen zu ihren Erwartungen und zur Akzeptanz von Strombörsen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die Akzeptanz und Herausforderungen bei der Einführung von Strombörsen in Deutschland aus der Sicht der Marktteilnehmer.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht ein Fazit zur Gesamtanalyse und fasst die Erkenntnisse zu den Chancen und Herausforderungen einer Strombörse in Deutschland zusammen. Die Ergebnisse der Befragung der Versorgungsunternehmen fließen in die Schlussfolgerungen mit ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Strombörse, Elektrizitätswirtschaft, Deregulierung, natürliches Monopol, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Wettbewerb, Marktdesign, Nord Pool ASA, Amsterdam Power Exchange (APX), California Power Exchange (CalPX), European Energy Exchange (EEX), Leipzig Power Exchange (LPX), Befragung, Versorgungsunternehmen.
- Arbeit zitieren
- Stefan Moritz (Autor:in), 2000, Chancen einer Strombörse in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185485