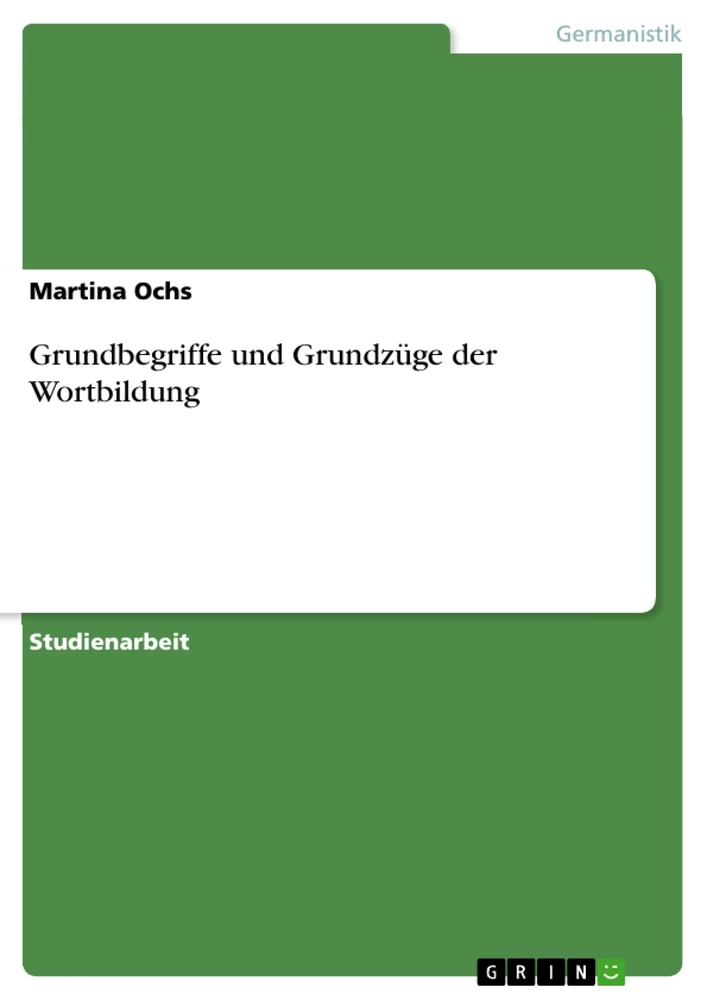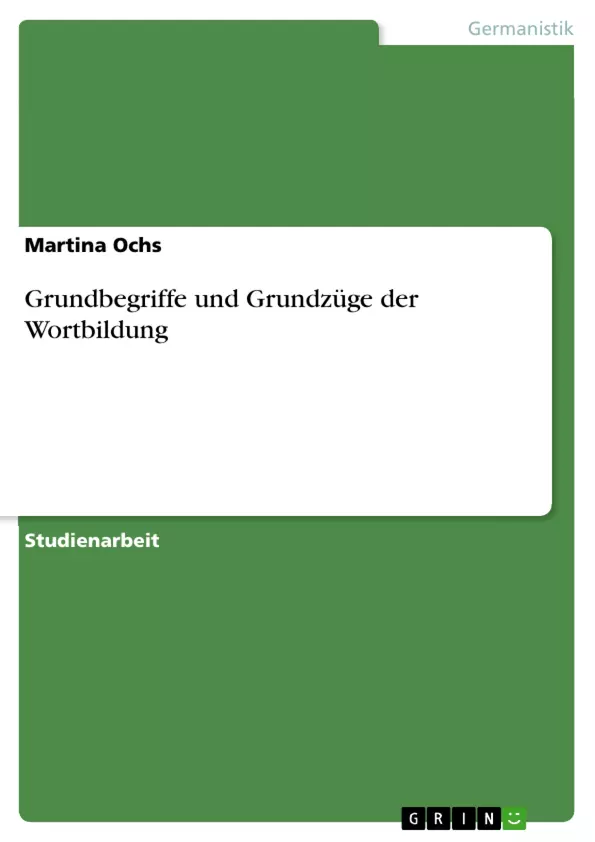Das Phänomen der Bildung neuer Wörter auf der Basis vorhandener sprachlicher Mittel ist zum einen das Resultat des menschlichen Bedürfnisses, jede neue Sichtweise auf ein bereits existierendes Objekt, jede neue materielle Erfindung und jede neue abstrakte Erkenntnis sprachlich zum Ausdruck zu bringen. Zum anderen erklärt es sich durch die Tendenz der Vereinfachung komplexerer syntaktischer Strukturen zu einem Wort, dessen Informationsdichte entsprechend hoch ist. Wenn nun durch zunehmende Univerbierung oft sehr lange Wörter entstehen, werden diese zum Zweck der Ökonomisierung auf verschiedene Weise wieder verkürzt, wobei die so entstandene Form manchmal anstelle der ursprünglichen Form in den Wortschatz eingeht und statt ihrer an Wortbildungsprozessen teilnimmt. Nicht selten werden auch Abkürzungen von ganzen Wortfolgen ebenso lexikalisiert, so dass eine einstige syntaktische Fügung in der verkürzten Form grammatisch wie ein einfaches Wort behandelt werden kann.
Zu allen im folgenden behandelten Wortbildungstypen werden lexikalisierte, usuelle, okkasionelle und/oder potentielle Beispiele angeführt, die die theoretisch beschriebene Struktur veranschaulichen. Das heißt, es werden sowohl Beispiele berücksichtigt, die bereits als Lexeme im Lexikon vermerkt sind, als auch solche, die zwar üblich sind, aber trotzdem noch nicht im Wörterbuch stehen, solche, die aus einem momentanen Bedarf heraus produziert werden und solche, die bisher vermutlich noch niemand gebildet hat, die aber den produktiven Wortbildungsregeln gerecht werden.
Ob Wortbildung produktiv, aktiv oder unproduktiv zu nennen ist, richtet sich danach, wie stark ein Verfahren oder ein Bestandteil eines komplexeren Wortes zum aktuellen Zeitpunkt zu Neubildungen anregt. Produktiv sind solche Elemente oder Prozesse, die gegenwärtig häufig zur Bildung neuer Wörter verwendet werden, aktiv sind jene, die noch in größeren Mengen im aktuellen Sprachgebrauch auftauchen, ohne jedoch zu Neubildungen anzureizen, und unproduktiv jene, deren Anzahl in der heutigen Sprache schon sehr reduziert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Abbreviation
- II. Komposition
- II.1 Rein substantivische Komposita
- II.1.1 Determinativkomposita oder endozentrische Komposita
- II.1.1.1 - Determinativkomposita aus zwei Komponenten
- II.1.1.2 - Determinativkomposita aus drei oder mehr Komponenten
- II.1.2 Possessivkomposita
- II.1.3 Kopulativkomposita
- II.1.4 Elliptische Komposita
- II.1.5 Zusammensetzungen mit Kürzungen
- II.1.1 Determinativkomposita oder endozentrische Komposita
- II.2 Substantivische Komposita mit adjektivische, verbalen und anderen Kompon.
- II.3 Adjektivische Komposita
- II.3.1 Komposita aus substantivischem Erst- und adjektivischem Zweitglied
- II.3.2 Rein adjektivische Komposita
- II.3.3 Komposita aus verbalem Erst- und adjektivischem Zweitglied
- II.4 Verbale Komposita
- II.4.1 Komposita aus substantivischem Erst- und verbalem Zweitglied
- II.4.2 Komposita aus adjektivischem Erst- und verbalem Zweitglied
- II.4.3 Rein verbale Komposita
- II.1 Rein substantivische Komposita
- III. Derivation
- III.1 Einfache Affigierung
- III.1.1 Einfache Präfigierung bei Verben
- III.1.2 Einfache Affigierung bei Adjektiven
- III.1.3 Einfache Affigierung bei Substantiven
- III.2 Konversion
- III.2.1 Verbalisierung mittels Konversion
- III.2.2 Adjektivierung mittels Konversion
- III.2.3 Substantivierung mittels Konversion
- III.3 Transposition
- III.2.1 Verbalisierung mittels Transposition
- III.2.2 Adjektivierung mittels Transposition
- III.2.3 Substantivierung mittels Transposition
- III.1 Einfache Affigierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Grundbegriffen und Grundzügen der Wortbildung im Deutschen. Sie untersucht verschiedene Verfahren zur Bildung neuer Wörter aus bereits bestehenden Wörtern und Wortteilen.
- Analyse verschiedener Wortbildungsverfahren
- Untersuchung der Produktivität und Aktivität von Wortbildungsprozessen
- Beschreibung von lexikalisierten, usuelle, okkasionellen und potentiellen Wortbildungsbeispielen
- Bedeutung der Abbreviationen und deren Rolle in der Wortbildung
- Einfluss von Komposition und Derivation auf den Wortschatz der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit, die Wortbildung im Deutschen, vor und erläutert die Bedeutung dieses Themas. Sie beschreibt die Motivation für die Untersuchung und skizziert die grundlegenden Prinzipien der Wortbildung.
- I. Abbreviation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verfahren der Abbreviation und analysiert verschiedene Arten von Abkürzungen. Es untersucht die Rolle von Abbreviationen in der Wortbildung und die unterschiedlichen Möglichkeiten der Kürzungsverfahren.
- II. Komposition: Dieses Kapitel widmet sich der Komposition als wichtigem Verfahren der Wortbildung. Es untersucht verschiedene Unterkategorien der Komposition, darunter die rein substantivischen, adjektivischen und verbalen Komposita. Es werden Beispiele für verschiedene Kompositionstypen gegeben und deren grammatische und semantische Eigenschaften analysiert.
- III. Derivation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verfahren der Derivation und analysiert verschiedene Arten der Ableitung von Wörtern. Es untersucht die Einfache Affigierung, die Konversion und die Transposition als wichtige Verfahren der Derivation und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Wortbildung auf.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Wortbildung, Abbreviation, Komposition, Derivation, Substantiv, Adjektiv, Verb, Lexikalisierung, Produktivität, Aktivität, Sprachgebrauch, deutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die wichtigsten Verfahren der Wortbildung?
Die zentralen Verfahren im Deutschen sind die Komposition (Zusammensetzung), die Derivation (Ableitung) und die Abbreviation (Kürzung).
Was ist ein Determinativkompositum?
Es ist eine Zusammensetzung, bei der das hintere Glied (Grundwort) die grammatische Kategorie festlegt und das vordere Glied (Bestimmungswort) die Bedeutung näher bestimmt (z.B. „Haustür“).
Was unterscheidet produktive von unproduktiven Wortbildungselementen?
Produktive Elemente werden aktuell häufig zur Neubildung von Wörtern genutzt, während unproduktive Elemente kaum noch neue Wörter hervorbringen und nur im Altbestand existieren.
Was versteht man unter Konversion?
Konversion ist der Wechsel eines Wortes in eine andere Wortart ohne Änderung der Form (z.B. vom Verb „laufen“ zum Substantiv „das Laufen“).
Warum entstehen immer längere Wörter im Deutschen?
Das liegt an der Tendenz zur Univerbierung, um komplexe syntaktische Strukturen zu einem einzigen Wort mit hoher Informationsdichte zusammenzufassen.
- Quote paper
- Martina Ochs (Author), 2000, Grundbegriffe und Grundzüge der Wortbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1845