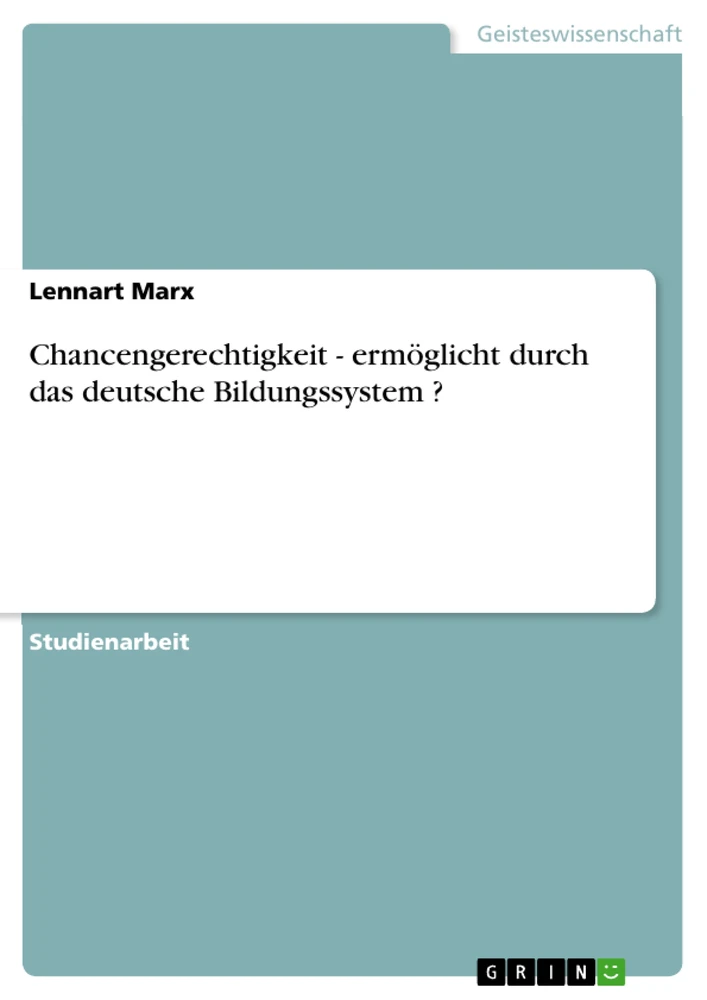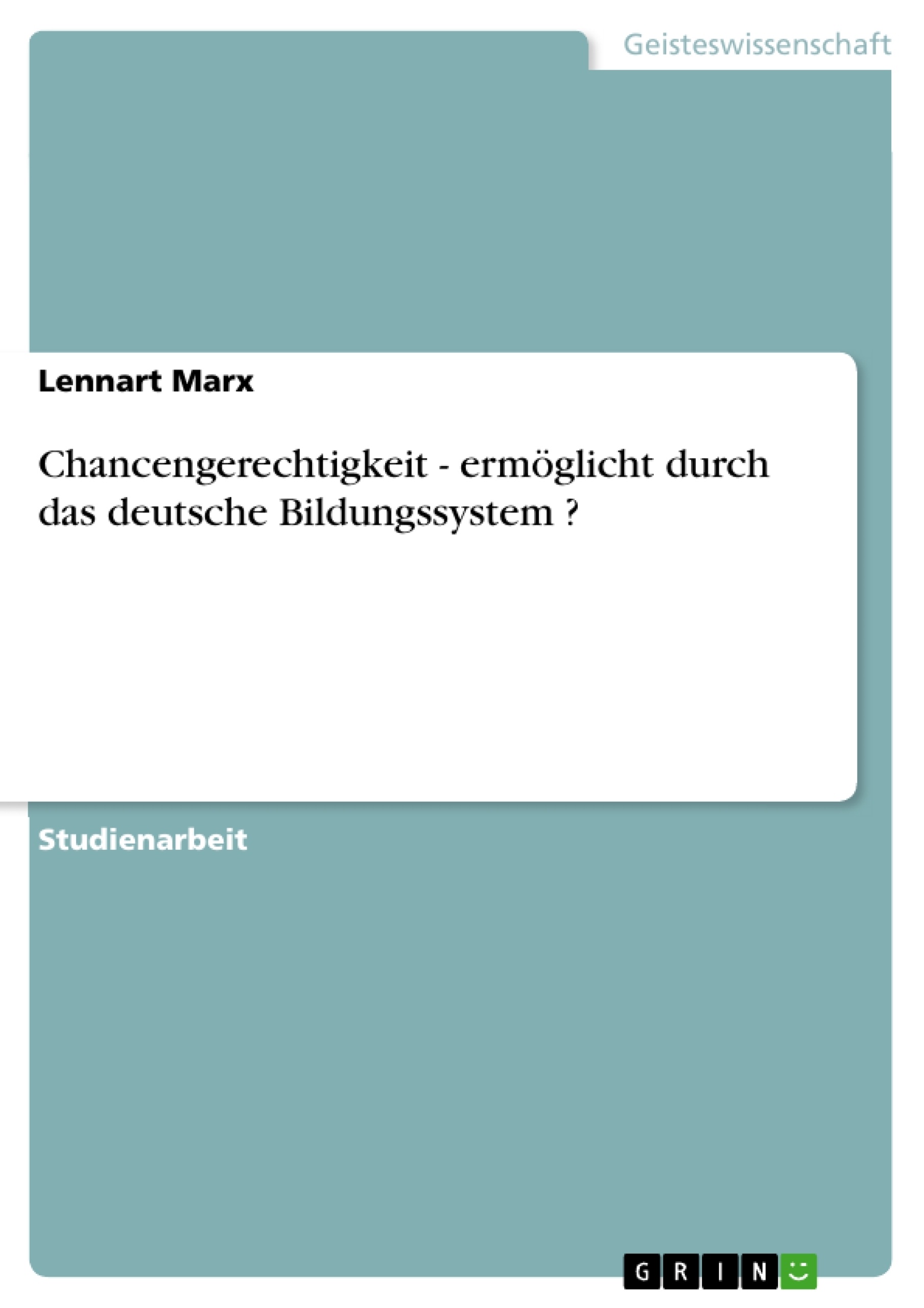„Nicole von den Driesch aus Wegberg bewirbt sich am 9. Mai für die SPD um einen Sitz im Landtag. Bildungspolitik ist der Schwerpunkt der 40-Jährigen. Sie fordert mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit“ (Heckers 2010). Diese Pressemeldung ist ein aktueller Anlass, die Herausforderung der Chancengerechtigkeit an deutschen Schulen gründlicher zu analysieren. An Stammtischen wird auf das Schulsystem geschimpft, Kinder fühlen sich benachteiligt, Lehrer sind frustriert. Doch warum gibt es Chancenungerechtigkeit in Deutschland? Wodurch wird sie verursacht? Welche Bevölkerungsgruppen sind davon positiv, welche negativ betroffen? Was wird hier genau als ungerecht empfunden? Welche objektiven Geschehnisse verbergen sich hinter dem Vorwurf, dass deutsche Bildungssystem sei unfähig, Chancengleichheit herzustellen und deshalb ungerecht?
Zunächst ist eine Beschäftigung mit dem Begriff der Chancengleichheit und die Eingliederung in den historischen Kontext wichtig, um dann festzustellen, welche Faktoren diese Chancengleichheit aushebeln bzw. unterdrücken, aber auch warum durch sie soziale Ungleichheit reproduziert wird. Dann werden der soziale Hintergrund, insbesondere der Migrationshintergrund, und die Schule als Bildungsinstitution näher untersucht.
Soziale Benachteiligung zeigt sich in verschiedenen Faktoren, wie dem Geschlecht, der sozialen Schicht der Eltern, der Religion und der regionalen Herkunft (Dahrendorf 1968).
Diese Hausarbeit ist auf den Migrationshintergrund beschränkt, weil u. a. die Forscherin Heike Diefenbach und der Bericht des Konsortiums Bildungsberichterstattung der Meinung sind, dass dieser Faktor am meisten Chancenungleichheit produziert. Auch Ingrid Gogolin verweist im Zuge der PISA-Studie und anderen Vergleichsstudien darauf, dass Kinder „aus zugewanderten Familien“ schlechtere Leistungen aufweisen als Kinder ohne Migrationshintergrund, wenn diese in der Sprache, in der unterrichtet wird, erbracht werden. Insbesondere ihre Lesekompetenz sei besorgniserregend (Gogolin 2006: 38).
Des Weiteren können keine Lösungsvorschläge gemacht werden, da viele Autoren sich zu diesem Thema geäußert haben, Thesen aufgestellt und Untersuchungen durchgeführt haben, dabei jedoch häufig konkrete Vorschläge zur Verbesserung fehlten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff der „Chancengerechtigkeit“
- Chancenungerechtigkeit durch den sozialen Hintergrund
- Kinder mit Migrationshintergrund
- Die Bedeutung des Migrationshintergrundes für Chancenungerechtigkeit: Erklärungsversuche
- Chancenungerechtigkeit durch das deutsche Schulsystem
- Schulformen und Selektion
- Das Phänomen „Gesamtschule“ – eine Gesamtlösung für alle SchülerInnen und Probleme des Schulsystems?
- Über die weit verbreitete Befürchtung, die Gesamtschule senke das Klassenniveau
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem. Sie untersucht die Faktoren, die Chancengleichheit verhindern oder unterdrücken und die Reproduktion sozialer Ungleichheit fördern. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle des sozialen Hintergrunds, insbesondere des Migrationshintergrunds, und des Schulsystems.
- Definition und historische Einordnung des Begriffs „Chancengerechtigkeit“
- Einfluss des sozialen Hintergrunds (mit Schwerpunkt Migrationshintergrund) auf Bildungserfolg
- Analyse der Chancenungleichheit im deutschen Schulsystem und dessen Selektionsmechanismen
- Die Rolle der Gesamtschule im Kontext der Chancengerechtigkeit
- Diskussion der Herausforderungen und der fehlenden Lösungsansätze im Umgang mit Chancenungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem ein und benennt die zentrale Forschungsfrage: Warum gibt es Chancenungerechtigkeit in Deutschland und welche Faktoren tragen dazu bei? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erwähnt die Fokussierung auf den Migrationshintergrund als einen wesentlichen Faktor der Chancenungleichheit. Die Einleitung verweist auf die aktuelle Relevanz des Themas und die bestehenden Kontroversen. Sie betont den Mangel an konkreten Lösungsvorschlägen in der bestehenden Literatur.
Zum Begriff der „Chancengerechtigkeit“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen und differenziert ihn von Chancengleichheit. Es beleuchtet verschiedene Perspektiven auf den Begriff, inklusive der Definition von Hradil, der die Abhängigkeit von leistungsfremden Merkmalen betont, und der von Peter Büchner, der soziale Ungerechtigkeit als Ungleichheit im Zugang zu sozialen Ressourcen definiert. Die unterschiedlichen Positionen von Soziologen und dem Kinderarzt Largo bezüglich der Ursachen von Chancenungleichheit werden diskutiert, wobei der Einfluss von sozialen Faktoren und individuellen Anlagen auf den Bildungserfolg hervorgehoben wird. Das Kapitel illustriert den komplexen und vielschichtigen Charakter des Begriffs der Chancengerechtigkeit anhand von Beispielen und unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven.
Chancenungerechtigkeit durch den sozialen Hintergrund: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss des sozialen Hintergrunds auf die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Es konzentriert sich insbesondere auf den Migrationshintergrund und beruft sich auf Forschungsergebnisse, die auf schlechtere Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund hinweisen, besonders im Bereich der Lesekompetenz. Das Kapitel betont den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg und erklärt die Notwendigkeit, die komplexen Ursachen der Chancenungleichheit zu analysieren. Es verknüpft diese Aspekte mit der Einleitung, indem es den Mangel an konkreten Lösungsvorschlägen unterstreicht und die Herausforderungen für zukünftige Forschung identifiziert.
Chancenungerechtigkeit durch das deutsche Schulsystem: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss des deutschen Schulsystems auf die Chancenungleichheit. Es analysiert die Rolle von Schulformen und Selektionsmechanismen und diskutiert kritisch das Konzept der Gesamtschule als möglicher Lösungsansatz. Es werden sowohl positive als auch negative Aspekte der Gesamtschule beleuchtet und die anhaltende Kritik an der Beibehaltung von Bildungsprivilegien für einige SchülerInnen thematisiert. Das Kapitel verwendet das Beispiel der Hamburger Schulreform und der damit verbundenen Kontroversen, um die Herausforderungen und Widerstände bei der Umsetzung von Chancengerechtigkeit im Schulsystem zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildungssystem, sozialer Hintergrund, Migrationshintergrund, Schulsystem, Selektion, Gesamtschule, soziale Ungleichheit, Bildungserfolg, PISA-Studie.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem, insbesondere den Einfluss des sozialen Hintergrunds (mit Schwerpunkt Migrationshintergrund) und des Schulsystems auf den Bildungserfolg. Sie untersucht Faktoren, die Chancengleichheit verhindern und die Reproduktion sozialer Ungleichheit fördern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Definition und historische Einordnung von „Chancengerechtigkeit“, Einfluss des sozialen Hintergrunds (besonders Migrationshintergrund) auf den Bildungserfolg, Analyse der Chancenungleichheit im deutschen Schulsystem und dessen Selektionsmechanismen, die Rolle der Gesamtschule im Kontext der Chancengerechtigkeit und die Diskussion der Herausforderungen und fehlenden Lösungsansätze im Umgang mit Chancenungleichheit.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus den Kapiteln: Einleitung, Zum Begriff der „Chancengerechtigkeit“, Chancenungerechtigkeit durch den sozialen Hintergrund (inkl. Unterkapitel zu Kindern mit Migrationshintergrund), Chancenungerechtigkeit durch das deutsche Schulsystem (inkl. Unterkapitel zu Gesamtschulen), und Schluss.
Wie wird der Begriff "Chancengerechtigkeit" definiert und eingeordnet?
Das Kapitel "Zum Begriff der 'Chancengerechtigkeit'" differenziert zwischen Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit. Es analysiert verschiedene Perspektiven auf den Begriff, inklusive der Definitionen von Hradil und Büchner. Die unterschiedlichen Positionen von Soziologen und dem Kinderarzt Largo bezüglich der Ursachen von Chancenungleichheit werden diskutiert, wobei der Einfluss von sozialen Faktoren und individuellen Anlagen hervorgehoben wird.
Wie wird der Einfluss des sozialen Hintergrunds, insbesondere des Migrationshintergrunds, behandelt?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und Bildungserfolg. Sie bezieht sich auf Forschungsergebnisse, die auf schlechtere Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund hinweisen und erklärt die Notwendigkeit, die komplexen Ursachen der Chancenungleichheit zu analysieren.
Welche Rolle spielt das deutsche Schulsystem und insbesondere die Gesamtschule?
Die Hausarbeit analysiert den Einfluss des deutschen Schulsystems auf die Chancenungleichheit, untersucht die Rolle von Schulformen und Selektionsmechanismen und diskutiert kritisch das Konzept der Gesamtschule als möglichen Lösungsansatz. Sowohl positive als auch negative Aspekte der Gesamtschule werden beleuchtet, und die anhaltende Kritik an der Beibehaltung von Bildungsprivilegien wird thematisiert. Das Beispiel der Hamburger Schulreform und der damit verbundenen Kontroversen veranschaulicht die Herausforderungen bei der Umsetzung von Chancengerechtigkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, Bildungssystem, sozialer Hintergrund, Migrationshintergrund, Schulsystem, Selektion, Gesamtschule, soziale Ungleichheit, Bildungserfolg, PISA-Studie.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Warum gibt es Chancenungerechtigkeit in Deutschland und welche Faktoren tragen dazu bei?
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Schlussfolgerungen der Hausarbeit werden im Kapitel "Schluss" zusammengefasst. Die Arbeit hebt den Mangel an konkreten Lösungsvorschlägen in der bestehenden Literatur hervor und identifiziert Herausforderungen für zukünftige Forschung.
- Quote paper
- Lennart Marx (Author), 2010, Chancengerechtigkeit - ermöglicht durch das deutsche Bildungssystem ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184449