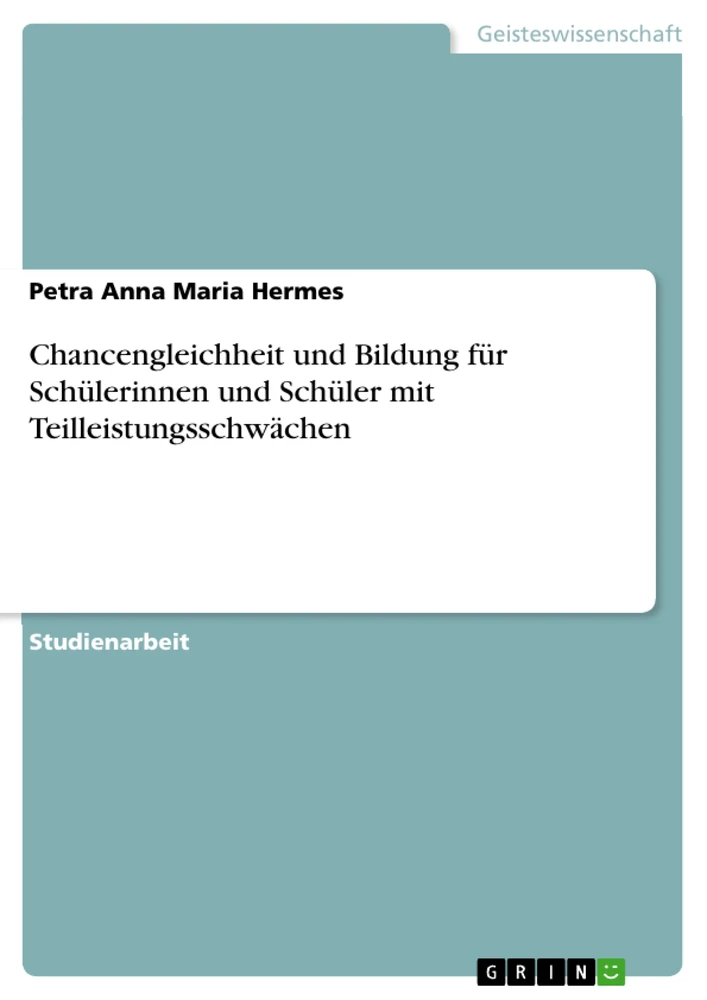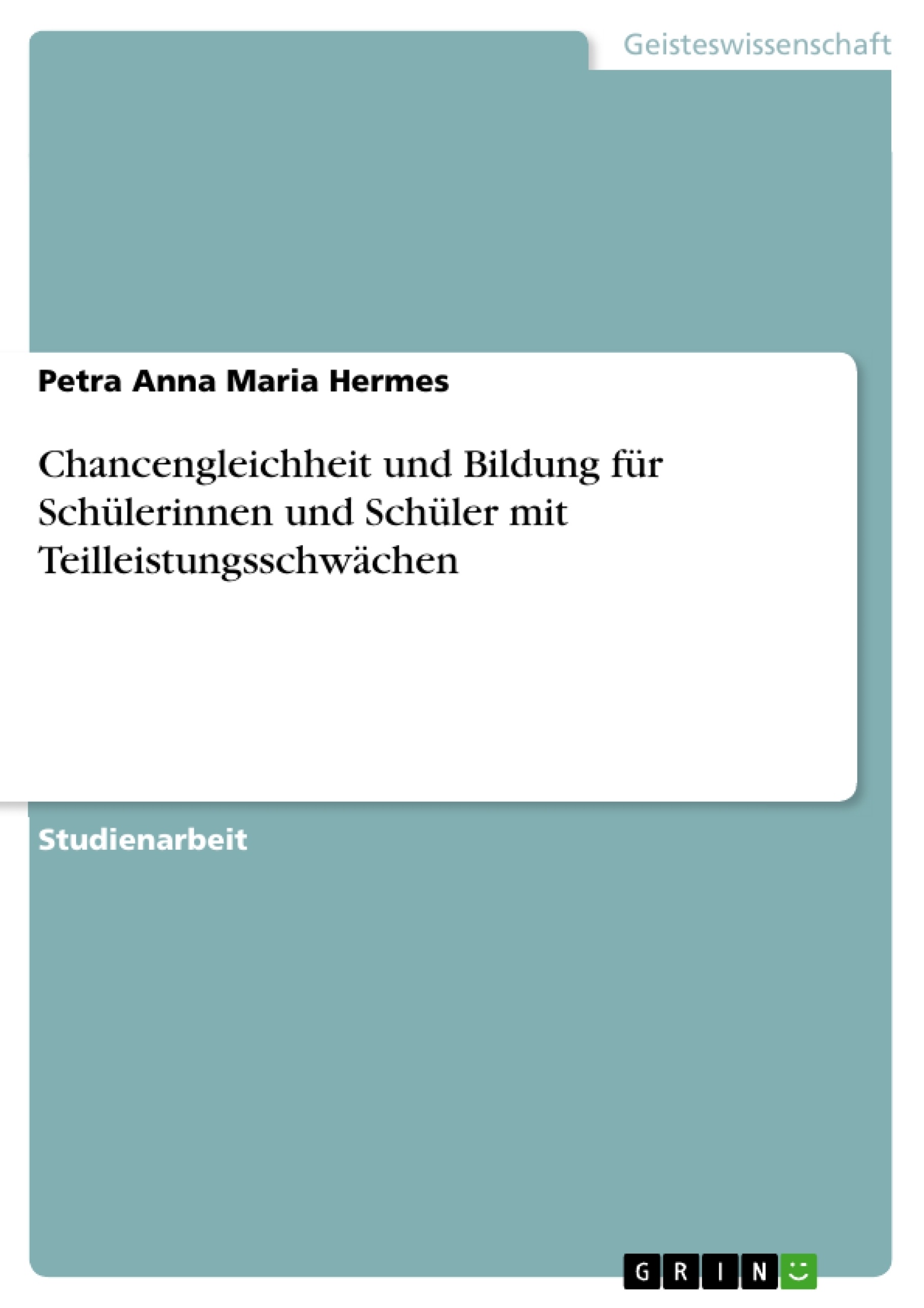Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich bezogen auf den Schultyp der Grundschulen im Bereich Förderung von Lernschwächen und deren Integration auf die Verbindung zwischen primären und sekundären Einflussfaktoren eingehen. Außerdem möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit soziale und persönliche Nachteile im Schulalltag Berücksichtigung finden. In dem Zusammenhang bezeichne ich alle Arten von Störungen, die verschiedensten Arten geistiger und körperlicher Beeinträchtigungen und die soziale Herkunft als primärer Ungleichheitsfaktor. Den Schwerpunkt lege ich hier auf die Lern- und Förderbedingungen für Kinder im Speziellen mit Verhaltensaufälligkeiten, die als soziale und emotionale Probleme zutage treten und eine Folge von „Teilleistungsstörungen“ sein können. Zunächst werde ich die Situation in Deutschland und vergleichend mit anderen europäischen Ländern, insbesondere Finnland, anhand statistischer Erhebungen beleuchten sowie partiell den dahinter stehenden finanziellen Aufwand. An einem Beispiel aus der Praxis im Bundesland Sachsen werde ich aufzeigen welche Fördermöglichkeiten im bestehenden System zur Verfügung stehen und wie sie in Anspruch genommen werden können. Die hier vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten setzen an den Veränderungen der bestehenden institutionellen und organisationsstrukturellen Eigenschaften an mit dem Ziel, die primären Ungleichheitsfaktoren außer Kraft zu setzten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Statistisches Material: ein Ländervergleich
- Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kinder mit Lernschwierigkeiten, Lernschwächen und Teilleistungsstörungen im bestehenden System?
- Begriffe
- Definitionen
- Psychische Folgen und Gemeinsamkeiten der beschriebenen Störungen
- Umsetzung von Fördermaßnahmen an den Schulen
- Beispiel aus der Praxis (anonymisiert)
- Beantragung der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
- Ablauf der Beantragung
- Aufgabenverteilung im Verfahren - Reflexion
- Schlussfolgerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Chancengleichheit und Bildung für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen. Sie untersucht die Verbindung zwischen primären und sekundären Einflussfaktoren auf die Förderung von Lernschwächen im Schultyp der Grundschulen. Insbesondere wird die Frage beleuchtet, inwieweit soziale und persönliche Nachteile im Schulalltag Berücksichtigung finden.
- Primäre und sekundäre Einflussfaktoren auf die Förderung von Lernschwächen in der Grundschule
- Soziale und persönliche Nachteile im Schulalltag
- Lern- und Förderbedingungen für Kinder mit Verhaltensaufälligkeiten und Teilleistungsstörungen
- Ländervergleich der Fördermöglichkeiten für Kinder mit Lernschwierigkeiten
- Realisierung von Chancengleichheit durch Veränderungen in den institutionellen und organisationsstrukturellen Eigenschaften des Bildungssystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Bedeutung von Bildung für die Lebenschancen von Menschen und beleuchtet die Ungleichheiten im Zugang zu Bildung, insbesondere in Deutschland. Sie führt die Begriffe „primäre“ und „sekundäre“ Ungleichheitsfaktoren ein und erklärt, wie diese durch das Bildungssystem entstehen. Die PISA-Studien werden als Auslöser für aktuelle Diskussionen über Bildung und soziale Ungleichheit erwähnt. Im Kontext dieser Debatte wird die Bedeutung von Chancengleichheit für Schüler mit Legasthenie oder Dyskalkulie hervorgehoben.
- Statistisches Material: ein Ländervergleich: Dieses Kapitel beleuchtet die Situation von Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Vergleich zu Finnland. Es zeigt statistische Zahlen zu Lernschwierigkeiten, Klassenwiederholungen, Förderbedürfnissen und Schulabschlüssen auf. Die Zahlen verdeutlichen den hohen finanziellen Aufwand, der für die Integration von Jugendlichen ohne Schulabschluss betrieben wird.
- Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kinder mit Lernschwierigkeiten, Lernschwächen und Teilleistungsstörungen im bestehenden System?: Dieses Kapitel definiert verschiedene Begriffe wie Teilleistungsstörungen, Rechenschwäche, Dyskalkulie und Legasthenie und stellt die verschiedenen Fördermöglichkeiten für Kinder mit Lernschwierigkeiten im bestehenden System vor.
- Beispiel aus der Praxis (anonymisiert): Dieses Kapitel erläutert die Beantragung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII anhand eines anonymisierten Praxisbeispiels im Bundesland Sachsen. Es beschreibt den Ablauf der Beantragung, die Aufgabenverteilung im Verfahren und zieht eine Schlussfolgerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Chancengleichheit, Bildung, Teilleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten, Förderung von Lernschwächen, primäre und sekundäre Ungleichheitsfaktoren, Integration, Schulsystem, Ländervergleich, Fördermöglichkeiten, Eingliederungshilfe, Praxisbeispiel. Die Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen von sozialen und persönlichen Nachteilen auf die Bildungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern mit Teilleistungsschwächen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind primäre und sekundäre Ungleichheitsfaktoren im Bildungssystem?
Primäre Faktoren umfassen geistige/körperliche Beeinträchtigungen und die soziale Herkunft. Sekundäre Faktoren entstehen durch die institutionellen Reaktionen des Schulsystems darauf.
Wie schneidet Deutschland im Vergleich zu Finnland bei der Förderung ab?
Statistische Erhebungen zeigen deutliche Unterschiede in der Integration und dem finanziellen Aufwand für Schüler mit Förderbedarf zwischen beiden Ländern.
Was ist die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII?
Es ist eine rechtliche Grundlage, über die Kinder mit (drohender) seelischer Behinderung, oft infolge von Teilleistungsstörungen, zusätzliche Förderung beantragen können.
Welche Teilleistungsstörungen werden in der Arbeit thematisiert?
Der Schwerpunkt liegt auf Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche) und Dyskalkulie (Rechenschwäche) sowie deren psychischen Folgen.
Welche Lösungsvorschläge bietet die Arbeit für mehr Chancengerechtigkeit?
Die Vorschläge setzen an Veränderungen der institutionellen und organisationsstrukturellen Eigenschaften des Bildungssystems an.
- Citar trabajo
- Sozialpädagogin B.A. Petra Anna Maria Hermes (Autor), 2008, Chancengleichheit und Bildung für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183955