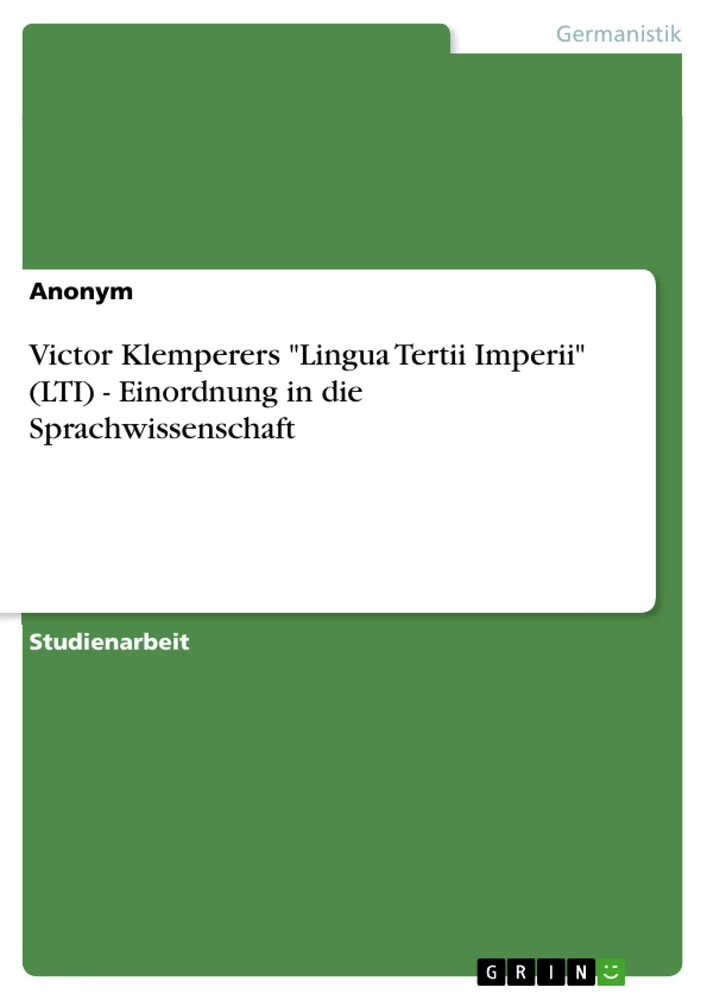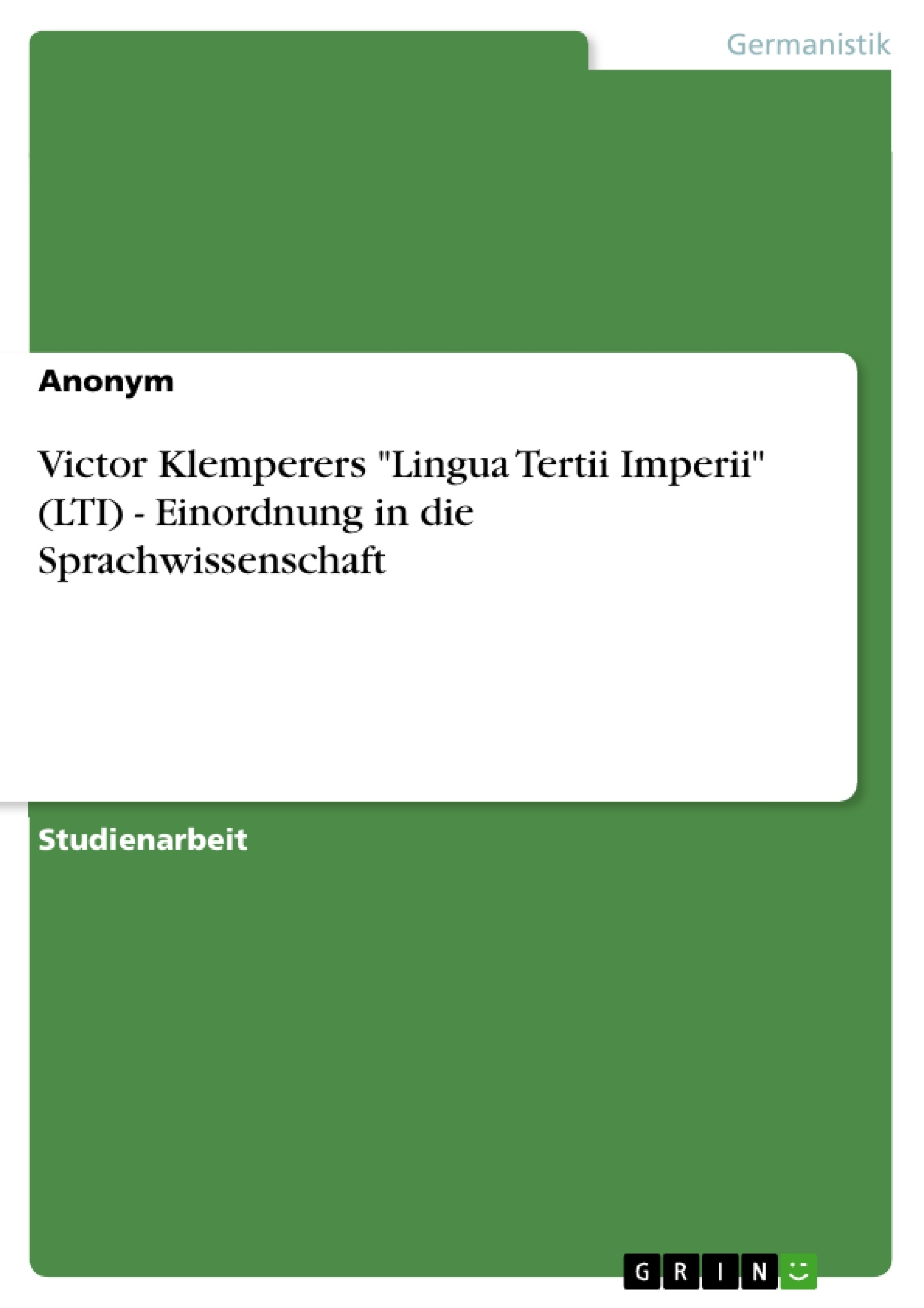Es ist mittlerweile nahezu obligatorisch, Beiträge über die Sprache im Nationalsozialismus mit dem Hinweis auf Victor Klemperers LTI (Lingua Tertii lmperii) zu eröffnen. Diese Feststellung dürfte Kenner der Thematik keineswegs überraschen: Bis zum heutigen Tag stellt das LTI einen zentralen Bezugspunkt der Forschung auf dem Gebiet Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus dar.
Vor diesem Kontext erscheint es durchaus angebracht, prüfen zu wollen, inwieweit K.s Werk tatsächlich auch dem Anspruch neuerer (sprachwissenschaftlicher) Forschung genügt- beziehungsweise, inwieweit es Wert für eine solche besitzen kann.
Demgegenüber steht die Befürchtung, es sei ein einmal etablierter und seither weitergereichter Duktus- wie auch immer gearteter- Thematisierungen zu NS-Deutsch, das LTI zu zitieren- unreflektiert und allein aus sich selbst begründet, gerade so, als gehöre dies
„zum guten Ton“.
Zu dieser Situation will die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten. Dabei soll wie folgt vorgegangen werden: An erster Stelle soll auf Entstehungsgeschichte und Inhalt des LTI eingegangen werden, wobei Autorintentionen und -methodik besonderes Augenmerk gelten soll. Vor dem Hintergrund dieser „Vorarbeiten“ soll in
einem nächsten Punkt die Genese des Forschungsgegenstandes Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus bis in die heutige Zeit betrachtet werden, mit einer Analyse, inwieweit sich das LTI innerhalb der Forschung einordnen und bewerten lässt. In einem
letzten Schritt sollen schließlich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und etwaige Schlüsse gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Das Phänomen LTI
- 1. Zum LTI
- 1.1. Entstehungsgeschichte
- 1.2. Motivation des Autors
- 1.3. Von den Tagebüchern zum LTI: Konzeptionelle Schwierigkeiten
- 1.4. Das Endprodukt LTI
- 2. Der Forschungsgegenstand Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus
- 2.1. Moralisierende Sprachkritik und Wörterbuchphilologie
- 2.2. LTI als sprachkritische Arbeit
- 2.3. Strukturalistische Wende und Sprache im Nationalsozialismus
- 2.4. Jüngere Forschungsansätze seit Mitte der achtziger Jahre
- 2.5. Rezeption des LTI bis heute
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Victor Klemperers "LTI" im Kontext der sprachwissenschaftlichen Forschung zum Nationalsozialismus. Ziel ist es, die Einordnung und Bedeutung des Werkes innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion zu evaluieren und kritisch zu hinterfragen, ob und inwieweit es den Anforderungen neuerer sprachwissenschaftlicher Ansätze genügt.
- Die Entstehungsgeschichte und die Intentionen Klemperers
- Die Entwicklung des Forschungsgegenstands "Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus"
- Die Einordnung und Bewertung des LTI in der sprachwissenschaftlichen Forschung
- Die Rezeption und der Einfluss des LTI auf die heutige Forschung
- Eine kritische Auseinandersetzung mit der gängigen Zitierweise des LTI
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Das Phänomen LTI: Die Einleitung betont die zentrale Bedeutung von Klemperers "LTI" in der Forschung zur Sprache des Nationalsozialismus. Sie hebt Klemperers einzigartige Position als verfolgter Jude und Philologe hervor, die ihm einen besonderen Einblick und eine unvergleichliche Authentizität ermöglichten. Die Einleitung kritisiert die oberflächliche Rezeption des Werkes, die oft nur wenige bekannte Zitate zitiert, ohne den Gesamtkontext zu berücksichtigen. Die Arbeit soll daher Klemperers Werk im Lichte aktueller sprachwissenschaftlicher Ansätze neu bewerten.
1. Zum LTI: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des LTI, von Klemperers frühen Tagebüchern bis zur Veröffentlichung des Werkes 1947. Es wird die Entwicklung des Projekts im Kontext der nationalsozialistischen Herrschaft und der damit verbundenen Bedrohungen für Klemperer dargestellt. Es beleuchtet die Motivation des Autors und seine Methodik, wobei der Fokus auf der Beobachtung und Analyse der nationalsozialistischen Sprache liegt. Die Schwierigkeiten bei der Konzeption und Ausarbeitung des Werkes werden ebenfalls thematisiert.
2. Der Forschungsgegenstand Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung zum Nationalsozialismus. Es analysiert verschiedene Forschungsansätze, von der moralisierenden Sprachkritik bis hin zu strukturalistischen Perspektiven. Das Kapitel untersucht die Einordnung von Klemperers "LTI" in diese Forschungslandschaft und die Rezeption des Werkes von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Es beleuchtet den Einfluss und die Bedeutung des LTI für die aktuelle Forschung.
Schlüsselwörter
Victor Klemperer, LTI (Lingua Tertii Imperii), Sprache des Nationalsozialismus, Sprachwissenschaft, Sprachkritik, nationalsozialistische Propaganda, Wortbedeutung, Semantik, Zeitzeugenbericht, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu Victor Klemperers "LTI - Notizbuch eines Philologen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Victor Klemperers "LTI - Notizbuch eines Philologen" im Kontext der sprachwissenschaftlichen Forschung zum Nationalsozialismus. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte und Intentionen Klemperers, die Entwicklung des Forschungsgegenstandes "Sprache/Sprachgebrauch und Nationalsozialismus", die Einordnung und Bewertung des LTI in der sprachwissenschaftlichen Forschung, die Rezeption und den Einfluss des LTI auf die heutige Forschung und bietet eine kritische Auseinandersetzung mit der gängigen Zitierweise des LTI.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Die Einleitung stellt das Werk von Klemperer vor und kritisiert dessen oberflächliche Rezeption. Kapitel 1 behandelt die Entstehung des LTI, die Motivation Klemperers und die damit verbundenen Schwierigkeiten. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung zum Nationalsozialismus und die Einordnung des LTI in diesen Kontext. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit fokussiert auf die Entstehungsgeschichte und die Intentionen Klemperers, die Entwicklung des Forschungsgegenstands "Sprache und Sprachgebrauch im Nationalsozialismus", die Einordnung und Bewertung des LTI in der sprachwissenschaftlichen Forschung, die Rezeption und den Einfluss des LTI auf die heutige Forschung, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der gängigen Zitierweise des LTI.
Wie wird Klemperers "LTI" in der Arbeit eingeordnet?
Die Arbeit untersucht die Einordnung und Bedeutung von Klemperers "LTI" innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion und hinterfragt kritisch, ob und inwieweit es den Anforderungen neuerer sprachwissenschaftlicher Ansätze genügt. Sie beleuchtet Klemperers einzigartige Position als verfolgter Jude und Philologe und analysiert die Methodologie seiner sprachkritischen Arbeit.
Welche Forschungsansätze werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert verschiedene Forschungsansätze zur Sprache des Nationalsozialismus, beginnend mit der moralisierenden Sprachkritik und der Wörterbuchphilologie bis hin zu strukturalistischen Perspektiven und neueren Forschungsansätzen seit Mitte der achtziger Jahre. Sie beleuchtet die Entwicklung dieser Ansätze und die Rezeption des LTI in diesem Kontext.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Victor Klemperer, LTI (Lingua Tertii Imperii), Sprache des Nationalsozialismus, Sprachwissenschaft, Sprachkritik, nationalsozialistische Propaganda, Wortbedeutung, Semantik, Zeitzeugenbericht, Forschungsgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle Interessierten, die sich mit der Sprache des Nationalsozialismus, der Sprachwissenschaft und der Rezeption von Klemperers "LTI" auseinandersetzen möchten. Sie bietet einen umfassenden Überblick über den Forschungsstand und eine kritische Analyse des Werkes.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2010, Victor Klemperers "Lingua Tertii Imperii" (LTI) - Einordnung in die Sprachwissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182934