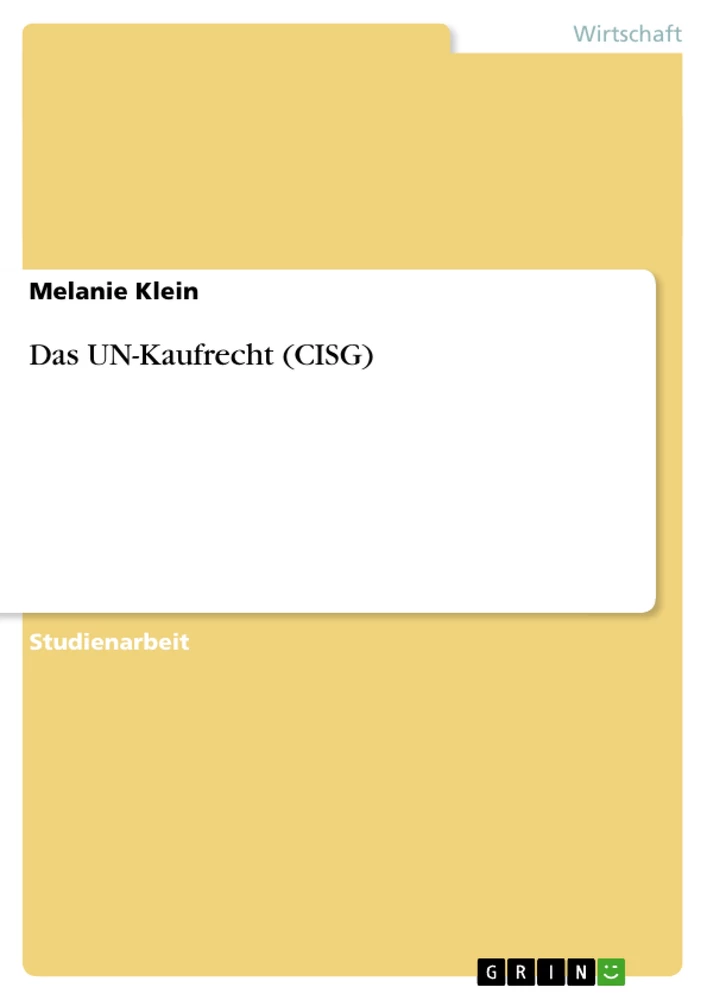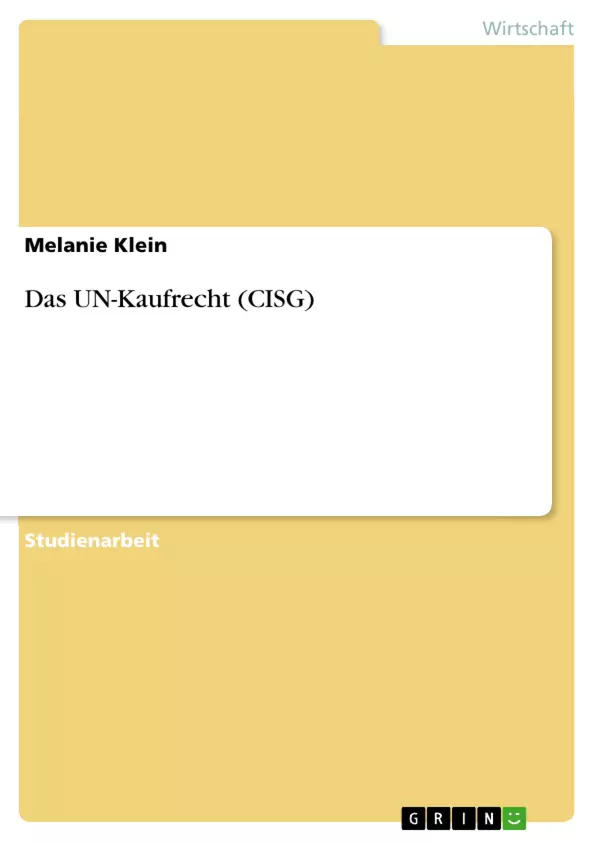„Dieser Vertrag unterliegt den Anwendungen des deutschen Rechts unter Ausschluss der Bestimmungen des EGBGB und des Wiener UN-Übereinkommens vom 11.April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).“ So oder so ähnlich lauten Regelungen in den Schlussbestimmungen über die Rechtswahl in vielen Verträ-gen und in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Unternehmen.
Warum wurde ein einheitliches Kaufrecht für grenzüberschreitende Kauf- und Werklie-ferungsverträge erstellt und was beinhaltet es? Wann findet es Anwendung? Welche Unterschiede bestehen zu den kaufrechtlichen Regelungen im BGB und im HGB und wieso wird die Anwendung des UN-Kaufrechts immer noch von vielen Unternehmen ausgeschlossen? Antworten auf diese Fragen werden im Rahmen dieser Seminararbeit beantwortet.
Zu Beginn werden die Entstehungsgeschichte der CISG sowie die Mitglieds-, Vorbe-halts- und Nichtvertragsstaaten aufgezeigt. Darauf folgend wird der Aufbau der CISG erklärt. Im zweiten Teil werden die Anwendungsbereiche des UN-Kaufrechts erläutert. Im dritten Teil erfolgt ein Vergleich zwischen deutschem Kaufrecht gemäß BGB und den Regelungen des Kaufrechts gemäß CISG. Am Schluss dieser Seminararbeit folgt im Rahmen des Fazits eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Entstehungsgeschichte der CISG
- 1.2 Mitgliedsstaaten
- 1.3 Aufbau CISG
- 2. Anwendungsbereich
- 2.1 Sachlicher Anwendungsbereich
- 2.2 Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich
- 2.3 Zeitlicher Anwendungsbereich
- 2.4 Abdingbarkeit des UN-Kaufrechts
- 2.5 Regelungslücken
- 3. Unterschiede zwischen BGB und CISG
- 3.1 Abgebot und Annahme
- 3.2 Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- 3.3 Kaufmännisches Bestätigungsschreiben
- 3.4 Leistungsstörung
- 3.4.1 Sachmangel
- 3.4.2 Rechtsmangel
- 3.4.3 Schadensersatz
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das UN-Kaufrecht (CISG), seine Entstehungsgeschichte, seinen Anwendungsbereich und die Unterschiede zu den Regelungen des deutschen BGB. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des CISG zu vermitteln und seine Bedeutung im internationalen Handelsrecht zu beleuchten.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des CISG
- Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts (sachlich, räumlich, persönlich, zeitlich)
- Vergleich des CISG mit dem deutschen BGB im Kaufrecht
- Abdingbarkeit und Regelungslücken des UN-Kaufrechts
- Bedeutung des CISG im internationalen Warenverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die Relevanz des UN-Kaufrechts (CISG) im Kontext internationaler Handelsverträge und stellt die Forschungsfragen der Arbeit vor. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Themen, nämlich die Entstehungsgeschichte der CISG, ihre Anwendungsbereiche und die Unterschiede zum deutschen BGB.
2. Anwendungsbereich: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den verschiedenen Aspekten des Anwendungsbereichs des UN-Kaufrechts. Es differenziert zwischen dem sachlichen, räumlichen, persönlichen und zeitlichen Anwendungsbereich, wobei die Kriterien für die Anwendbarkeit des CISG präzise dargelegt werden. Der Fokus liegt auf der Klärung, unter welchen Voraussetzungen das Übereinkommen Anwendung findet und welche Verträge davon erfasst werden. Die Diskussion über die Abdingbarkeit und die Behandlung von Regelungslücken ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieses Kapitels, welche die Flexibilität und Grenzen des UN-Kaufrechts beleuchten.
3. Unterschiede zwischen BGB und CISG: In diesem Kapitel werden die zentralen Unterschiede zwischen dem deutschen Kaufrecht (BGB) und dem UN-Kaufrecht (CISG) analysiert. Es werden detailliert die jeweiligen Regelungen zu Abgebot und Annahme, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kaufmännischen Bestätigungsschreiben und Leistungsstörungen (inkl. Sach- und Rechtsmangel sowie Schadensersatz) verglichen. Der Vergleich verdeutlicht die jeweiligen Vor- und Nachteile der Rechtsordnungen und zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen ergeben. Die Analyse dient dazu, die Besonderheiten des CISG im Detail zu beleuchten und dessen Bedeutung für den internationalen Handel zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
UN-Kaufrecht (CISG), internationales Kaufrecht, Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, BGB, Anwendungsbereich, Leistungsstörung, Sachmangel, Rechtsmangel, Schadensersatz, Allgemeine Geschäftsbedingungen, kaufmännisches Bestätigungsschreiben, Vergleich Deutsches Recht – CISG, internationale Handelsverträge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: UN-Kaufrecht (CISG)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über das UN-Kaufrecht (CISG), einschließlich seiner Entstehungsgeschichte, seines Anwendungsbereichs und der Unterschiede zu den Regelungen des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des CISG und seiner Bedeutung im internationalen Handelsrecht zu vermitteln.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des CISG, den Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts (sachlich, räumlich, persönlich, zeitlich), einen Vergleich des CISG mit dem deutschen BGB im Kaufrecht, die Abdingbarkeit und Regelungslücken des UN-Kaufrechts sowie die Bedeutung des CISG im internationalen Warenverkehr.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Relevanz des CISG im Kontext internationaler Handelsverträge erläutert und die Forschungsfragen vorstellt. Es folgen Kapitel zum Anwendungsbereich des CISG (sachlich, räumlich, persönlich, zeitlich), einem detaillierten Vergleich zwischen BGB und CISG in Bezug auf Abgebot und Annahme, Allgemeine Geschäftsbedingungen, kaufmännische Bestätigungsschreiben und Leistungsstörungen (Sach- und Rechtsmangel, Schadensersatz), und schließlich ein Fazit.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel. Die Einleitung erläutert die Relevanz des CISG und stellt die Forschungsfragen vor. Das Kapitel zum Anwendungsbereich beschreibt detailliert die Kriterien für die Anwendbarkeit des CISG. Das Kapitel zum Vergleich zwischen BGB und CISG analysiert die zentralen Unterschiede in den jeweiligen Regelungen zu Abgebot und Annahme, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kaufmännischen Bestätigungsschreiben und Leistungsstörungen.
Welche Unterschiede zwischen dem BGB und dem CISG werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht detailliert die Regelungen des BGB und des CISG zu Abgebot und Annahme, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kaufmännischen Bestätigungsschreiben und Leistungsstörungen (einschließlich Sach- und Rechtsmangel sowie Schadensersatz). Dieser Vergleich verdeutlicht die Vor- und Nachteile beider Rechtsordnungen und die Herausforderungen, die sich aus der Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen ergeben.
Wie wird der Anwendungsbereich des CISG definiert?
Das Kapitel zum Anwendungsbereich des CISG differenziert zwischen dem sachlichen, räumlichen, persönlichen und zeitlichen Anwendungsbereich. Es werden die Kriterien für die Anwendbarkeit des CISG präzise dargelegt, unter welchen Voraussetzungen das Übereinkommen Anwendung findet und welche Verträge davon erfasst werden. Die Abdingbarkeit und die Behandlung von Regelungslücken werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Seminararbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen UN-Kaufrecht (CISG), internationales Kaufrecht, Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, BGB, Anwendungsbereich, Leistungsstörung, Sachmangel, Rechtsmangel, Schadensersatz, Allgemeine Geschäftsbedingungen, kaufmännisches Bestätigungsschreiben, Vergleich Deutsches Recht – CISG, und internationale Handelsverträge.
- Citar trabajo
- Melanie Klein (Autor), 2011, Das UN-Kaufrecht (CISG), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182343