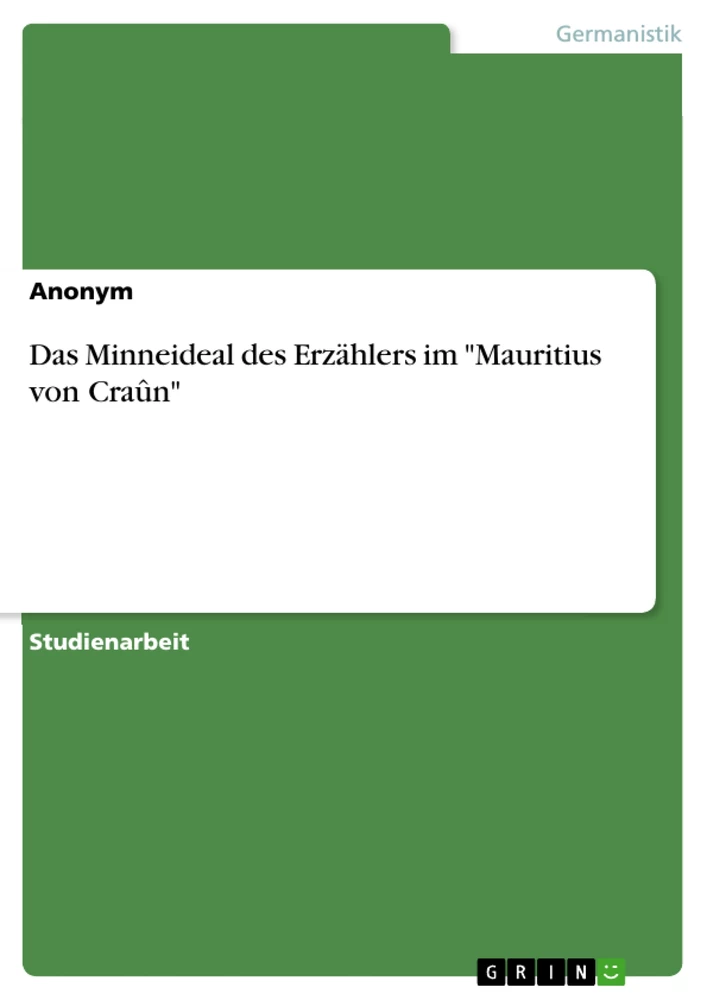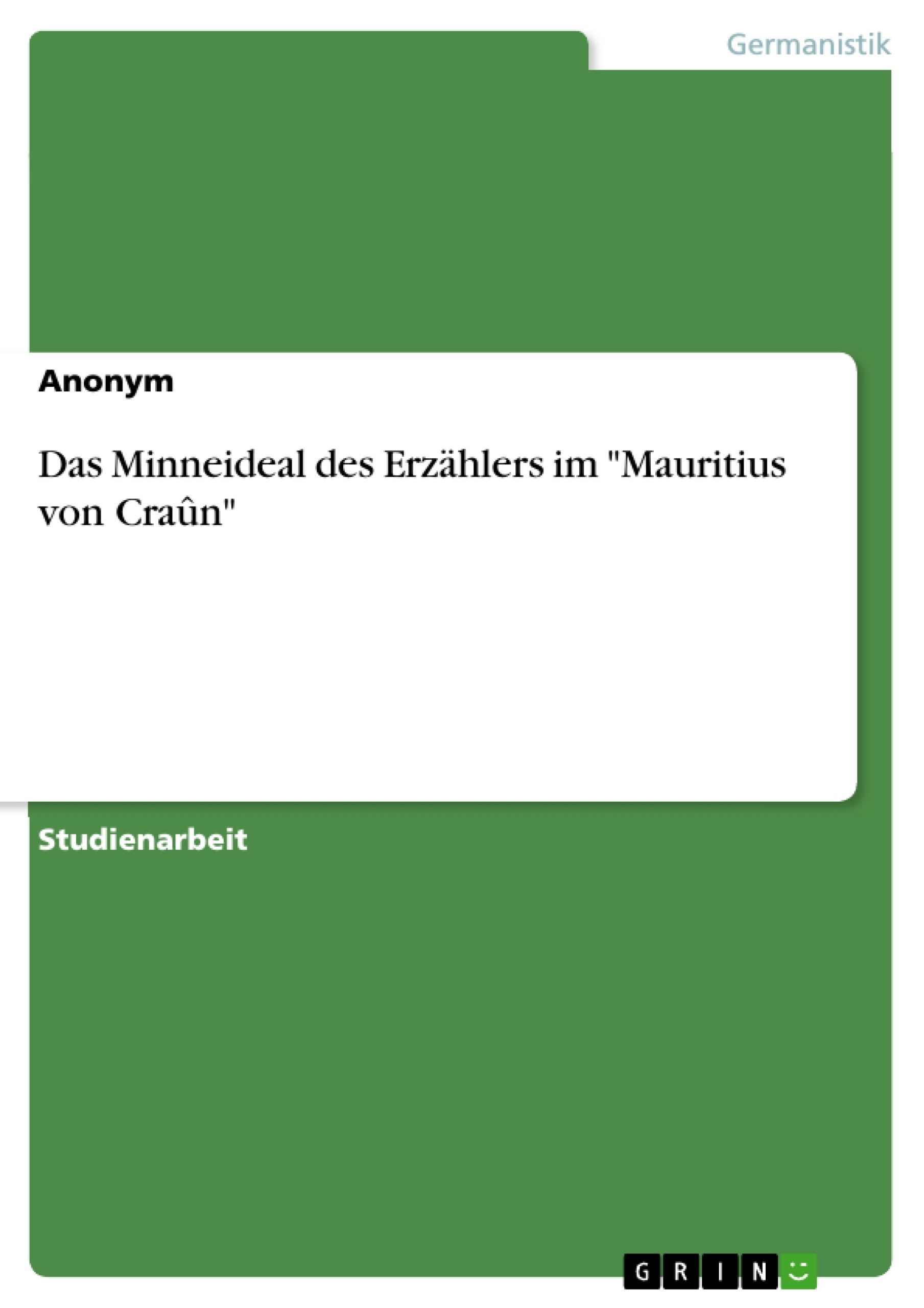Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die Forschung mit der vielschichtigen Erzählung Mauritius von Craûn. Dabei stellte sich als problematisch heraus, dass Zeit und Ort des Entstehens nur eingegrenzt werden können (zwischen 1180/90 und 1230/40 ), der Verfasser unbekannt und die vermutlich altfranzösische Vorlage verloren gegan-gen ist.
Auch in Folge der äußeren Umstände gibt es kontroverse Beurteilungen zum inter-pretatorischen Verständnis des Textes. So gibt es weit auseinander gehende Ansich-ten, vor allem zur Bedeutung der Minnehandlung. Für den einen fungiert die Novelle als exemplum und „fordert zur Kritik an den handelnden Personen auf und versucht […] letztlich die Angehörigen des angevinischen Hochadels zu treffen“ , für den anderen liest sich der Mauritius „als prinzipielle Warnung vor der minne“ .
In der folgenden Auseinandersetzung soll daher versucht werden das Minneideal des Erzählers zu analysieren. Dabei möchte ich zunächst den Minnediskurs betrachten und diesen mit dem Ideal der Hohen Minne vergleichen. In einem weiteren Punkt wird geprüft, ob der Erzähler diesem, zu Beginn der Novelle vorgestellten Ideal, im weiteren Verlauf treu bleibt. Bei beiden Punkten wird untersucht, nach welchem Minneideal die Protagonisten agieren und wie sich dieses entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Minnediskurs des Erzählers
- Die weitere Entwicklung der Minnehandlung
- Der Klagemonolog des Mauritius
- Der Vertrag
- Der Schlaf des Mauritius
- Die Einforderung des Minnelohns
- Die Minneklage der Gräfin
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Minneideal des Erzählers in der Novelle „Mauritius von Craûn“. Der Fokus liegt auf der Erörterung des Minnediskurses und der Frage, ob der Erzähler seinem zu Beginn der Novelle vorgestellten Ideal im weiteren Verlauf treu bleibt. Dabei werden die Minnehandlungen der Protagonisten und deren Entwicklung untersucht.
- Der Minnediskurs des Erzählers und seine Verbindung zur Hohen Minne
- Die Entwicklung des Minneideals im Verlauf der Erzählung
- Die Rolle der Gräfin als Minnedame
- Die Bedeutung des Minnelohns und seine Abweichung vom traditionellen Ideal
- Die Auswirkungen des Minnedienstes auf den Protagonisten Mauritius
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung und Interpretation der Novelle „Mauritius von Craûn“. Es werden die Herausforderungen der Textinterpretation und die kontroversen Ansichten zur Bedeutung der Minnehandlung aufgezeigt. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Minneideal des Erzählers zu analysieren und dessen Entwicklung im Verlauf der Erzählung zu untersuchen.
Der Minnediskurs des Erzählers stellt die Ansicht des Erzählers zum Wert der „stæter minne“ dar. Er warnt vor den Mühen und dem Schaden, die mit dieser aufopferungsvollen Aufgabe verbunden sind, betont aber gleichzeitig den reichen Lohn, der durch Treue und Ausdauer erlangt werden kann. Der Erzähler stellt das Ideal des vorbildlichen Minnedieners und Musterritters Mauritius vor, der sich durch Ruhm, Treue und ritterliche Tugenden auszeichnet.
Im Klagemonolog des Mauritius wird die Verzweiflung des Protagonisten über die Feindseligkeit der Minnedame deutlich. Er beklagt die Vergeblichkeit seines Dienstes und hadert mit dem Schicksal. Die traditionelle Vorstellung vom Minnedienst wird in Frage gestellt, da Mauritius verzweifelt und heftig auf die Erfüllung seiner Wünsche besteht. Die Gräfin wird als Minnedame stilisiert, die den Ritter ignoriert und ihn in seiner misslichen Lage gefangen hält.
Der Vertrag zwischen Mauritius und der Gräfin stellt einen Bruch mit dem traditionellen Minneideal dar. Die Gräfin verspricht Minnelohn, wenn Mauritius ihr einen letzten Dienst erweist. Das Abkommen wird mit Ring, Kuss und Umarmung besiegelt, was die „geselleclîche minne“ als Belohnung für geleisteten Dienst ausschließt.
Mauritius erweist sich während des Turniers als der beste und ruhmreichste Ritter. Allerdings hat er durch seine übertriebenen Anstrengungen und egoistisches Verhalten Schuld auf sich geladen. Die Handlung des Turniers nach dem Tod eines Ritters steht im Widerspruch zum traditionellen Minneideal.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Minneideal, die „stæter minne“, die Hohe Minne, der Minnediskurs, der Minnedienst, der Minnelohn, die Gräfin als Minnedame, der Protagonist Mauritius, die Entwicklung des Minneideals, die Abweichung vom traditionellen Minneideal, die Kritik an der Minnehandlung und die Interpretation der Novelle „Mauritius von Craûn“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2006, Das Minneideal des Erzählers im "Mauritius von Craûn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180951