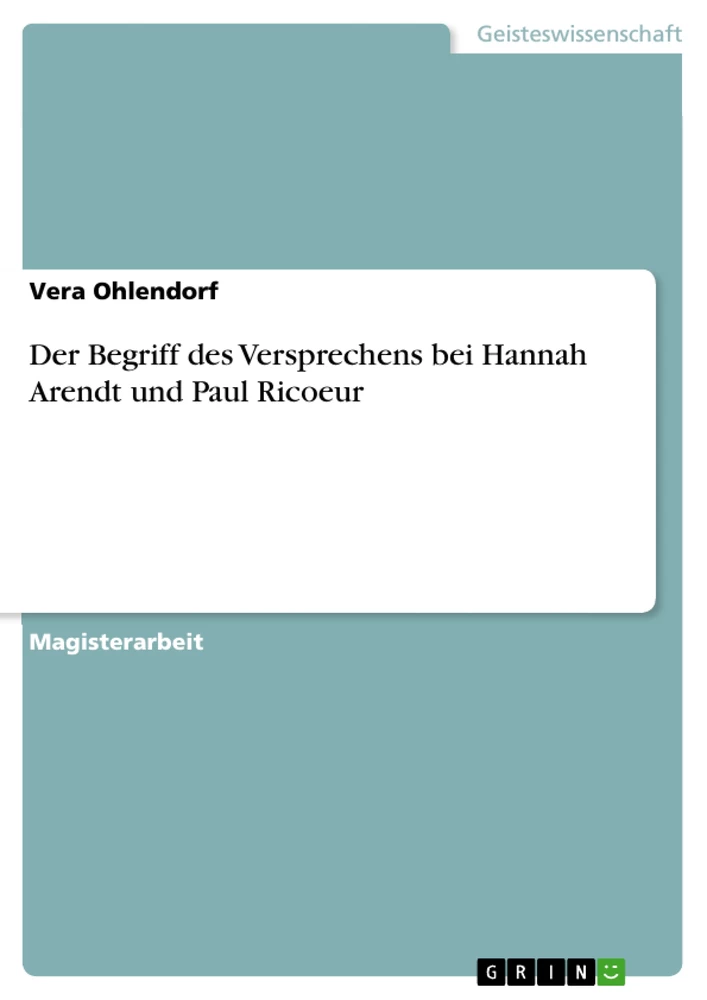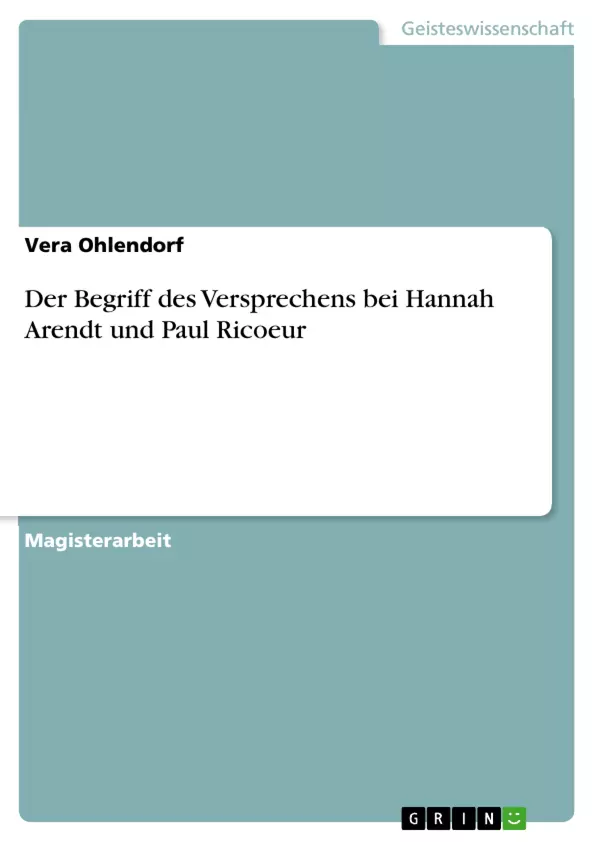Versprechen werden im Alltag in den verschiedensten Kontexten gegeben, gehalten und gebrochen. Durch sein Wort legt sich der Versprechende darauf fest, zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Handlung auszuführen bzw. zu unterlassen. Obwohl die Erfüllung von Versprechen im alltäglichen Kontext nicht einklagbar ist und kein explizites Gesetz das Halten des gegebenen Wortes vorschreibt, ist man im Allgemeinen davon überzeugt, dass Versprechen gehalten werden müssen.
Zugleich ist es aber grundsätzlich unmöglich, die Zukunft vorherzusehen und zu beherrschen. Innerhalb der Zeitspanne zwischen dem Geben und dem Einlösen von Versprechen können sich die Umstände so ändern, dass das Einhalten unmöglich wird.
In der vorliegenden Arbeit werden die Konzeptionen von Hannah Arendt und Paul Ricœur Gegenstand der Untersuchung sein, die versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Zuvor werde ich jedoch näher auf den Versprechensbegriff David Humes eingehen. Seine Untersuchung steht exemplarisch in der neuzeitlichen Tradition des Gesellschaftsvertrages, die einen eigenen Lösungsansatz für diese Probleme zu geben versucht.
Die Verbindlichkeit von Versprechen ergibt sich für Hannah Arendt aus der grundsätzlichen Bedingtheit menschlichen Lebens. Menschen sind keine selbstgenügsamen Individuen, die aus Nützlichkeitserwägungen heraus mit Anderen Kooperationsbeziehungen eingehen. Das Handeln definiert sie als die spezifisch menschliche Tätigkeit, die der Grundbedingung der Pluralität des menschlichen Lebens entspricht und die Einzigartigkeit einer Person in Interaktion mit der Mitwelt hervorbringt.
Paul Ricœur schließt an Arendt an und begreift das Versprechen als Modus der Selbst-Bezeugung. Das Wer einer Person ist nicht unmittelbar präsent, es kann nicht direkt durch Reflexion erfasst werden, sondern bezeugt sich indirekt über die Existenzerfahrungen des Handelns in der Welt. Jede Person konstituiert und bezeugt ihr Selbst vermittels der Praxen, an denen sie teilhat und innerhalb derer sie ihre Fähigkeiten verwirklicht. Die Bezeugung des Selbst in den vielfältigen Formen des Handelns ist irreduzibel an den Anderen adressiert und auf ihn angewiesen. Versprechen können laut Ricœur nur dank des Anderen geben, der das Selbst zur ethischen Fürsorge bzw. zur Verantwortung aufruft und in Anspruch nimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. David Hume: Versprechen als Konvention
- 1.1. Affekte, Vernunft, und natürliche Tugenden
- 1.2. Künstliche Tugenden: Three Laws of Nature
- 1.3. Versprechen durch Übereinkunft?
- 1.4. Die Fiktion personaler Identität
- 2. Hannah Arendt: Versprechen als Konstituens des Handelns
- 2.1. Die menschliche Bedingtheit und die drei Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen, Handeln
- 2.2. Handeln: die politische Tätigkeit
- 2.3. Die Verbindlichkeit des Versprechens gegen die Aporien des Handelns
- 2.4. Ist das Halten von Versprechen eine moralische Norm?
- 2.5. Versprechen und personale Identität
- 3. Paul Ricœur: Versprechen als Selbst-Bezeugung
- 3.1. Die Hermeneutik des Selbst
- 3.2. Versprechen als Sprechhandlung
- 3.3. Selbigkeit und Selbstheit
- 3.4. Versprechen als ethische Ausrichtung und moralische Pflicht
- 3.5. Die Ontologie des Selbst
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit dem philosophischen Konzept des Versprechens und untersucht die Positionen von Hannah Arendt und Paul Ricœur in diesem Kontext. Das Ziel ist es, die verschiedenen Bedeutungen und Implikationen des Versprechens im Hinblick auf Handeln, Selbstbestimmung und ethische Verpflichtungen zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit wird den anthropologischen Voraussetzungen der Versprechensfähigkeit sowie der Frage nach der Verbindlichkeit von Versprechen im gesellschaftlichen und politischen Kontext gewidmet.
- Das Versprechensphänomen in seiner Bedeutung für menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Strukturen
- Die Rolle des Versprechens im Kontext des Handelns und der politischen Tätigkeit
- Die Verbindlichkeit von Versprechen aus ethischer und philosophischer Perspektive
- Die Frage der Selbstverpflichtung und der Konstituierung von Identität durch Versprechen
- Die Verbindung zwischen dem Sprechakt des Versprechens und seiner ontologischen Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung des Versprechens im Alltag und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor.
- Kapitel 1 analysiert die Konzeption des Versprechens bei David Hume und untersucht die Rolle der Konvention und der Fiktion personaler Identität in diesem Kontext.
- Kapitel 2 behandelt die Position von Hannah Arendt, die das Versprechen als Konstituens des Handelns betrachtet und die Verbindlichkeit von Versprechen in Bezug auf die politische Sphäre untersucht.
- Kapitel 3 untersucht die Hermeneutik des Selbst bei Paul Ricœur und analysiert die Rolle des Versprechens als Sprechhandlung und ethische Ausrichtung.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit thematisiert Schlüsselbegriffe wie Versprechen, Handeln, Selbstbestimmung, Verbindlichkeit, ethische Verantwortung, Identität, Sprechhandlung und Hermeneutik. Die zentralen Autoren, die im Fokus der Untersuchung stehen, sind Hannah Arendt, Paul Ricœur und David Hume. Die Arbeit erörtert die philosophischen Konzepte des Versprechens im Hinblick auf ihre anthropologischen, ethischen und politischen Implikationen.
- Quote paper
- Vera Ohlendorf (Author), 2009, Der Begriff des Versprechens bei Hannah Arendt und Paul Ricoeur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180667