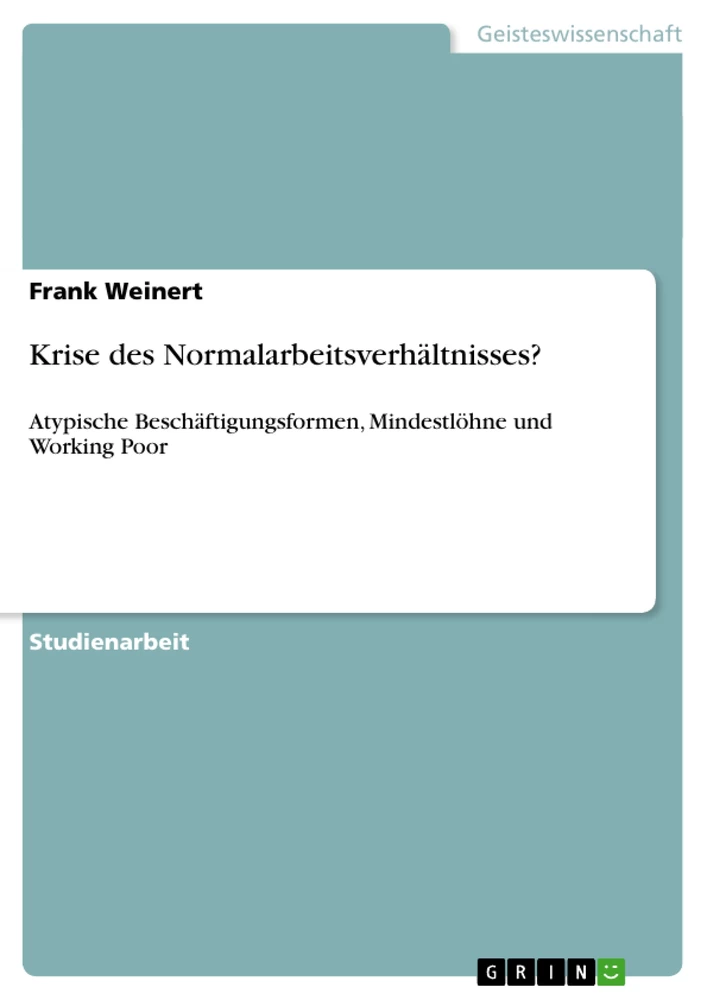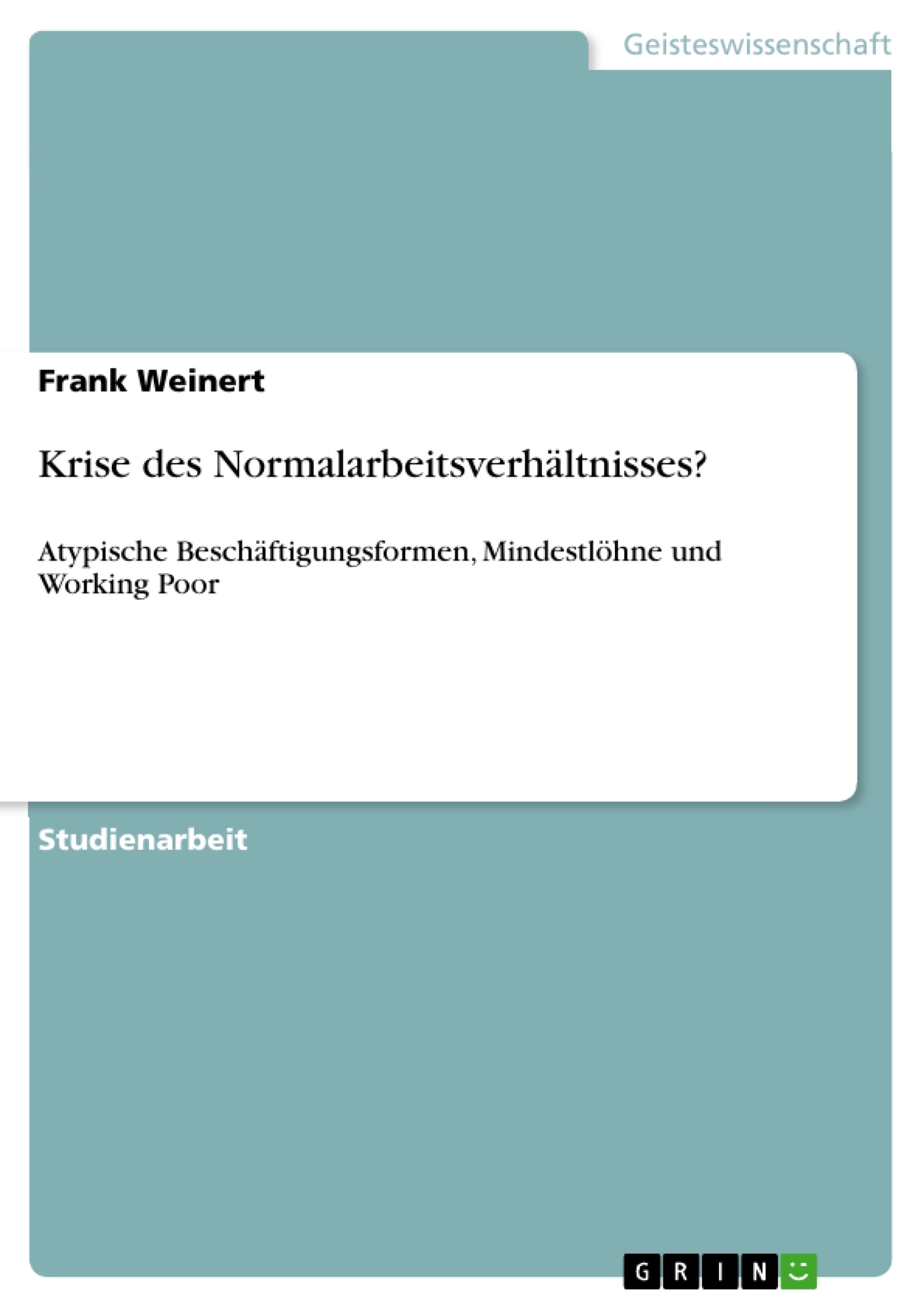Bereits in den 1990gern beschäftigten sich Wissenschaftler mit der Frage, ob sich das Normalarbeitsverhältnis in der Krise befindet. Gemeint ist damit die Zunahme von atypischen Beschäftigungsformen und die Reduktion der Normalarbeitsverhältnisse.
Diese Arbeit versucht zunächst Arbeitsverhältnisse in die Kategorien „Normalarbeitsverhältnis“ und „atypische Beschäftigungsform“ einzuteilen. Anschließend werden die in der Literatur besprochenen Kriterien einer sozialverträglichen und einer prekären Beschäftigung angeführt. Wobei der Begriff der Prekarität sich an der Umschreibung des Duden orientiert. Der Duden umschreibt den Begriff prekär unter anderem mit den Worten misslich, haarig und schwierig (www.duden.de 23.11.2010). Bei der Einteilung in eine prekäre Form wird sich an den Gedanken von Keller und Seifert (2009) orientiert (vgl. 2.3). In einem nächsten Schritt werden die Entwicklungen der einzelnen Formen beschrieben, um schließlich die Fragestellung zu beantworten: Welche Formen der atypischen Beschäftigung sind sozialverträglich und welche hemmen die Entwicklung des Gemeinwesens? Schließlich, welche Regulierungsmaßnahmen werden diskutiert und erscheinen dem Autor sinnvoll. Unterstützt wird die Argumentation an den geeigneten Stellen durch Ergebnisse aus empirischen Studien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Das Normalarbeitsverhältnis
- 1.2 Atypische Beschäftigung
- 2. Betroffene von der Krise des Normalarbeitsverhältnisses
- 2.1 Entwicklung und Ausmaß von atypischer Beschäftigung
- 2.2 Ursachen der Ausweitung
- 2.3 Folgen von atypischer Beschäftigung
- 3. Regulierungsmöglichkeiten
- 3.1 Mindestlöhne
- 3.2 Tariflöhne und das Gent-System
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Krise des Normalarbeitsverhältnisses im Kontext der Zunahme atypischer Beschäftigungsformen. Sie analysiert die Entwicklung und das Ausmaß atypischer Beschäftigung, untersucht die Ursachen ihrer Ausweitung und die daraus resultierenden Folgen. Die Arbeit beleuchtet außerdem verschiedene Regulierungsmöglichkeiten, insbesondere Mindestlöhne, und bewertet deren Sinnhaftigkeit.
- Entwicklung und Ausmaß atypischer Beschäftigung in Deutschland
- Ursachen für die Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen
- Folgen atypischer Beschäftigung für Arbeitnehmer und Gesellschaft
- Diskussion verschiedener Regulierungsmöglichkeiten
- Bewertung der Sozialverträglichkeit atypischer Beschäftigungsformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Krise des Normalarbeitsverhältnisses ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach sozialverträglichen und sozialschädlichen Formen atypischer Beschäftigung. Sie definiert die Begriffe „Normalarbeitsverhältnis“ und „atypische Beschäftigungsform“ anhand bestehender Literatur und Kriterien für prekäre und sozialverträgliche Beschäftigung. Der Duden-Begriff von „prekär“ dient als Referenzpunkt, ebenso die Arbeiten von Keller und Seifert (2009). Die Einleitung skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit und die Methodik, welche die Argumentation durch empirische Studien stützt.
2. Betroffene von der Krise des Normalarbeitsverhältnisses: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Ausweitung atypischer Beschäftigung in Deutschland im europäischen Vergleich. Es wird dargelegt, wie atypische Beschäftigungsformen das Normalarbeitsverhältnis beeinflussen (Keller und Seifert 2009). Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Ausmaß atypischer Beschäftigung, insbesondere Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 21 Wochenstunden und geringfügiger Beschäftigung. Die Überlappung dieser beiden Formen und deren Relevanz für arbeitsmarktregulierende Entscheidungen wird hervorgehoben. Das Kapitel behandelt auch den stark wachsenden Niedriglohnsektor in Deutschland und dessen Zusammenhang mit atypischer Beschäftigung, wobei die Kriterien der Einkommenssicherheit und Beschäftigungsstabilität im Kontext der Sozialverträglichkeit betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung, Mindestlohn, Prekarität, Sozialverträglichkeit, Teilzeitbeschäftigung, Geringfügige Beschäftigung, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarktentwicklung, Regulierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Krise des Normalarbeitsverhältnisses
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Krise des Normalarbeitsverhältnisses im Kontext der Zunahme atypischer Beschäftigungsformen. Sie analysiert die Entwicklung und das Ausmaß atypischer Beschäftigung, die Ursachen ihrer Ausweitung und die daraus resultierenden Folgen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Regulierungsmöglichkeit von Mindestlöhnen und deren Sinnhaftigkeit.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Entwicklung und Ausmaß atypischer Beschäftigung in Deutschland im europäischen Vergleich, Ursachen für die Ausweitung atypischer Beschäftigungsformen, Folgen atypischer Beschäftigung für Arbeitnehmer und Gesellschaft, Diskussion verschiedener Regulierungsmöglichkeiten (insbesondere Mindestlöhne), und eine Bewertung der Sozialverträglichkeit atypischer Beschäftigungsformen. Dabei werden Teilzeitbeschäftigung (unter 21 Wochenstunden), geringfügige Beschäftigung und der Niedriglohnsektor besonders betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein, definiert zentrale Begriffe wie „Normalarbeitsverhältnis“ und „atypische Beschäftigung“, und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Betroffene der Krise) analysiert die Entwicklung atypischer Beschäftigung, deren Ausmaß und die Auswirkungen auf das Normalarbeitsverhältnis. Es beleuchtet den Niedriglohnsektor und die Kriterien für Einkommenssicherheit und Beschäftigungsstabilität. Kapitel 3 (Regulierungsmöglichkeiten) diskutiert verschiedene Regulierungsansätze, insbesondere Mindestlöhne und das Gent-System. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Begriffe werden in der Arbeit zentral verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung, Mindestlohn, Prekarität, Sozialverträglichkeit, Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, Niedriglohnsektor, Arbeitsmarktentwicklung und Regulierung.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Argumentation der Arbeit stützt sich auf empirische Studien.
Welche Literatur wird verwendet?
Als Referenzpunkte dienen der Duden-Begriff von „prekär“ sowie die Arbeiten von Keller und Seifert (2009).
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage betrifft die Unterscheidung zwischen sozialverträglichen und sozialschädlichen Formen atypischer Beschäftigung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Verwendung gedacht, zur Analyse von Themen im Zusammenhang mit Arbeitsmarkt und Beschäftigungsformen.
- Arbeit zitieren
- Frank Weinert (Autor:in), 2010, Krise des Normalarbeitsverhältnisses?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180137