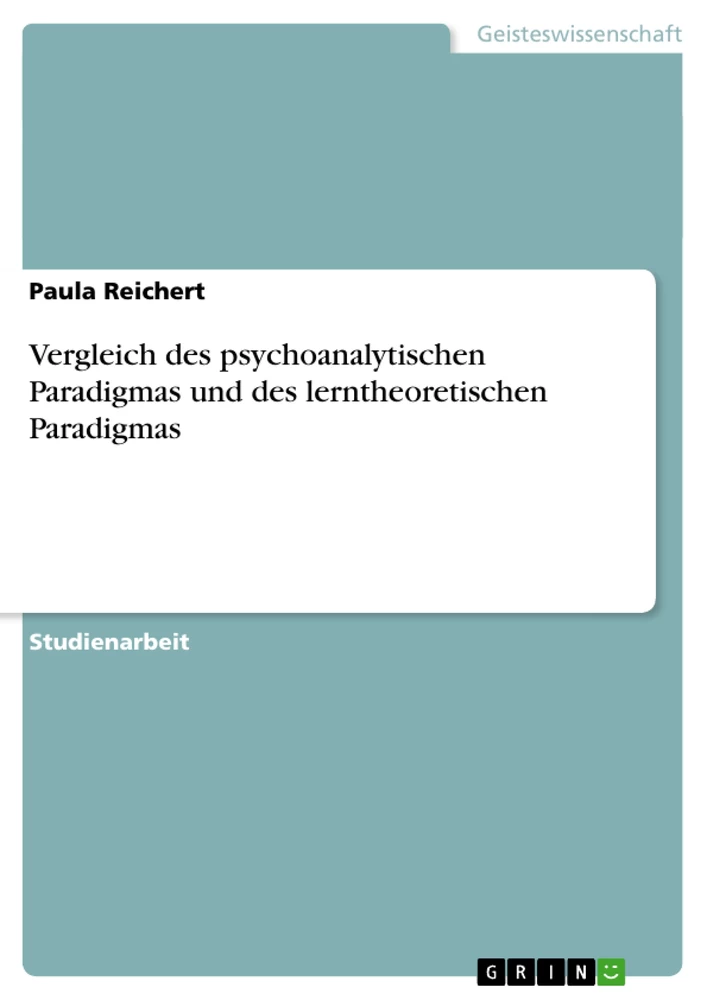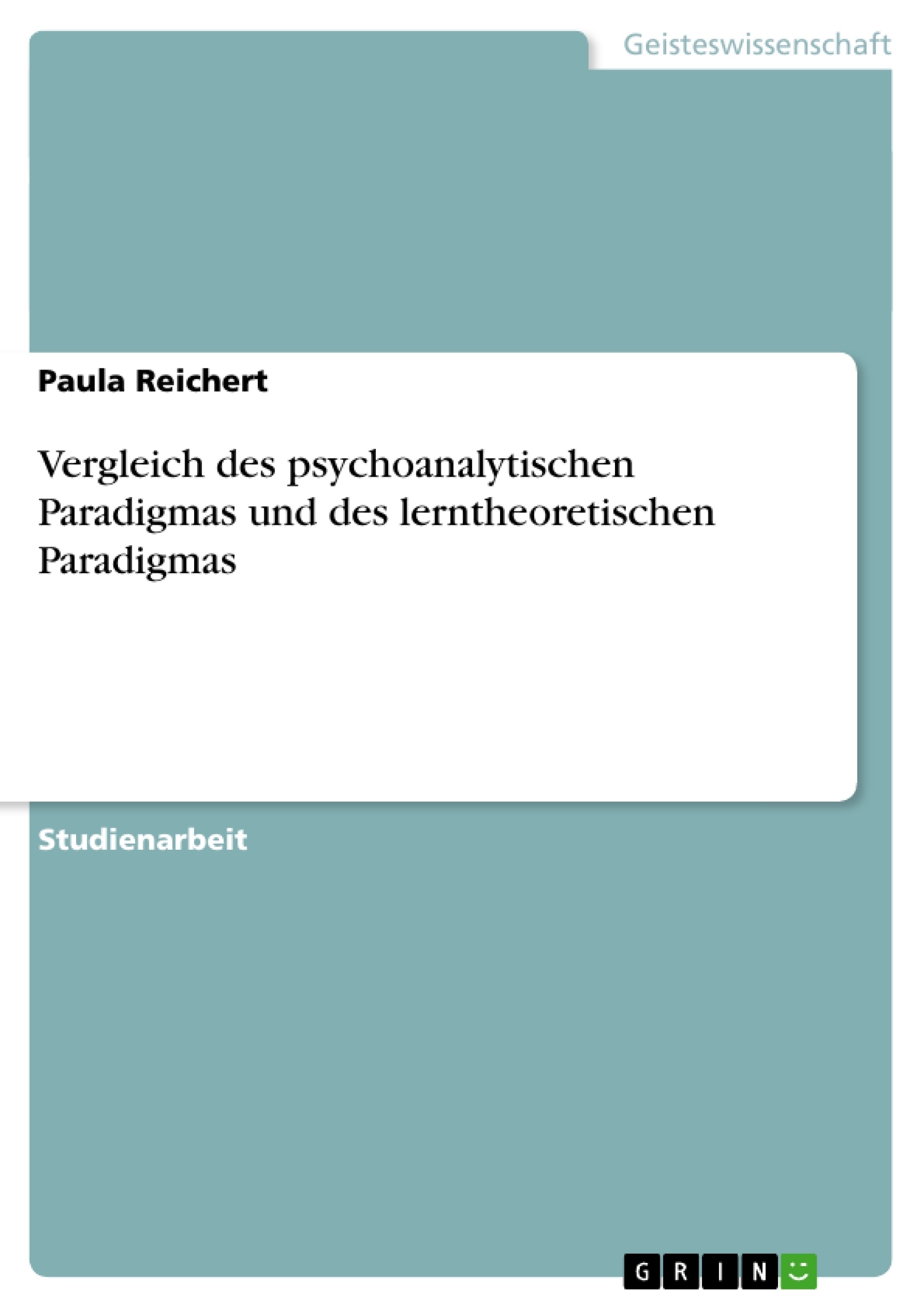Wann wird ein Verhalten als abnormal bezeichnet und wann kann es noch als normal gelten?
Unter welchen begleitenden Umständen ist für uns ein Verhalten gestört? Welche Ausprägung
oder welche Stärke kann ein abnormes Verhalten haben, und wann muss gestörtes Verhalten
schon als psychische Krankheit bezeichnet werden? Wird ein Verhalten als gestört definiert,
wenn es andere Menschen stört, den Betroffenen selber beeinträchtigt, oder wenn es nicht mehr
in unser Normengefüge passt?
Dies sind einige Fragen die sich schon viele Wissenschaftler gestellt haben, wenn es sich um
Themen der klinischen Psychologie handelt. Doch solche Fragen lassen sich oft nur subjektiv
beantworten, was der Psychologie manchmal den Ruf einbringt, keine Wissenschaft zu sein. Um
dem entgegen zu wirken, haben einige Wissenschaftler Modelle entwickelt, innerhalb derer man
verschiedene psychische Krankheiten und abnormes Verhalten untersuchen kann. Dadurch sollte
möglich gemacht werden, abnormes Verhalten mit theoretischen Begriffen zu fassen, seine
Entwicklung nachvollziehen zu können und eine entsprechende Behandlung zu finden, die eine
Besserung in Aussicht stellt ( vgl. Quelle 2).
Heute gibt es mehrere solcher theoretischen Modelle, die auch als Paradigmen bezeichnet
werden. Die wichtigsten Paradigmen sind folgende: das physiologische Paradigma, das
psychoanalytische Paradigma, lerntheoretische Paradigmen, das kognitive Paradigma und das
humanistische Paradigma. Viele von ihnen wurden weiterentwickelt, neu überarbeitet oder neuen
Umständen angepasst. Einige haben sich dabei so weit von dem ursprünglichen Paradigma
entfernt, dass sie als selbstständiges gesehen werden. Die oben genannten Paradigmen
unterscheiden sich oft sehr stark in ihren Annahmen und wiedersprechen sich zum Teil sogar.
Jedoch ist es unmöglich menschliches Verhalten und Erleben nur innerhalb eines Paradigmas zu
sehen, da „keines der Modelle in sich vollständig (ist )“, außerdem „... konzentriert sich (jedes)
auf einen Aspekt des menschlichen Erlebens und Verhaltens, und keines kann das gesamte
Spektrum des Pathologischen erklären“ ( Quelle 1, S. 33).
Im Rahmen meiner Hausarbeit möchte ich mich mit dem Psychoanalytischen und dem
Lerntheoretischen Paradigma beschäftigen. Dabei werde ich die wichtigsten Annahmen und
Thesen beider Paradigmen besprechen, um zum Schluss beide miteinander vergleichen zu
können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Der Begriff „psychisch krank“
- Das psychoanalytische Paradigma
- Die Grundannahmen der Psychoanalyse
- Die Struktur der Psyche
- Die Entwicklungsstufen in der Kindheit
- Probleme, die in der kindlichen Entwicklung entstehen können
- Psychische Probleme und Krankheiten innerhalb des psychoanalytischen Paradigmas
- Die Entstehung von psychischen Problemen
- Drei Arten von Angst
- Die psychoanalytische Therapie
- Beurteilung des psychoanalytischen Paradigmas
- Die Grundannahmen der Psychoanalyse
- Das lerntheoretische Paradigma
- Die Grundannahmen des lerntheoretischen Paradigmas
- Klassisches Konditionieren
- Operantes Konditionieren
- Modellernen
- Erklärungen gestörten Verhaltens durch das lerntheoretische Paradigma
- Verhaltenstherapie
- Beurteilung des lerntheoretischen Paradigmas
- Die Grundannahmen des lerntheoretischen Paradigmas
- Vergleich des psychoanalytischen Paradigmas mit dem lerntheoretischen Paradigma
- Inhaltliche Unterschiede der beiden Therapieformen
- Die analytische Psychotherapie
- Die Verhaltenstherapie
- Die Art der Therapie als Erfolgskriterium
- Die Art des Patienten und des Therapeuten als Erfolgskriterium
- Inhaltliche Unterschiede der beiden Therapieformen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem psychoanalytischen und dem lerntheoretischen Paradigma in der klinischen Psychologie. Das Ziel ist es, die wichtigsten Annahmen und Thesen beider Paradigmen zu präsentieren und sie anschließend miteinander zu vergleichen. Dabei werden die jeweiligen Grundannahmen, Entstehungsbedingungen psychischer Probleme, Therapieformen und die Beurteilung der beiden Paradigmen beleuchtet.
- Die Grundannahmen des psychoanalytischen und lerntheoretischen Paradigmas
- Die Erklärung von psychischen Problemen und Krankheiten innerhalb der beiden Paradigmen
- Die Therapieformen der Psychoanalyse und der Verhaltenstherapie
- Die Beurteilung der beiden Paradigmen
- Ein Vergleich der beiden Paradigmen in Bezug auf ihre Inhalte, die Art der Therapie und die Rolle von Patient und Therapeut
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Begriff „psychisch krank“
Die Einleitung thematisiert die Frage, wann Verhalten als abnormal bezeichnet werden kann und unter welchen Umständen es als gestört gilt. Die Vielschichtigkeit dieser Frage und die Schwierigkeit, sie objektiv zu beantworten, wird herausgestellt. Es wird erläutert, wie verschiedene theoretische Modelle, sogenannte Paradigmen, die Erforschung psychischer Krankheiten und abnormen Verhaltens ermöglichen.
Das psychoanalytische Paradigma
Dieses Kapitel stellt das psychoanalytische Paradigma vor, das von Sigmund Freud entwickelt wurde. Es werden die Grundannahmen der Psychoanalyse, die Struktur der Psyche mit Es, Ich und Über-Ich, sowie die Entwicklungsstufen in der Kindheit besprochen. Außerdem werden Probleme beleuchtet, die in der kindlichen Entwicklung auftreten können.
Das lerntheoretische Paradigma
Dieses Kapitel befasst sich mit dem lerntheoretischen Paradigma und seinen Grundannahmen. Es werden die drei wichtigsten Lerntheorien, das klassische Konditionieren, das operante Konditionieren und das Modellernen, vorgestellt. Des Weiteren werden Erklärungen für gestörtes Verhalten im Rahmen des lerntheoretischen Paradigmas und die Verhaltenstherapie erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Psychoanalyse, Lerntheorie, psychische Krankheit, Verhalten, Paradigma, Therapie, Sigmund Freud, klassisches Konditionieren, operantes Konditionieren, Modellernen, Abwehrmechanismen.
- Quote paper
- Paula Reichert (Author), 2002, Vergleich des psychoanalytischen Paradigmas und des lerntheoretischen Paradigmas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17924