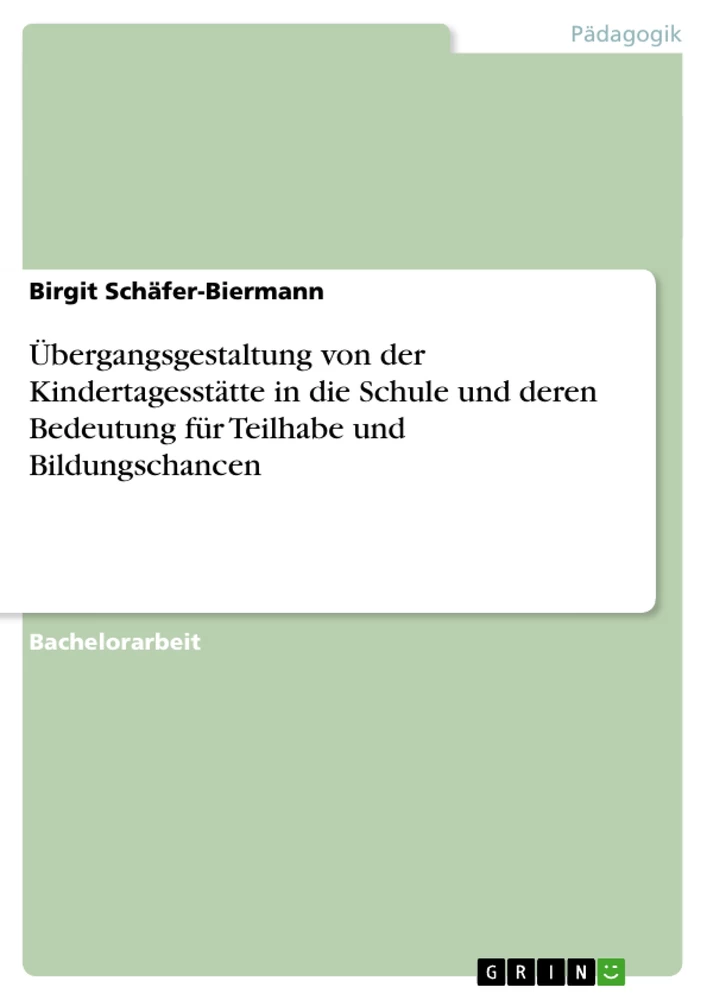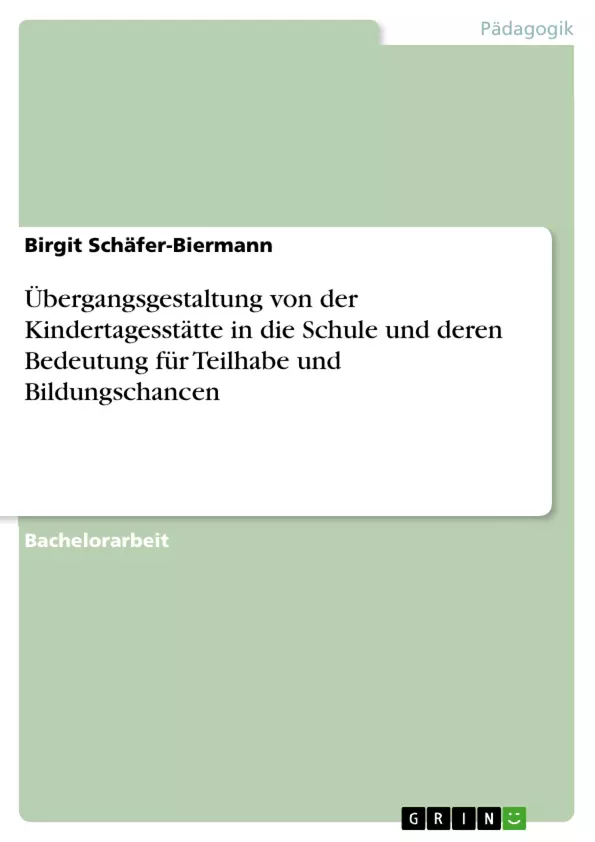Ungleichheitssensible Begleitung von Kindern und Familien im Übergangskontext ist ein möglicher Weg die zur Bildungsförderung von Kindern beitragen kann.
Warum gehst Du in die Schule? Die Frage ist einfach gestellt und wird von zukünftigen Schulkindern zumeist kurz beantwortet, lädt aber dazu ein, stellvertretend für viele andere Fragen zur Übergangsgestaltung über die entwicklungspsychologische, historische, pädagogische und soziologische Bedeutung der vielfältigen Herausforderungen eines gelingenden Übergangs nachzudenken, Elementar- und Primarbereich schaffen im Bildungssystem die Grundlagen für lebenslanges Lernen: "Bildungschancen sind Lebenschancen", die es in Bezug auf den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule zu betrachten gilt (vgl. Die Bundesregierung, 2011).
Ob und wie vorteilhafte oder nachteilige Lebensbedingungen in Bezug auf Bildungschancen für Kinder produziert werden ist Gegenstand der Thesis. Sie geht der Forschungsfrage nach, welche Aspekte der Übergangsbegleitung vom Kindergarten in die Grundschule für Teilhabe und Bildungschancen bedeutsam und relevant sind.
Im Verlauf der ungleichheitstheoretisch und pädagogisch ausgerichteten Arbeit bieten diese theoretischen Ansatzpunkte für die Übergangsgestaltung weitere Aspekte, die berücksichtigt werden können (u.a. werden die Begriffe Habitus und Kapital nach Pierre Bourdieu).
Neben den beteiligten Bildungsorten und dem zugrunde liegenden Bildungsverständnis werden die aktiven Akteure der Transition sowie die begleitenden Akteure beleuchtet.
Im Weiteren wird der Frage nachgegangen, welche Kompetenzen und Ressourcen für den Übergang relevant sind und es erfolgt eine Analyse der Ursachen der Bildungsbenachteiligung. Die vorliegende Arbeit möchte hierzu mögliche Antworten geben und verborgene Mechanismen der Bildungsbenachteiligung im Übergangskontext aufdecken, um etwaige Ursachen von Bildungsbenachteiligung zu bergen (vgl. Bourdieu, 2005).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Übergänge - Transitionen: Theoretische Zugänge
- 2.1 Betrachtungsweisen und Vorläufer der Konzeption von Übergang
- 2.2 Bezeichnung Übergang - Begriff Transition
- 2.3 Zentrale theoretische Grundlagen der Transitionsforschung
- 2.3.1 Der ökopsychologische Ansatz nach Urie Bronfenbrenner
- 2.3.2 Das ökopsychologische Modell zur Schulfähigkeit nach Horst Nickel
- 2.3.3 Das kontextuelle System-Modell
- 2.3.4 Das Stressmodell von Richard S. Lazarus
- 2.3.5 Entwicklungspsychologie der Lebensspanne
- 2.3.6 Modell der kritischen Lebensereignisse nach Sigrun-Heide Filipp
- 2.4 Das Transitionsmodell – der theoretische Rahmen für die pädagogische Übergangsgestaltung
- 3 Die Bildungsorte und Akteure der Transition
- 3.1 Bildungsorte - Historische Entwicklung der Trennung
- 3.2 Aktuelle Organisation und Struktur der Bildungsorte
- 3.2.1 Familie als Ort der Bildung
- 3.2.2 Kindertagesstätte und Grundschule
- 3.3 Das Bildungsverständnis
- 3.3.1 Sicht auf Bildung
- 3.3.2 Bildungsbereiche und Basiskompetenzen
- 3.4 Die Akteure der Transition
- 3.4.1 Die Kompetenz des sozialen Systems – Kinderfreundschaften
- 3.4.2 Die aktiven Akteure: Kinder und Eltern
- 3.4.3 Die begleitenden Akteure: die pädagogischen Fachkräfte
- 3.4.4 Exkurs: Gatekeeper
- 3.4.5 Exkurs: Ehrenamtliche und Honorarkräfte
- 4 Zusammenhang: Teilhabe und Bildungschancen im Übergangskontext
- 4.1 Einführung der Begriffe Kapital und Habitus nach Pierre Bourdieu
- 4.2 Anschlussfähiges Wissen
- 4.3 Teilhabe, Bildung und Chancen
- 4.3.1 Recht auf gesellschaftliche Teilhabe - Recht auf Bildung
- 4.3.2 Mechanismen der Bildungsexklusion
- 4.3.3 Ungleiche Kindheiten - Studien zu Bildungspraktiken der Familien
- 4.3.4 Ressourcenunterschiede und Milieus
- 4.3.5 Milieutypische, familiäre Alltagspraktiken und bildungsrelevanter Habitus
- 4.3.6 Elemente des familienbezogenen Habitus
- 5 Konsequenzen für die Übergangsgestaltung
- 5.1 Weiterer Ausbau der Kindertagesbetreuung
- 5.2 Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Übergangsgestaltung
- 5.3 Bestehende Übergangsmodelle in Deutschland
- 5.3.1 Zentrale Ansatzpunkte der Übergangsbegleitung
- 5.3.2 Anforderung und Herausforderungen der pädagogischen Akteure
- 5.3.3 Die Einstellung als Grundvoraussetzung
- 6 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gestaltung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Schule und dessen Bedeutung für die Teilhabe und Bildungschancen von Kindern. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Übergangsprozesses und beleuchtet die beteiligten Akteure und Bildungsorte. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der sozialen Ungleichheit und der damit verbundenen Herausforderungen für eine gelungene Übergangsgestaltung.
- Theoretische Grundlagen der Transitionsforschung
- Analyse der Bildungsorte und Akteure im Übergangskontext
- Zusammenhang von Teilhabe, Bildungschancen und sozialer Ungleichheit
- Konsequenzen für die Gestaltung des Übergangs
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Übergangsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt mit einem anschaulichen Zitat eines Kindes in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Schule für die Bildungschancen von Kindern. Sie formuliert die Forschungsfrage der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau und die Struktur der Arbeit. Die Einleitung unterstreicht die Relevanz der Thematik im Kontext von Chancengleichheit und Lebensbedingungen.
2 Übergänge - Transitionen: Theoretische Zugänge: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung verschiedener theoretischer Ansätze der Transitionsforschung. Es werden ökopsychologische Modelle (Bronfenbrenner, Nickel), systemtheoretische Perspektiven und das Stressmodell von Lazarus vorgestellt. Das Kapitel diskutiert die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und das Modell kritischer Lebensereignisse nach Filipp im Kontext des Übergangs. Es mündet in die Präsentation eines Transitionsmodells, das den theoretischen Rahmen der Arbeit bildet und als Grundlage für die pädagogische Gestaltung des Übergangs dient.
3 Die Bildungsorte und Akteure der Transition: Dieses Kapitel analysiert die Bildungsorte (Familie, Kindertagesstätte, Grundschule) und die verschiedenen Akteure im Übergangsprozess. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Trennung zwischen Kindertagesstätte und Grundschule und beschreibt die aktuelle Organisation und Struktur dieser Bildungsorte. Das Kapitel betrachtet das Bildungsverständnis der beteiligten Akteure, inklusive der Rolle von Eltern, Kindern und pädagogischen Fachkräften (einschließlich Gatekeepern und ehrenamtlichen Kräften). Es analysiert die jeweiligen Kompetenzen und Perspektiven dieser Akteure und deren Bedeutung für einen erfolgreichen Übergang.
4 Zusammenhang: Teilhabe und Bildungschancen im Übergangskontext: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Teilhabe, Bildungschancen und dem Übergangskontext. Es führt die Kapital- und Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu ein, um die Bedeutung von Ressourcen und familiären Praktiken für den Bildungserfolg zu beleuchten. Das Kapitel analysiert Mechanismen der Bildungsexklusion und präsentiert empirische Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die den Einfluss von familiärem Hintergrund und Milieu auf den Übergangsprozess verdeutlichen. Die Analyse fokussiert auf die Bedeutung von Ressourcenungleichheit und milieuspezifischen Alltagspraktiken.
5 Konsequenzen für die Übergangsgestaltung: Das Kapitel präsentiert bildungspolitische Konsequenzen, Handlungsempfehlungen und bestehende pädagogische Modelle zur Verbesserung der Übergangsgestaltung. Es beleuchtet den Ausbau der Kindertagesbetreuung und stellt konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Übergangs vor. Es untersucht Anforderungen und Herausforderungen an die pädagogischen Akteure und betont die Bedeutung der Einstellung der Beteiligten als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Gestaltung des Übergangs.
Schlüsselwörter
Übergangsgestaltung, Transition, Kindertagesstätte, Grundschule, Bildungschancen, Teilhabe, soziale Ungleichheit, Kapital, Habitus, Pierre Bourdieu, pädagogische Fachkräfte, Familien, Ressourcen, Bildungsexklusion.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Übergang von der Kita in die Schule
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Gestaltung des Übergangs von der Kindertagesstätte (Kita) in die Grundschule und dessen Bedeutung für die Teilhabe und Bildungschancen von Kindern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse sozialer Ungleichheit und den damit verbundenen Herausforderungen für einen erfolgreichen Übergang.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Ansätze der Transitionsforschung, darunter ökopsychologische Modelle (Bronfenbrenner, Nickel), systemtheoretische Perspektiven, das Stressmodell von Lazarus, die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne und das Modell kritischer Lebensereignisse nach Filipp. Ein zentrales Element bildet ein Transitionsmodell, das den theoretischen Rahmen der Arbeit darstellt.
Welche Akteure und Bildungsorte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Bildungsorte Familie, Kita und Grundschule sowie die beteiligten Akteure: Kinder, Eltern, pädagogische Fachkräfte (inkl. Gatekeeper und ehrenamtlicher Kräfte). Es wird die historische Entwicklung der Trennung zwischen Kita und Grundschule beleuchtet und die aktuelle Organisation und Struktur dieser Bildungsorte beschrieben.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Teilhabe, Bildungschancen und sozialer Ungleichheit dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Teilhabe, Bildungschancen und sozialer Ungleichheit im Übergangskontext. Sie nutzt die Kapital- und Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu, um die Bedeutung von Ressourcen und familiären Praktiken für den Bildungserfolg zu erklären. Mechanismen der Bildungsexklusion und der Einfluss von familiärem Hintergrund und Milieu werden analysiert.
Welche Konsequenzen für die Übergangsgestaltung werden gezogen?
Die Arbeit zieht bildungspolitische Konsequenzen und formuliert Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Übergangsgestaltung. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung wird thematisiert und konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Übergangs vorgeschlagen. Die Anforderungen und Herausforderungen an die pädagogischen Akteure sowie die Bedeutung der Einstellung der Beteiligten werden betont.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Übergangsgestaltung, Transition, Kindertagesstätte, Grundschule, Bildungschancen, Teilhabe, soziale Ungleichheit, Kapital, Habitus, Pierre Bourdieu, pädagogische Fachkräfte, Familien, Ressourcen, Bildungsexklusion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen der Transitionsforschung, ein Kapitel zu den Bildungsorten und Akteuren, ein Kapitel zum Zusammenhang von Teilhabe und Bildungschancen, ein Kapitel zu Konsequenzen für die Übergangsgestaltung und einen Ausblick.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit befasst sich mit der Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Schule und dessen Bedeutung für die Teilhabe und Bildungschancen von Kindern unter Berücksichtigung sozialer Ungleichheit.
- Citar trabajo
- Birgit Schäfer-Biermann (Autor), 2011, Übergangsgestaltung von der Kindertagesstätte in die Schule und deren Bedeutung für Teilhabe und Bildungschancen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178565