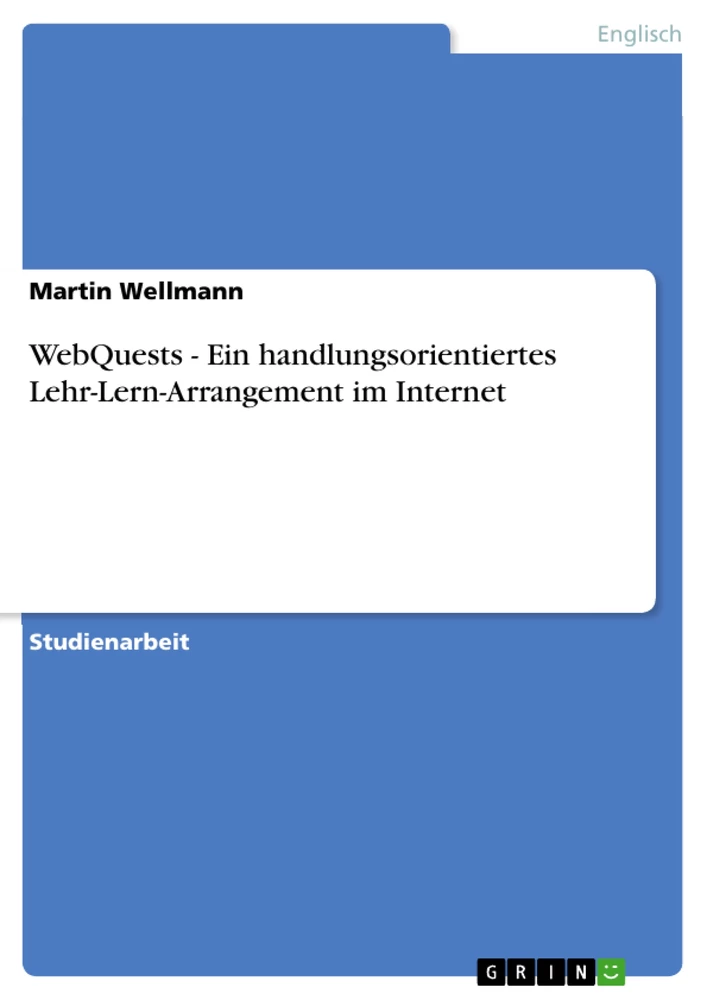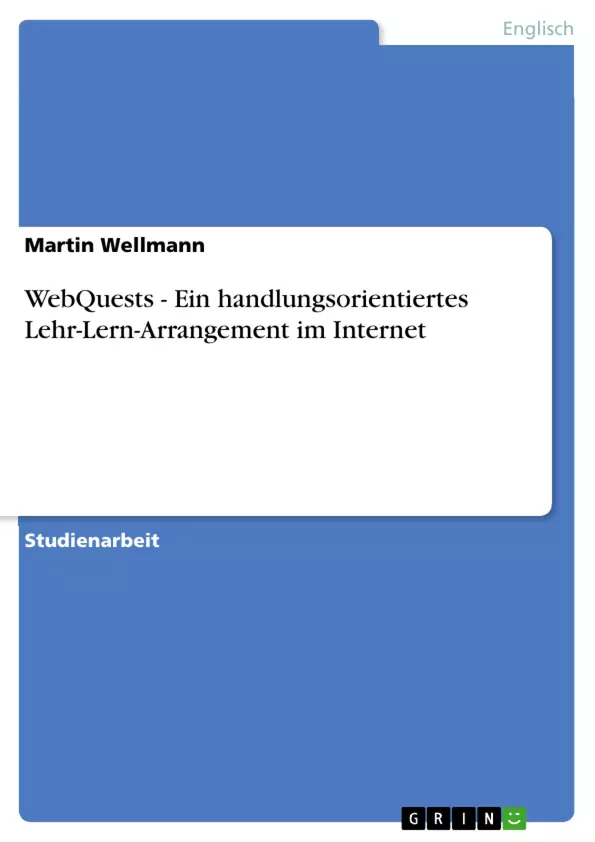Endlich ist es soweit. Das Internet-Zeitalter hält Einzug in die bayerischen Klassen-zimmer. Ganz nach dem Motto „Laptop und Lederhose“ hat sich laut Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus die durchschnittliche Zahl der Computerarbeitsplätze an bayerischen Gymnasien von lediglich 35 im Jahr 2001 auf 67,2 im Jahr 2006 fast verdoppelt (vgl. BMBF 2006).
Auch die Lehrkräfte scheinen von den Vorzügen des World Wide Webs über-zeugt zu sein. In einer bundesweiten Lehrerbefragung fand das MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung im Auftrag des Bundesbildungsministeriums heraus, dass sich rund 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer mit Hilfe des Internets auf ihren Unterricht vorbereiten (vgl. Goertz 2008, 17). Das Internet ist also nicht nur fester Bestandteil im Leben der Schülerinnen und Schüler, sondern ist auch im Alltag der Lehrkräfte nicht mehr wegzudenken.
Diese erfreuliche Erkenntnis wird leider von einem weiteren, weitaus weniger angenehmen Umfrageergebnis überschattet. Lediglich 20 bis 30 Prozent der Lehrer-innen und Lehrer setzen das Internet im Unterrichtsalltag auch ein (vgl. Goertz 2008, 17). Damit fristet das Internet aus Sicht der Schülerinnen und Schüler in der Schule leider nur eine Randexistenz.
Die Erwartungen an das Internet für den Schulbereich sind in der Öffentlich-keit und in der Bildungspolitik in den letzten Jahren ins schier Unermessliche gestie-gen. Es steht außer Frage, dass das Internet das Potential hat, den Unterricht enorm zu bereichern. Die Frage, die sich stellt, ist, unter welchen Voraussetzungen sich dieses Potential entfalten kann. Eine Ausstattung mit modernen und vielseitigen Medien führt nicht automatisch zu einem modernen und abwechslungsreichen Unterricht.
Obwohl viele Lehrkräfte dem Internet gegenüber sehr aufgeschlossen sind, fehlt es noch immer an geeigneten didaktischen Konzepten, um die Vorzüge des World Wide Webs für den Unterricht voll auszuschöpfen. Die vorliegende Arbeit soll dabei helfen, das Internet in den Schulunterricht besser zu integrieren, indem sie eine Methode zur pädagogischen Nutzung dieses vielseitigen Mediums vorstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Internet im Schulalltag
- Das WebQuest-Konzept
- Die Geschichte des WebQuest-Konzepts
- Der Begriff "WebQuest"
- Definition
- Das WebQuest-Konzept – Eine konstruktivistische Lerntheorie
- Die Komplexität von WebQuests
- Die WebQuest-Struktur
- Introduction
- Task
- Der WebQuest-Task
- Die Group-Tasks
- Die Gruppenkonzeption
- Information Sources
- Process
- Evaluation
- Evaluation durch die SchülerInnen
- Evaluation durch den Lehrenden
- Conclusion
- Die Vor- und Nachteile von WebQuests
- Ausblick, Web 2.0 und die Lehrkraft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration des Internets in den Schulunterricht und stellt das WebQuest-Konzept als eine Methode zur pädagogischen Nutzung dieses Mediums vor. Die Zielsetzung ist es, die Vor- und Nachteile von WebQuests aufzuzeigen und deren Potenzial für einen modernen und abwechslungsreichen Unterricht zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Internets im Schulalltag
- Das WebQuest-Konzept als didaktisches Modell
- Die Struktur und Komponenten eines WebQuests
- Die Vorteile und Herausforderungen bei der Implementierung von WebQuests
- Der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kontext von Web 2.0
Zusammenfassung der Kapitel
Das Internet im Schulalltag: Der erste Abschnitt beleuchtet den aktuellen Stand der Internetnutzung in bayerischen Gymnasien. Während die Ausstattung mit Computern gestiegen ist, wird das Internet im Unterricht nur von einem geringen Prozentsatz der Lehrkräfte eingesetzt. Der Text hebt die Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Potenzial des Internets und dessen tatsächlicher Nutzung im Unterricht hervor und betont den Bedarf an geeigneten didaktischen Konzepten. Die Arbeit argumentiert für eine verbesserte Integration des Internets in den Unterricht.
Das WebQuest-Konzept: Dieses Kapitel führt in das Konzept des WebQuests ein, ein computergestütztes Lehr-Lern-Arrangement, das das Internet auf pädagogisch sinnvolle Weise nutzt. Es wird ein historischer Überblick gegeben, der die Entwicklung des Konzepts durch Bernie Dodge und Tom March beschreibt, mit dem Fokus auf effiziente Zeiteinteilung und schülerzentriertes Lernen. Der Begriff "WebQuest" wird etymologisch analysiert und seine Bedeutung im Kontext des Unterrichts erläutert.
Die WebQuest-Struktur: Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierte Struktur eines WebQuests, bestehend aus den Komponenten Introduction, Task (inkl. Gruppenarbeit), Information Sources, Process, Evaluation und Conclusion. Es wird auf die verschiedenen Aspekte eingegangen, wie die Gestaltung der Aufgabe, die Auswahl geeigneter Informationsquellen, die Organisation des Arbeitsprozesses und die Bewertung der Ergebnisse sowohl durch die Schüler als auch den Lehrer. Die einzelnen Komponenten werden umfassend erläutert, um ein tiefgreifendes Verständnis der Methodik zu vermitteln.
Die Vor- und Nachteile von WebQuests: Dieser Abschnitt bietet eine ausgewogene Betrachtung der Vor- und Nachteile von WebQuests. Die Stärken des Ansatzes werden ebenso hervorgehoben wie die Herausforderungen und potenziellen Probleme, die bei der Implementierung und Durchführung auftreten können. Dies dient dazu, ein realistisches Bild der Methode zu zeichnen und potenziellen Anwendern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Ausblick, Web 2.0 und die Lehrkraft: Das Kapitel befasst sich mit zukünftigen Entwicklungen und den Auswirkungen von Web 2.0 auf die Verwendung von WebQuests im Unterricht. Es analysiert, wie sich neue Technologien und veränderte Lernumgebungen auf die Gestaltung und Anwendung von WebQuests auswirken können und welche Rolle die Lehrkraft dabei spielt. Der Ausblick gibt einen umfassenden Überblick über die langfristigen Perspektiven dieser Methode.
Schlüsselwörter
WebQuest, Internet im Unterricht, mediendidaktisches Konzept, schülerzentriertes Lernen, konstruktivistische Lerntheorie, Gruppenarbeit, Online-Recherche, digitale Medienkompetenz, Lehr-Lern-Arrangement, Web 2.0.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Integration des Internets im Schulunterricht und das WebQuest-Konzept"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Integration des Internets in den Schulunterricht und präsentiert das WebQuest-Konzept als eine Methode zur sinnvollen pädagogischen Nutzung des Internets. Sie beleuchtet die Vor- und Nachteile von WebQuests und deren Potenzial für einen modernen und abwechslungsreichen Unterricht.
Was wird im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Das Internet im Schulalltag, das WebQuest-Konzept (inklusive Geschichte, Definition und konstruktivistischem Ansatz), die WebQuest-Struktur (Introduction, Task, Information Sources, Process, Evaluation, Conclusion), die Vor- und Nachteile von WebQuests und einen Ausblick auf Web 2.0 und die Rolle der Lehrkraft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile von WebQuests aufzuzeigen und deren Potenzial für einen modernen und abwechslungsreichen Unterricht zu beleuchten. Sie untersucht die Bedeutung des Internets im Schulalltag und das WebQuest-Konzept als didaktisches Modell.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themenschwerpunkte sind: Die Bedeutung des Internets im Schulalltag, das WebQuest-Konzept als didaktisches Modell, die Struktur und Komponenten eines WebQuests, die Vorteile und Herausforderungen bei der Implementierung von WebQuests und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Kontext von Web 2.0.
Wie ist die Arbeit strukturiert (Kapitelzusammenfassung)?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Internetnutzung in Schulen, dem WebQuest-Konzept (inklusive historischer Entwicklung und Definition), der detaillierten Struktur eines WebQuests (inkl. aller Komponenten), den Vor- und Nachteilen von WebQuests und einem Ausblick auf Web 2.0 und die Rolle der Lehrkraft befassen.
Welche Vor- und Nachteile von WebQuests werden diskutiert?
Die Arbeit bietet eine ausgewogene Betrachtung der Stärken und Schwächen von WebQuests. Es werden sowohl die Vorteile (z.B. schülerzentriertes Lernen, effiziente Zeiteinteilung) als auch die Herausforderungen und potenziellen Probleme (z.B. technische Schwierigkeiten, Aufwand bei der Vorbereitung) beleuchtet.
Welche Rolle spielt Web 2.0 im Kontext der Arbeit?
Das Kapitel "Ausblick, Web 2.0 und die Lehrkraft" analysiert die Auswirkungen von Web 2.0 auf die Verwendung von WebQuests im Unterricht. Es untersucht, wie neue Technologien und veränderte Lernumgebungen die Gestaltung und Anwendung von WebQuests beeinflussen und welche Rolle die Lehrkraft dabei spielt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: WebQuest, Internet im Unterricht, mediendidaktisches Konzept, schülerzentriertes Lernen, konstruktivistische Lerntheorie, Gruppenarbeit, Online-Recherche, digitale Medienkompetenz, Lehr-Lern-Arrangement, Web 2.0.
Was ist ein WebQuest?
Ein WebQuest ist ein computergestütztes Lehr-Lern-Arrangement, das das Internet auf pädagogisch sinnvolle Weise nutzt. Es zeichnet sich durch effiziente Zeiteinteilung und schülerzentriertes Lernen aus.
Wie ist ein WebQuest aufgebaut?
Ein WebQuest besteht aus den Komponenten: Introduction, Task (inkl. Gruppenarbeit), Information Sources, Process, Evaluation und Conclusion. Jede Komponente ist detailliert beschrieben, um ein umfassendes Verständnis der Methodik zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Martin Wellmann (Autor), 2008, WebQuests - Ein handlungsorientiertes Lehr-Lern-Arrangement im Internet, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178362