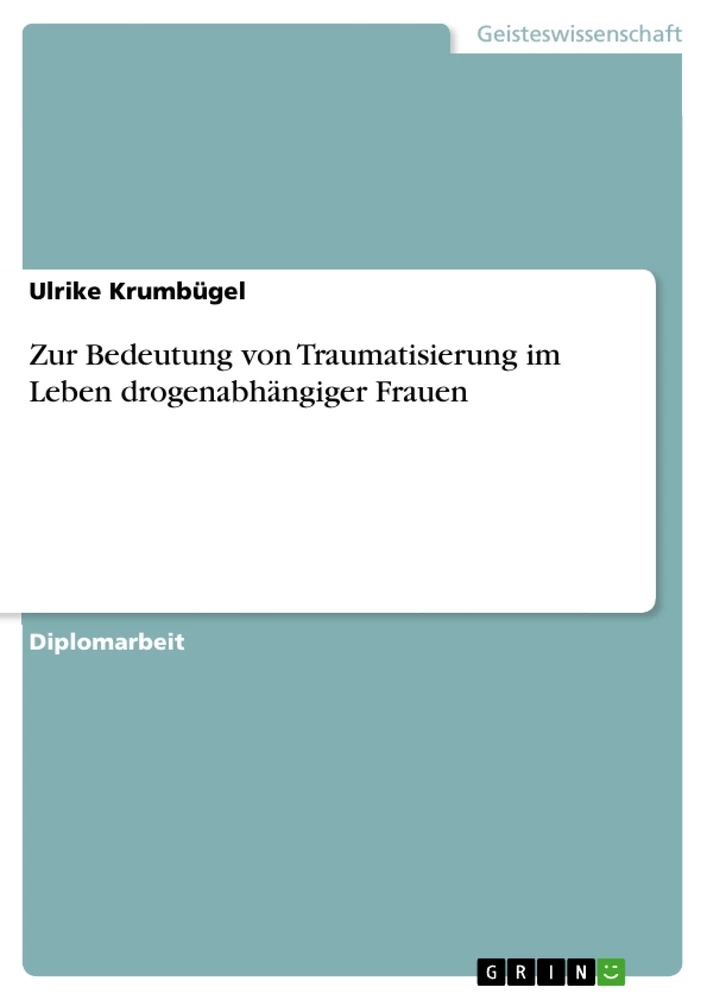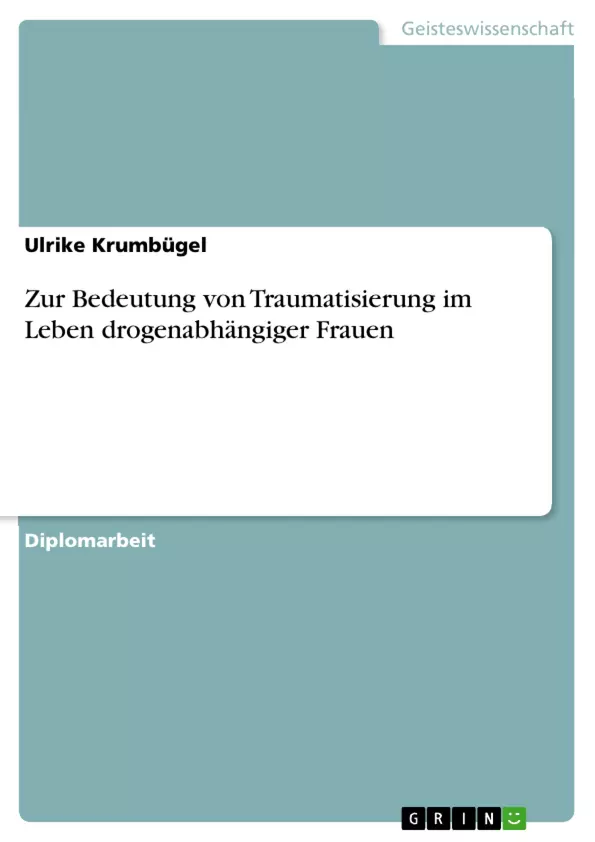[...] Denjenigen, die als Fachkräfte der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe tätig sind, ist bewusst,
dass viele ihrer drogenabhängigen Klientinnen Lebensgeschichten aufweisen, in denen
sexualisierte und physische Gewalt, Vernachlässigung sowie besondere Schicksalsschläge
eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Für Frauen, die von einer illegalen Droge wie Heroin
abhängig sind, scheint dies umso mehr zu gelten, da durch den illegalen Substanzkonsum
Kontakte mit dem kriminellen Milieu und der Drogenszene unumgänglich sind und sie der
von dort ausgehenden Gewalt in besonderem Maße exponiert sind. Auch ist bekannt, dass
viele Klientinnen Herkunftsfamilien entstammen, in denen die Eltern selbst substanzabhängig
sind oder unter psychischen Störungen leiden. Im Kontext mit diesen belastenden früheren
und aktuellen Lebensbedingungen wird oft der Begriff der Traumatisierung gebraucht. Ein
Zusammenhang zwischen erfahrener Traumatisierung und der Entwicklung einer Sucht wird
angenommen (vgl. Lüdecke u.a. 2004, S. 376; Petzold u.a. 2007, S. 84). Weniger eindeutig
ist, worin der Zusammenhang zwischen Traumatisierung und Sucht als korrelativer
Erscheinung besteht.
Diese Arbeit geht dem Komplex Sucht und Trauma nach und konzentriert sich dabei auf die
spezifische Situation opioidabhängiger Frauen, die zusätzlich andere Drogen unterschiedlicher Art konsumieren. In diesem Zusammenhang soll im Wesentlichen zwei
Fragen nachgegangen werden: Welche Bedeutung hat Traumatisierung im Leben
drogenabhängiger Frauen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen erlebten Traumata und
Suchtentwicklung? Es stellt sich die Frage der Relevanz dieses Themas für die Soziale Arbeit.
SozialarbeiterInnen in der Suchthilfe arbeiten nicht zwangsläufig aufgrund deren
Traumatisierung mit den betroffenen Frauen – sie sind eben keine TherapeutInnen. Dennoch
kann davon ausgegangen werden, dass es wichtig ist, mit dem Themenfeld Trauma und
Traumatisierung vertraut zu sein und eine mögliche Traumatisierung bei drogenabhängigen
Frauen erkennen zu können. Einerseits, um die eigenen sozialarbeiterischen Interventionen an
die spezifischen Bedürfnisse dieser Frauen anpassen zu können; andererseits, um
möglicherweise psychiatrisch relevante Störungsbilder erkennen und therapeutische Hilfe
vermitteln zu können. SozialarbeiterInnen sind, in den Einrichtungen der Suchthilfe, in denen
sie tätig sind, eher erste Anlaufstelle für drogenabhängige Frauen als TherapeutInnen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit
- 1.1 Definition der Begriffe Missbrauch, Abhängigkeit und Sucht
- 1.2 Psychotrope Substanzen – Klassifikation und Störungsbilder
- 1.3 Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit bei Frauen
- 1.3.1 Epidemiologie von Missbrauch und Abhängigkeit von illegalen Substanzen bei Frauen
- 1.3.2 Zur spezifischen Lebenssituation drogenabhängiger Frauen
- 2. Trauma und Traumatisierung
- 2.1 Definition des Begriffs Trauma
- 2.2 Das traumatische Ereignis
- 2.2.1 Potentiell traumatische Ereignisse
- 2.2.2 Klassifikation traumatischer Ereignisse
- 2.3 Der Verlauf von Traumatisierung
- 2.4 Das Erleben des traumatischen Ereignisses
- 2.5 Folgen der Traumatisierung
- 2.5.1 Exkurs: Trauma und Bindung
- 2.6 Posttraumatische Diagnosen
- 2.7 Risiko- und Schutzfaktoren
- 3. Traumatisierung drogenabhängiger Frauen
- 3.1 Traumatische Ereignisse in Kindheit und Jugend
- 3.1.1 Vernachlässigung, psychische Misshandlung und körperliche Misshandlung
- 3.1.2 Sexueller Missbrauch
- 3.2 Traumatische Ereignisse in Jugend und Erwachsenenalter
- 3.2.1 Physische und sexuelle Gewalt
- 3.2.2 Beschaffungsprostitution
- 3.3 Psychiatrische Komorbidität als Folge von Traumatisierung
- 3.1 Traumatische Ereignisse in Kindheit und Jugend
- 4. Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen Substanzabhängigkeit und Traumatisierung
- 4.1 Vom Trauma zur Sucht - Die Selbstmedikationshypothese
- 4.2 Von der Sucht zum Trauma – Die High-Risk-Hypothese und die Vulnerabilitätshypothese
- 4.3 Traumatisierung und Sucht als reziproker Prozess
- 4.4 Weitere Aspekte möglicher Zusammenhänge
- 4.4.1 Suchtmittelkonsum und selbstverletzendes Verhalten
- 4.4.2 Exkurs: Trauma, Sucht und Bindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Traumatisierung und Substanzabhängigkeit bei Frauen. Das Hauptziel ist es, die Bedeutung von Traumatisierung im Leben drogenabhängiger Frauen zu beleuchten und den möglichen Zusammenhang zwischen erlebten Traumata und der Entwicklung einer Sucht zu erforschen. Die Relevanz dieser Thematik für die Soziale Arbeit wird ebenfalls betrachtet.
- Definition und Klassifizierung von Substanzmissbrauch und -abhängigkeit bei Frauen
- Definition und Auswirkungen von Trauma und Traumatisierung
- Häufigkeit traumatischer Ereignisse im Leben drogenabhängiger Frauen
- Theorien zum Zusammenhang zwischen Trauma und Suchtentwicklung
- Implikationen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Traumatisierung bei drogenabhängigen Frauen ein und hebt die zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Psychotraumatologie hervor. Sie betont den oft übersehenen Aspekt der innerfamiliären Traumatisierung im Gegensatz zu öffentlich diskutierten Katastrophen. Die Arbeit fokussiert auf die spezifische Situation opioidabhängiger Frauen und stellt die zentralen Forschungsfragen nach der Bedeutung von Traumatisierung und dem Zusammenhang mit Suchtentwicklung. Die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit wird herausgestellt, wobei betont wird, dass es nicht um konkrete Handlungsanweisungen geht, sondern um die Erweiterung des theoretischen Wissens über die Situation betroffener Frauen.
1. Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit: Dieses Kapitel liefert zunächst Definitionen von Missbrauch, Abhängigkeit und Sucht und klassifiziert psychotrope Substanzen. Es konzentriert sich anschließend auf Substanzmissbrauch und -abhängigkeit bei Frauen, wobei epidemiologische Daten präsentiert und die spezifischen Lebensbedingungen drogenabhängiger Frauen beleuchtet werden. Die Besonderheiten der Situation von Frauen im Kontext von illegalem Drogenkonsum und den damit verbundenen Risiken werden hervorgehoben.
2. Trauma und Traumatisierung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff Trauma, beschreibt potentiell traumatische Ereignisse und deren Klassifizierung. Es erläutert den Verlauf von Traumatisierungsprozessen, das Erleben traumatischer Ereignisse und die daraus resultierenden Folgen. Der Zusammenhang zwischen Trauma und Bindung wird als Exkurs betrachtet, ebenso werden posttraumatische Diagnosen und Risiko- sowie Schutzfaktoren diskutiert. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Betrachtung der Traumatisierung und ihrer komplexen Auswirkungen.
3. Traumatisierung drogenabhängiger Frauen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konkreten traumatisierenden Ereignisse im Leben drogenabhängiger Frauen, differenziert nach Kindheit und Jugend (Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch) und Jugend-/Erwachsenenalter (physische und sexuelle Gewalt, Beschaffungsprostitution). Es wird die psychiatrische Komorbidität als Folge der Traumatisierung beleuchtet und somit ein umfassendes Bild der vielfältigen traumatisierenden Erfahrungen dieser Frauen gezeichnet.
4. Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen Substanzabhängigkeit und Traumatisierung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Theorien, die den Zusammenhang zwischen Substanzabhängigkeit und Traumatisierung erklären. Es werden die Selbstmedikationshypothese, die High-Risk-Hypothese und die Vulnerabilitätshypothese sowie der reziproke Prozess zwischen Traumatisierung und Sucht erörtert. Zusätzliche Aspekte wie der Zusammenhang zwischen Suchtmittelkonsum und selbstverletzendem Verhalten und der Einfluss von Bindung werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der multifaktoriellen Betrachtung der komplexen Interaktion zwischen Trauma und Sucht.
Schlüsselwörter
Traumatisierung, Substanzabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, Frauen, Opioide, Heroin, Soziale Arbeit, Suchthilfe, Selbstmedikation, psychische Störungen, Gewalt, Missbrauch, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Komorbidität, Bindung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Traumatisierung und Substanzabhängigkeit bei Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen Traumatisierung und Substanzabhängigkeit bei Frauen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Traumata im Leben betroffener Frauen und erforscht die möglichen Zusammenhänge zwischen erlebten Traumata und der Entwicklung einer Sucht. Die Relevanz dieser Thematik für die Soziale Arbeit wird ebenfalls betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst Definitionen und Klassifizierungen von Substanzmissbrauch und -abhängigkeit bei Frauen, Definition und Auswirkungen von Trauma und Traumatisierung, die Häufigkeit traumatischer Ereignisse im Leben drogenabhängiger Frauen, Theorien zum Zusammenhang zwischen Trauma und Suchtentwicklung (Selbstmedikationshypothese, High-Risk-Hypothese, Vulnerabilitätshypothese, reziproker Prozess) und die Implikationen für die Soziale Arbeit. Es werden verschiedene Arten von Traumata (Vernachlässigung, Misshandlung, sexueller Missbrauch, physische und sexuelle Gewalt, Beschaffungsprostitution) und deren Folgen (psychiatrische Komorbidität) behandelt.
Welche Arten von Traumata werden betrachtet?
Die Arbeit differenziert zwischen traumatisierenden Ereignissen in Kindheit und Jugend (Vernachlässigung, psychische und körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch) und in Jugend und Erwachsenenalter (physische und sexuelle Gewalt, Beschaffungsprostitution).
Welche Theorien zum Zusammenhang zwischen Trauma und Sucht werden diskutiert?
Es werden verschiedene Erklärungsansätze diskutiert, darunter die Selbstmedikationshypothese (Trauma als Ursache der Sucht), die High-Risk-Hypothese und die Vulnerabilitätshypothese (bereits vorhandene Vulnerabilität als Risikofaktor), sowie die Betrachtung des Zusammenhangs als reziproker Prozess. Zusätzlich wird der Zusammenhang zwischen Suchtmittelkonsum und selbstverletzendem Verhalten beleuchtet.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Arbeit hebt die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit hervor. Es geht nicht um konkrete Handlungsanweisungen, sondern um die Erweiterung des theoretischen Wissens über die Situation betroffener Frauen, um so eine bessere Grundlage für sozialarbeiterische Interventionen zu schaffen.
Welche Substanzen stehen im Fokus?
Die Arbeit konzentriert sich zwar auf die Situation opioidabhängiger Frauen, aber die Thematik des Substanzmissbrauchs und der Abhängigkeit wird generell behandelt. Die Klassifizierung psychotroper Substanzen wird im ersten Kapitel erläutert.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels: Einleitung, Substanzmissbrauch und Substanzabhängigkeit, Trauma und Traumatisierung, Traumatisierung drogenabhängiger Frauen und Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen Substanzabhängigkeit und Traumatisierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Traumatisierung, Substanzabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, Frauen, Opioide, Heroin, Soziale Arbeit, Suchthilfe, Selbstmedikation, psychische Störungen, Gewalt, Missbrauch, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Komorbidität, Bindung.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit ist strukturiert in eine Einleitung, vier Hauptkapitel (Substanzmissbrauch und -abhängigkeit, Trauma und Traumatisierung, Traumatisierung drogenabhängiger Frauen, Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen Substanzabhängigkeit und Traumatisierung) und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern und einer Zusammenfassung der Kapitel.
- Quote paper
- Ulrike Krumbügel (Author), 2009, Zur Bedeutung von Traumatisierung im Leben drogenabhängiger Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178264