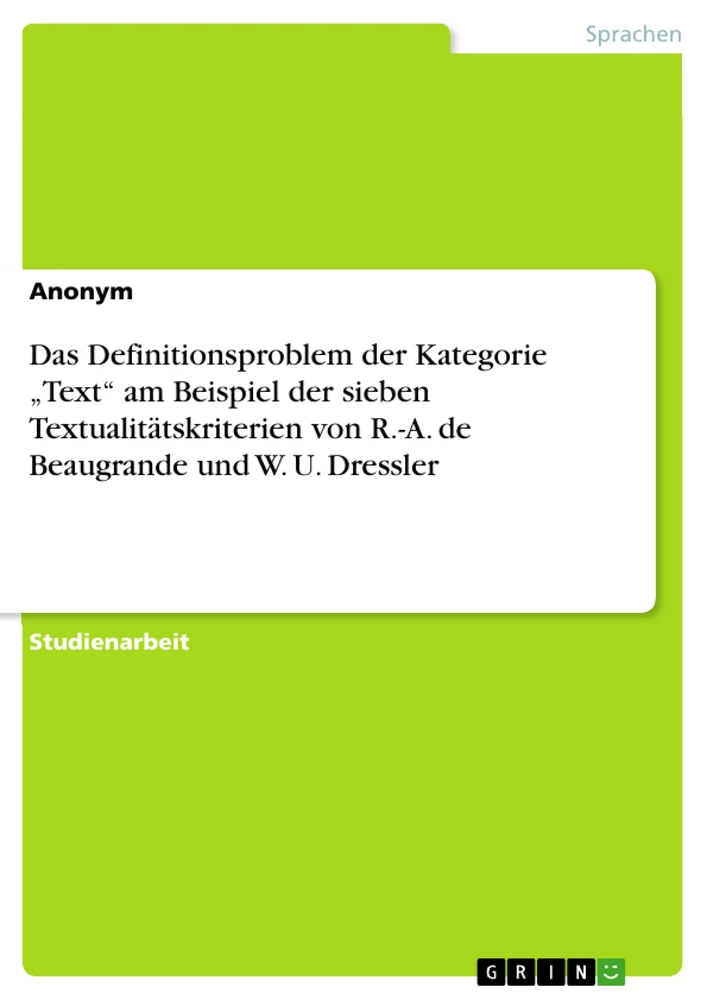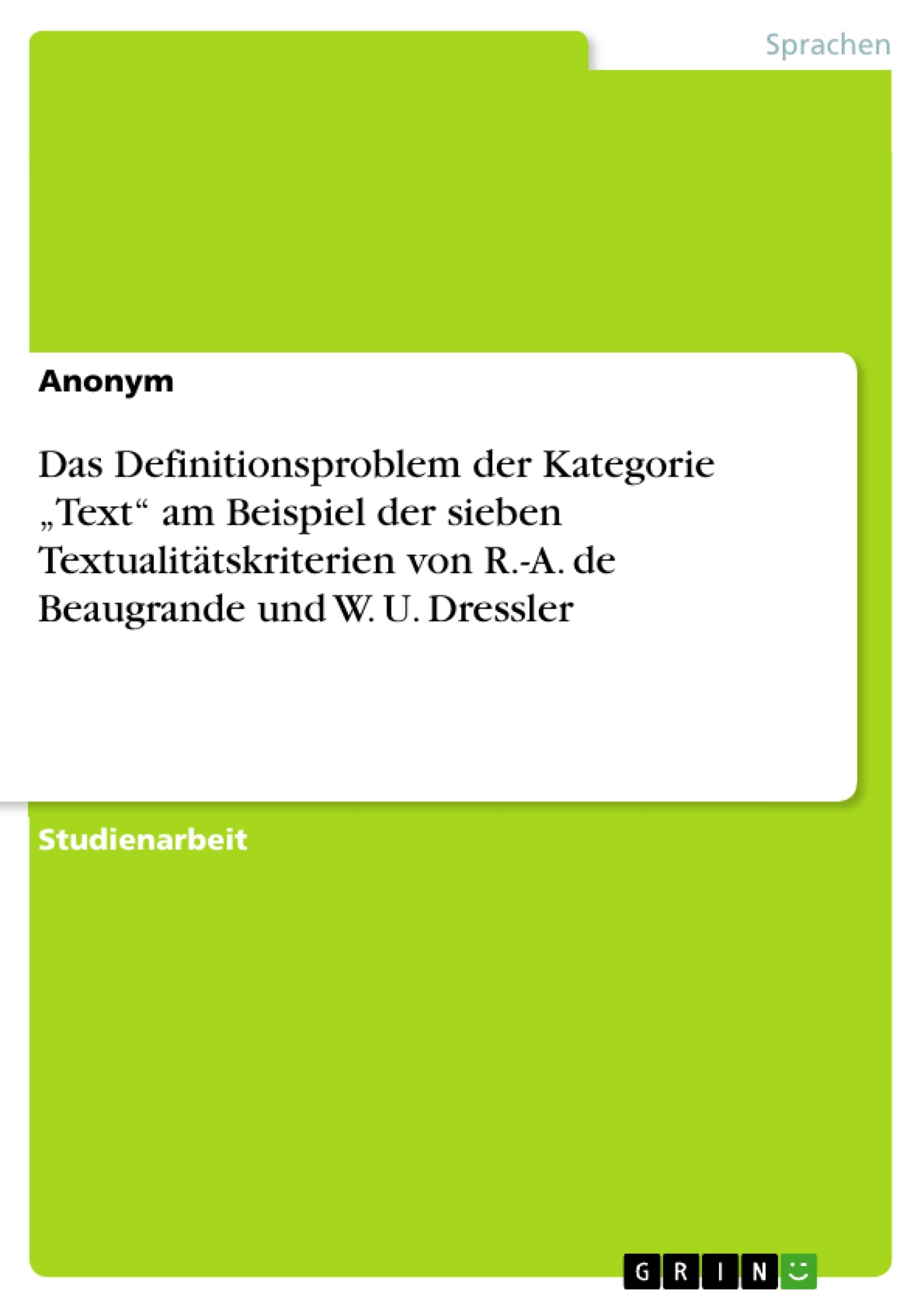Seit Beginn der 70er Jahre, der pragmatischen Wende1, sehen sich Sprachwissenschaftler, aus dem Bereich der Textlinguistik, erneut mit der Aufgabe konfrontiert, eine adäquate Definition für den Begriff „Text“ zu formulieren. Diese Definition soll vor allem aufzeigen, welche Merkmale die Textualität eines Textes kennzeichnen und die einen Text von einem 'Nicht- Text' unterscheiden. Jedoch ist es der Textlinguistik, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, noch nicht gelungen, sich auf eine einheitliche Definition der Kategorie „Text“ zu verständigen.
De Beaugrande und Dressler, nennen sieben Kriterien der Textualität, die eine Unterscheidung zwischen Text und 'Nicht-Text' ermöglichen sollen. Diese, bereits in die wissenschaftliche Diskussion integrierten Merkmale bilden die Grundlage der vorliegenden Ausarbeitung. So werden zum einen die Kriterien selbst thematisiert und anhand von Beispielen veranschaulicht, zum anderen wird ihre Relevanz als Merkmal der Textualität überprüft. Auch das Definitionsproblem des Begriffs „Text“ wird Bestandteil dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Definitionsproblem der Kategorie „Text“
- 3.0 Kriterien der Textualität
- 3.1 Kohäsion
- 3.2 Kohärenz
- 3.3 Intentionalität
- 3.4 Akzeptabilität
- 3.5 Informativität
- 3.6 Situationalität
- 3.7 Intertextualität
- 4.0 Fazit
- 5.0 Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Definitionsproblem des Begriffs „Text“ in der Textlinguistik und analysiert die sieben Textualitätskriterien von de Beaugrande und Dressler. Ziel ist es, die Kriterien zu erläutern, anhand von Beispielen zu veranschaulichen und ihre Relevanz für die Unterscheidung zwischen Text und „Nicht-Text“ zu überprüfen.
- Das Definitionsproblem des Begriffs „Text“
- Die sieben Textualitätskriterien nach de Beaugrande und Dressler
- Analyse der Kohäsion als Kriterium der Textualität
- Bewertung der Ausschließlichkeit der Kriterien
- Die Prototypentheorie als Ansatz zur Textbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Textdefinition in der Sprachwissenschaft ein und skizziert die Herausforderungen, einen einheitlichen Textbegriff zu definieren. Sie hebt die Bedeutung der sieben Textualitätskriterien von de Beaugrande und Dressler hervor, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Die Arbeit untersucht, inwiefern diese Kriterien eine Unterscheidung zwischen Text und Nicht-Text ermöglichen und beleuchtet das damit verbundene Definitionsproblem. Die Einleitung setzt den Rahmen für die anschließende detaillierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Kriterien.
2.0 Definitionsproblem der Kategorie „Text“: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Schwierigkeiten, den Begriff „Text“ präzise zu definieren. Es werden verschiedene historische und sprachwissenschaftliche Perspektiven auf den Begriff beleuchtet, die von der ursprünglichen Bedeutung als „Gewebe“ bis hin zu den modernen, vielschichtigen Interpretationen in der Linguistik reichen. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Definitionen und den damit verbundenen Problemen, einen einheitlichen Textbegriff zu etablieren. Die Kapitel diskutiert verschiedene Ansätze, wie die Prototypentheorie, zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Komplexität und Vielschichtigkeit des Begriffs „Text“ wird als zentrale Herausforderung für eine umfassende Definition hervorgehoben.
3.0 Kriterien der Textualität: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die sieben Kriterien der Textualität von de Beaugrande und Dressler: Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität. Es wird jeweils erläutert, wie diese Kriterien zur Charakterisierung von Texten beitragen und inwiefern sie für die Unterscheidung zwischen Text und „Nicht-Text“ relevant sind. Das Kapitel hinterfragt kritisch die von de Beaugrande und Dressler aufgestellte These, dass das Fehlen eines einzigen Kriteriums den Text als „Nicht-Text“ qualifiziert. Die Diskussion um die Prototypentheorie und die potenziell limitierende Natur der Kriterien bildet einen zentralen Aspekt dieses Kapitels.
3.1 Kohäsion: Dieses Unterkapitel, Teil von Kapitel 3, konzentriert sich auf das Kriterium der Kohäsion. Es beschreibt die Kohäsion als die Art und Weise, wie die Oberflächenstrukturen eines Textes miteinander verknüpft sind. Anhand eines konkreten Beispiels (ein Warnschild) wird die Bedeutung der grammatischen Anordnung für das Verständnis des Textes verdeutlicht. Die verschiedenen Mittel zur Herstellung von Kohäsion (Tempus, Aspekt, Junktion etc.) werden angerissen und ihre Rolle für die Textualität hervorgehoben. Die Analyse dieses einzelnen Kriteriums trägt zum Gesamtverständnis der Textualitätskriterien bei und illustriert die Komplexität der Textanalyse.
Schlüsselwörter
Textlinguistik, Textdefinition, Textualitätskriterien, de Beaugrande, Dressler, Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität, Intertextualität, Prototypentheorie, Text und Nicht-Text.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Textlinguistik-Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Definitionsproblem des Begriffs „Text“ in der Textlinguistik und analysiert die sieben Textualitätskriterien von de Beaugrande und Dressler. Sie untersucht, wie diese Kriterien zur Unterscheidung zwischen Text und „Nicht-Text“ beitragen und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Definitionsproblem des Begriffs „Text“, die sieben Textualitätskriterien nach de Beaugrande und Dressler (Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität und Intertextualität), die Analyse der Kohäsion als Kriterium, die Bewertung der Ausschließlichkeit der Kriterien und die Prototypentheorie als Ansatz zur Textbestimmung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Definitionsproblem des Begriffs „Text“, ein Kapitel zu den Kriterien der Textualität (mit einem Unterkapitel zu Kohäsion), ein Fazit und ein Résumé. Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Herausforderungen bei der Definition eines einheitlichen Textbegriffs. Das Kapitel zum Definitionsproblem beleuchtet verschiedene Perspektiven und Ansätze. Das Kapitel zu den Kriterien analysiert die sieben Kriterien von de Beaugrande und Dressler detailliert. Das Unterkapitel zu Kohäsion veranschaulicht dies anhand eines Beispiels. Das Fazit und Résumé fassen die Ergebnisse zusammen.
Wie werden die sieben Textualitätskriterien behandelt?
Jedes der sieben Textualitätskriterien von de Beaugrande und Dressler wird im Detail erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Arbeit hinterfragt kritisch die These, dass das Fehlen eines einzigen Kriteriums ausreicht, um etwas als „Nicht-Text“ zu klassifizieren. Die Diskussion um die Prototypentheorie und die potenziell limitierende Natur der Kriterien bildet einen zentralen Aspekt.
Welche Rolle spielt die Prototypentheorie?
Die Prototypentheorie wird als ein möglicher Ansatz zur Bewältigung des Definitionsproblems des Begriffs „Text“ diskutiert. Die Arbeit untersucht, inwiefern dieser Ansatz die Herausforderungen bei der Abgrenzung von Text und Nicht-Text bewältigen kann.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen: Textlinguistik, Textdefinition, Textualitätskriterien, de Beaugrande, Dressler, Kohäsion, Kohärenz, Intentionalität, Akzeptabilität, Informativität, Situationalität, Intertextualität, Prototypentheorie, Text und Nicht-Text.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die sieben Textualitätskriterien von de Beaugrande und Dressler zu erläutern, anhand von Beispielen zu veranschaulichen und ihre Relevanz für die Unterscheidung zwischen Text und „Nicht-Text“ zu überprüfen. Die Arbeit untersucht auch das damit verbundene Definitionsproblem des Begriffs „Text“.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit Textlinguistik und Textanalyse befasst. Der Inhalt eignet sich insbesondere für Studierende der Sprachwissenschaften.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2009, Das Definitionsproblem der Kategorie „Text“ am Beispiel der sieben Textualitätskriterien von R.-A. de Beaugrande und W. U. Dressler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174991