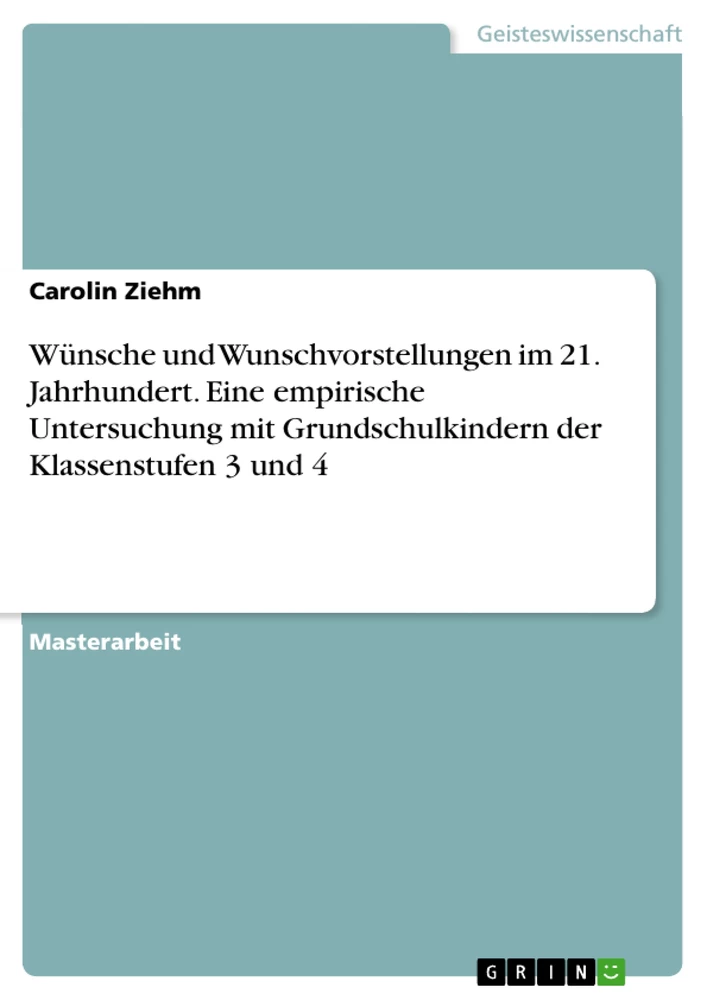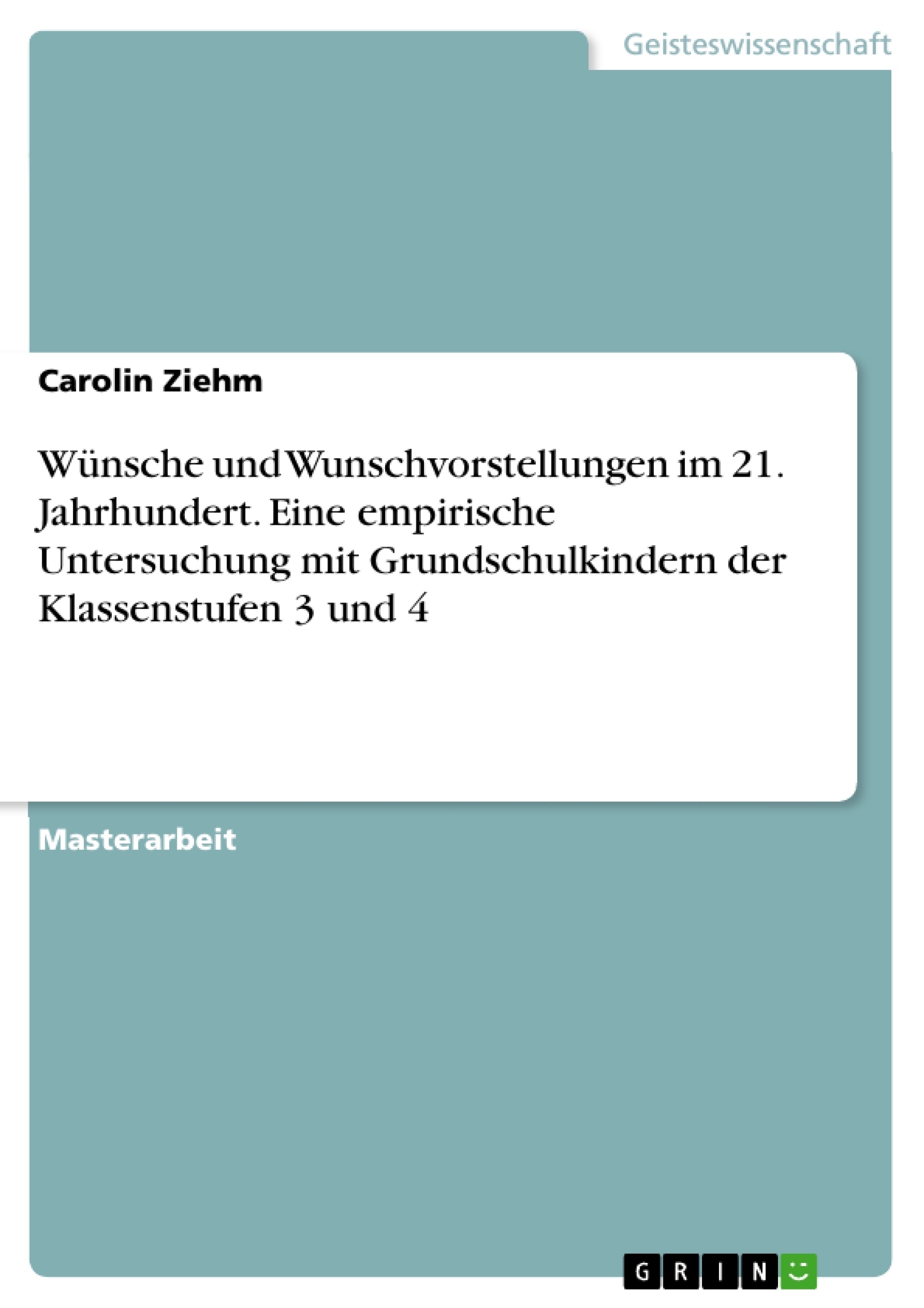Wünsche beherrschen und bestimmen das gesamte Leben eines Menschen. Sie sind Erscheinungen des psychischen Lebens, die uns allen wohl bekannt sind. In der frühen Kindheit treten sie in ihrer ungezähmten Ausdrucksform auf, wenn der Säugling schreit, weil er den Wunsch nach Nahrung besitzt. Ältere Kinder sind bereits in der Lage, ihre gehegten Wünsche zu zügeln und können sie beispielsweise in Form eines Wunschzettels an den Weihnachtsmann übermitteln.
Das Nachdenken über das Wünschen wird von der Menschheit seit dem Bestehen ihrer Existenz vollzogen und zählt thematisch zu den Gegenständen der Auseinandersetzung in der praktischen Philosophie. Namhafte Autoren haben sich über das Wünschen Gedanken gemacht und in ihren Werken zum Ausdruck gebracht.
Die eigenen Wünsche zu realisieren scheint einen positiven Einfluss auf die Qualität des Lebens zu haben. Man wird das eigene Leben nicht als gut oder auch gelungen betrachten, wenn die zentralsten Wünsche unerfüllt bleiben. Daher besitzen unsere Wünsche eine motivationale Funktion, die Handlungen verursachen können. Die Menschen bewerten demnach eine Handlung als gut, wenn sie dazu beitragen kann, dass die eigenen Wünsche realisiert werden. Als Wünschende sind wir demnach von einer Sache in Anspruch genommen, die uns ergreift und bewegt. Doch was genau heißt es, einen Wunsch zu haben? Was bedeutet es, sich etwas zu wünschen und welche Formen kann es annehmen? Was wünschen sich Kinder und welche Vorstellungen besitzen sie zu ihren Wünschen?
Auf all diese Frage versucht die vorliegende Abhandlung mit dem Titel „Wünsche und Wunschvorstellungen im 21. Jahrhundert. Eine empirische Untersuchung mit Grundschulkindern der Klassenstufen 3 und 4“ Antworten zu finden und sie zu begründen. Aus dieser Überschrift für die gesamte Darstellung können bereits die Schwerpunkte für die Vorgehensweise der Bearbeitung abgeleitet werden. Das Ziel der Arbeit ist es, eine Untersuchung über die Wunschvorstellungen von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen der Grundschule durchzuführen. Wie genau diese Zielstellung beschaffen ist und welche konkreten Aspekte dabei betrachtet werden sollen, wird nun ausführlich erläutert, indem der Aufbau der Schrift vorgestellt wird. Den Anfang der Beschäftigung mit dem Thema bilden theoretische Überlegungen zum Wünschen und den Wunschvorstellungen. Dazu wird zu allererst der Begriff des Wunsches geklärt und vorgestellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wunsch und Wunschvorstellungen - Theoretische Überlegungen zum Gegenstand
- 2.1 Klärungsversuche des philosophischen Begriffes
- 2.2 Differenzierung und Abgrenzung des Begriffes von verwandten Sachverhalten des menschlichen Verhaltens
- 2.3 Arten und Formen von Wünschen
- 2.4 Geschichtlicher Abriss über die Wunschvorstellungen ausgewählter Autoren
- 3 Empirische Untersuchung über die Wunschvorstellungen von Grundschülern
- 3.1 Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung
- 3.2 Darstellung der eingesetzten empirischen Methode
- 3.3 Umsetzung des Verfahrens in der Grundschule
- 4 Auswertung der eingesetzten empirischen Untersuchung zu den Wunschvorstellungen
- 4.1 Beschreibung der Vorgehensweise zur Auswertung der Fragestellungen
- 4.2 Momentane Wunschvorstellungen
- 4.3 Zukünftige Wunschvorstellungen
- 4.4 Wissen über die Erfüllbarkeit und Unerfüllbarkeit der Wünsche
- 4.5 Selbstreflexion für notwendige Handlungen zur Wunschrealisierung
- 4.6 Moralische Wünsche
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Wünsche und Wunschvorstellungen von Grundschulkindern der Klassenstufen 3 und 4. Ziel ist es, empirisch zu ergründen, welche Wünsche die Kinder hegen, wie sie deren Erfüllbarkeit einschätzen und welche Rolle Selbstreflexion und Moral dabei spielen. Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen zum Begriff des Wunsches mit der Auswertung der empirischen Daten.
- Der philosophische Begriff des Wunsches und seine Abgrenzung zu verwandten Begriffen.
- Arten und Formen von Wünschen.
- Die momentanen und zukünftigen Wünsche von Grundschulkindern.
- Die Einschätzung der Erfüllbarkeit von Wünschen durch die Kinder.
- Die Rolle der Selbstreflexion und moralischer Aspekte im Kontext von Wünschen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wünsche und Wunschvorstellungen ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Wunschvorstellungen von Grundschulkindern empirisch zu untersuchen. Sie hebt die Bedeutung von Wünschen für das menschliche Leben hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der theoretische Überlegungen mit der Präsentation und Auswertung der empirischen Untersuchung verbindet. Die Einleitung stellt klar, dass die Arbeit sich mit den verschiedenen Aspekten des Wunschens auseinandersetzt, von der philosophischen Begriffsklärung bis hin zur praktischen Untersuchung der Wünsche von Grundschulkindern.
2 Wunsch und Wunschvorstellungen - Theoretische Überlegungen zum Gegenstand: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die empirische Untersuchung. Es klärt den philosophischen Begriff des Wunsches, grenzt ihn von verwandten Begriffen wie Willen, Entscheidung und Gefühlen ab und differenziert verschiedene Arten und Formen von Wünschen. Ein historischer Abriss beleuchtet verschiedene Sichtweisen auf das Wünschen im Laufe der Geschichte, um den Kontext der aktuellen Untersuchung zu verdeutlichen. Das Kapitel dient als methodische Basis für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Studie und liefert ein Verständnis für die Komplexität des Phänomens "Wünschen".
3 Empirische Untersuchung über die Wunschvorstellungen von Grundschülern: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert den Gegenstand und die Zielsetzung der Untersuchung, die Methode, die zur Datenerhebung eingesetzt wurde, und deren Umsetzung in der Grundschule. Es skizziert die Vorgehensweise und das methodische Design, um die methodische Güte der Untersuchung zu gewährleisten. Die präzise Beschreibung der Methodik ist essentiell für die Nachvollziehbarkeit und die Beurteilung der Ergebnisse der Studie.
Schlüsselwörter
Wünsche, Wunschvorstellungen, Grundschulkinder, empirische Untersuchung, Philosophie, Selbstreflexion, Moral, Erfüllbarkeit, Motivation, Kindheit.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Wünsche und Wunschvorstellungen von Grundschulkindern
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Wünsche und Wunschvorstellungen von Grundschulkindern der Klassenstufen 3 und 4. Im Mittelpunkt steht die empirische Erforschung der Wünsche der Kinder, ihrer Einschätzung der Erfüllbarkeit dieser Wünsche und der Rolle von Selbstreflexion und Moral in diesem Kontext.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, empirisch zu ergründen, welche Wünsche Grundschulkinder hegen, wie sie die Erfüllbarkeit ihrer Wünsche einschätzen und welche Bedeutung Selbstreflexion und Moral für die Wünsche der Kinder haben. Die Arbeit verbindet dabei theoretische Überlegungen zum Begriff des Wunsches mit der Auswertung empirischer Daten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den philosophischen Begriff des Wunsches und dessen Abgrenzung zu verwandten Begriffen; Arten und Formen von Wünschen; die momentanen und zukünftigen Wünsche von Grundschulkindern; die Einschätzung der Erfüllbarkeit von Wünschen durch die Kinder; und die Rolle der Selbstreflexion und moralischer Aspekte im Kontext von Wünschen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, theoretische Überlegungen zum Begriff des Wunsches, Beschreibung der empirischen Untersuchung, Auswertung der Untersuchungsergebnisse und Schlussbetrachtung. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Zielsetzung. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Kapitel 4 präsentiert und wertet die Ergebnisse aus. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Welche Methode wurde in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die Arbeit beschreibt die eingesetzte empirische Methode detailliert in Kapitel 3. Es wird der Gegenstand und die Zielsetzung der Untersuchung erläutert, sowie die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und deren Umsetzung in der Grundschule. Die präzise Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Ergebnisse gewährleisten.
Welche Aspekte der Wünsche werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Wünsche von Grundschulkindern, darunter momentane und zukünftige Wünsche, die Einschätzung der Erfüllbarkeit der Wünsche, die Rolle der Selbstreflexion bei der Wunschrealisierung und den Einfluss moralischer Überlegungen auf die Wünsche.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in Kapitel 4 präsentiert und ausgewertet. Die Auswertung umfasst die Beschreibung der Vorgehensweise, die Analyse der momentanen und zukünftigen Wünsche, die Einschätzung der Erfüllbarkeit der Wünsche durch die Kinder, die Rolle der Selbstreflexion und die Untersuchung moralischer Wünsche.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in Kapitel 5 zusammengefasst. Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Bedeutung im Kontext der Forschungsliteratur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wünsche, Wunschvorstellungen, Grundschulkinder, empirische Untersuchung, Philosophie, Selbstreflexion, Moral, Erfüllbarkeit, Motivation, Kindheit.
- Quote paper
- Carolin Ziehm (Author), 2010, Wünsche und Wunschvorstellungen im 21. Jahrhundert. Eine empirische Untersuchung mit Grundschulkindern der Klassenstufen 3 und 4, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174846