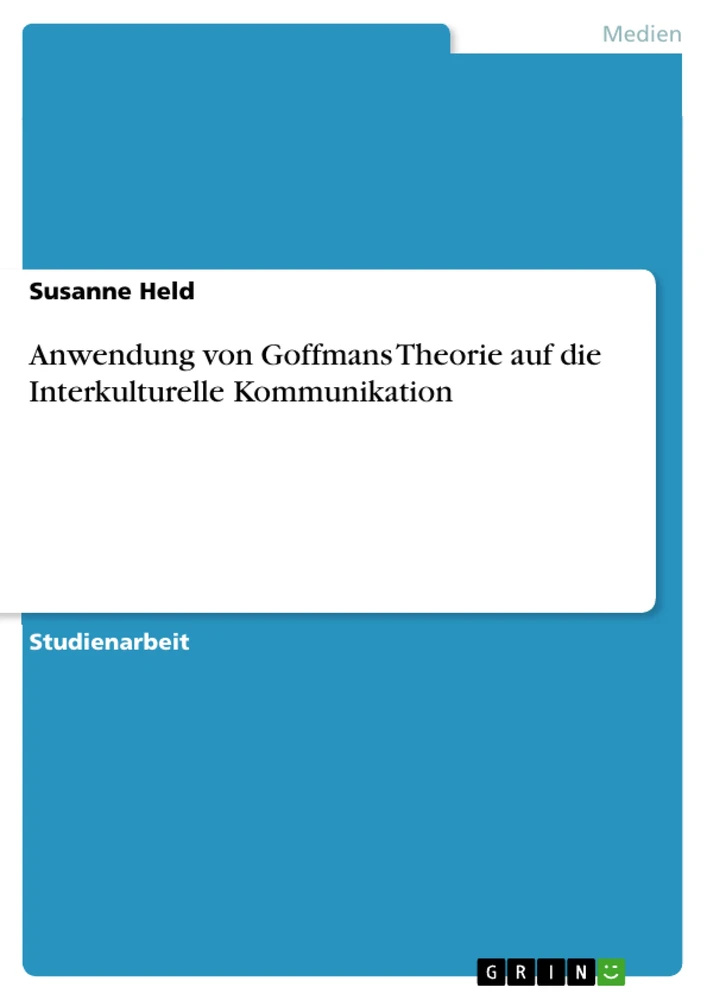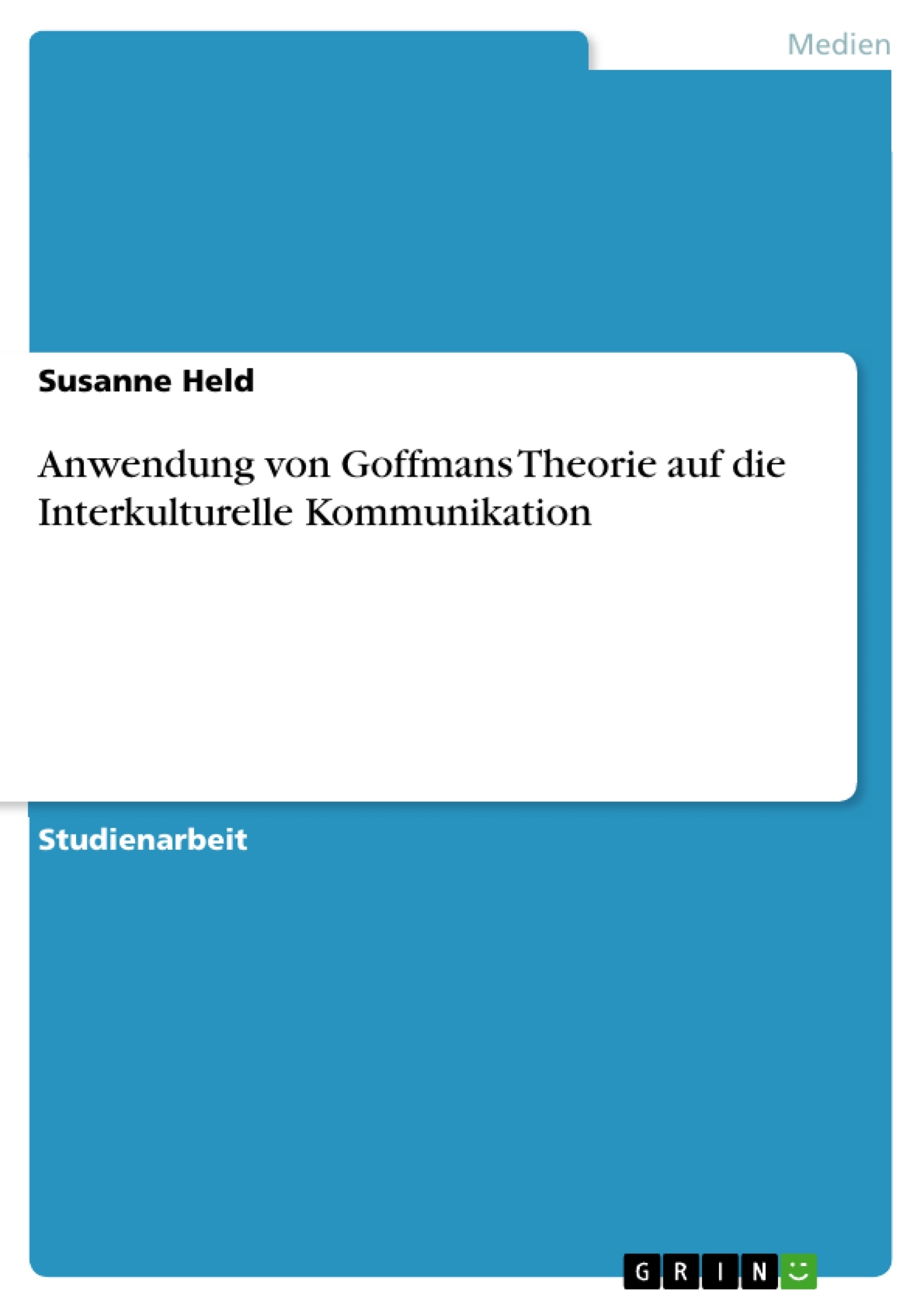„Von unseren allgemeinen dramaturgischen Regeln und Vorlieben für die Handlungsordnung ausgehend, dürfen wir Lebensbereiche in anderen Gesellschaften nicht übersehen, für die anscheinend andere Regeln gelten“,
schreibt Erving Goffman in seinem Werk Wir alle spielen Theater: die Selbstdarstellung im Alltag (1959/2005 , 223). Der kanadische Soziologe betont, dass sein Modell der Dramaturgie des sozialen Handelns nicht unbedingt auf nicht-westliche Gesellschaften übertragbar ist (ebd., 223). Ungeachtet dieser Einschätzung wurden Versuche unternommen, die „Soziologie der Interaktionsordnung“ eines der bedeutendsten amerikanischen Soziologen des 20. Jahrhunderts (1922-1982) auch auf andere kulturelle Kontexte zu übertragen. Dies zeigt z.B. Srinivasans Aufsatz “The cross-cultural relevance of Goffman’s concept of indivicual agengy”, in dem die Verfasserin Goffmans Theorie auf die indische Gesellschaft bezieht (1990, 150ff.).
In einer Zeit, in der Gesellschaften immer stärker durch kulturelle Hybridisierung gekennzeichnet sind und eine Globalisierung sämtlicher Lebensbereiche stattfindet, gewinnen Interaktionen zwischen Personen, die einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund mitbringen, zunehmend an Bedeutung. Wie sich diese abspielen und wodurch sie gekennzeichnet sind, ist Untersuchungsgegenstand der in den 1950ern in den USA entstandenen interdisziplinären Forschung zur Interkulturellen Kommunikation (vgl. Peace Corps (U.S.) 1999, 136). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich Goffmans Interaktionstheorie auch auf einen interkulturellen Kontext übertragen lässt. Lucrecia Keim ist der Ansicht, dass der Soziologe „mit seinen detaillierten Analysen der rituellen Ordnung des Alltagshandelns interessante Anhaltspunkte für die Analyse interkultureller Kommunikation [bietet]“ (1994, 22). Welchen Beitrag leistet Goffmans Theorie zum Verständnis kultureller Überschnei-dungssituationen? Inwieweit wird sie bisher in der Interkulturellen Kommunikations-Forschung rezipiert und angewendet? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit unter-sucht werden. Veröffentlichungen, die einen Überblick zu diesem Thema geben, konnten nicht ausfindig gemacht werden. An dieser Forschungslücke setzt die vorliegende Arbeit an.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Goffmans Interaktionstheorie
- 2.1 Rahmen
- 2.2 Selbstdarstellung des Individuums
- 2.3 Interaktionsrituale
- 2.4 Image
- 2.5 Stigmatisierung
- 3. Theorien Interkultureller Kommunikation
- 3.1 Kulturbegriff
- 3.2 Interkulturelle Interaktionen
- 3.3 Bezüge zu Goffman in IKK-Überblickswerken
- 4. Anwendung von Goffmans Interaktionstheorie auf die IKK
- 4.1 Keims Untersuchung deutsch-spanischer Wirtschaftskommunikation
- 4.1.1 Ziele und Methode der Arbeit
- 4.1.2 Theoretische Bezüge zu Goffman
- 4.1.3 Anwendung der Theorie auf interkulturelle Interaktionen
- 4.2 Peters Anwendung von Goffmans Theorie auf den Migrationskontext
- 4.2.1 Ziele und Methode der Arbeit
- 4.2.2 Theoretische Bezüge zu Goffman
- 4.2.3 Anwendung der Theorie auf interkulturelle Interaktionen
- 4.3 Vergleich und kritische Bewertung der Arbeiten
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Übertragbarkeit von Erving Goffmans Interaktionstheorie auf die Interkulturelle Kommunikation. Ziel ist es, den Beitrag Goffmans Theorie zum Verständnis kultureller Überschneidungssituationen zu analysieren und zu beleuchten, inwieweit sie in der Interkulturellen Kommunikations-Forschung rezipiert und angewandt wird. Die Arbeit beleuchtet Goffmans Theorie sozialer Interaktion mit Fokus auf Rahmen, Selbstdarstellung, Interaktionsrituale, Image und Stigmatisierung. Im Hauptteil werden zwei Publikationen untersucht, die Goffmans Theorie auf die Interkulturelle Kommunikation anwenden: Lucrecia Keims Untersuchung deutsch-spanischer Wirtschaftskommunikation und Manuel Peters Anwendung der Theorie auf den Migrationskontext.
- Anwendung der Interaktionstheorie von Erving Goffman auf interkulturelle Kommunikation
- Analyse der Rezeption von Goffmans Theorie in der Interkulturellen Kommunikationsforschung
- Untersuchung von Beispielen für die Anwendung von Goffmans Theorie auf interkulturelle Interaktionen
- Beurteilung der Relevanz und des Potenzials von Goffmans Theorie für das Verständnis interkultureller Kommunikation
- Entwicklung von Schlussfolgerungen und Ausblicken für die Anwendung von Goffmans Theorie auf die Interkulturelle Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung der Übertragbarkeit von Goffmans Interaktionstheorie auf die Interkulturelle Kommunikation. Kapitel zwei stellt Goffmans Theorie sozialer Interaktion dar, wobei auf sein Konzept des Rahmens, der Selbstdarstellung des Individuums, der Interaktionsrituale, des Images und der Stigmatisierung eingegangen wird. Das dritte Kapitel gibt einen kurzen Überblick über Theorien Interkultureller Kommunikation, wobei verschiedene Kulturkonzepte und Charakteristika interkultureller Interaktionen thematisiert werden. Kapitel vier untersucht beispielhaft zwei Publikationen, die eine Brücke zwischen Goffmans Interaktionsheorie und der Interkulturellen Kommunikation schlagen. Die Autorin der ersten, Lucrecia Keim, bezieht sich bei der Untersuchung deutsch-spanischer Wirtschaftskommunikation auf die rituelle Ordnung des Alltagshandelns des Soziologen (1994). Manuel Peters überträgt in seinem Buch Zur Sozialen Praxis der (Nicht-)Zugehörigkeiten Goffmans Soziologie der Interaktionsordnung auf den Migrationskontext (2009). Ein Vergleich und eine kritische Bewertung der beiden Arbeiten folgen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Goffman, Interaktionstheorie, Rahmen, Selbstdarstellung, Stigmatisierung, Interkulturelle Interaktionen, Kulturspezifik, Wirtschaftskommunikation, Migrationskontext, Soziologie, Dramaturgie des sozialen Handelns.
- Quote paper
- Susanne Held (Author), 2011, Anwendung von Goffmans Theorie auf die Interkulturelle Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172499