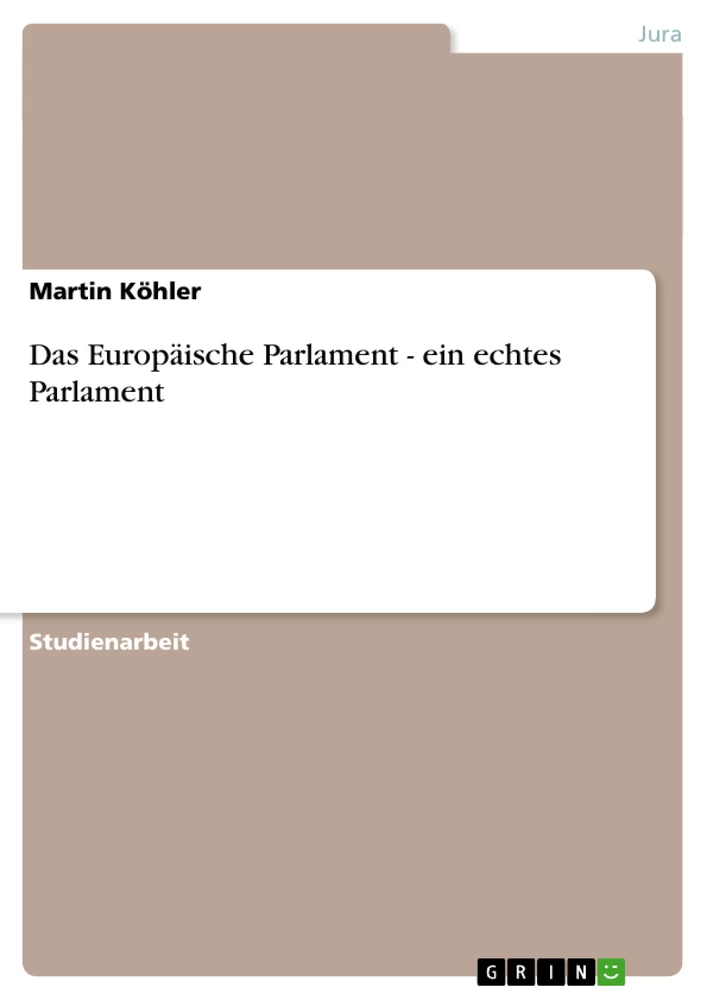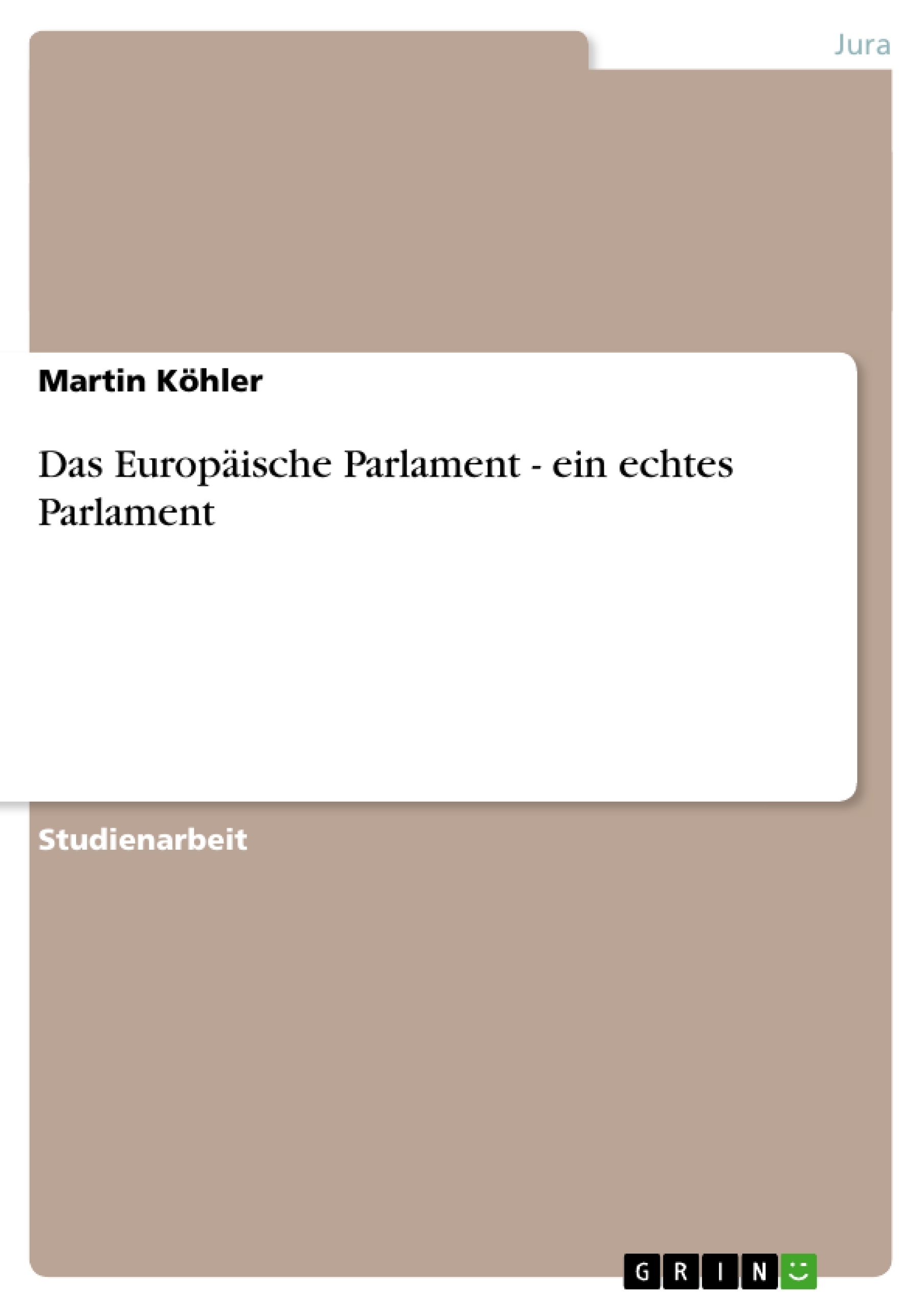Einleitung
Das erste Mal trat das Europäische Parlament gemäß den Bestimmungen des EGKS-Vertrages noch unter dem Namen der „Gemeinsamen Versammlung“ am 10. September 1952 zusammen. Als Kontrollorgan ohne gesetzgeberische Befugnisse gehörten ihm zu diesem Zeitpunkt 78 Abgeordnete an, die von den nationalen Parlamenten entsandt wurden . Bis heute hat sich das Europäische Parlament neben der im Primärrecht verankerten Bezeichnung „Europäisches Parlament“ zahlreiche Rechte erkämpft. Es stellt heute 626 direkt gewählte Abgeordnete und ist in einigen Bereichen dem Rat als Gesetzgeber gleichgestellt. Diese Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, ob das EP im derzeitigen Entwicklungsstadium dem Anspruch eines echten Parlaments gerecht wird. Problematisch erscheint, dass das EP -ebenso wie der Rat und die Kommission auch- einzigartige Organe sind, die sich wesentlich von den nationalen (und internationalen) Gegenstücken unterscheiden und deren Entwicklungsprozess nicht abgeschlossen ist. Im Mittelpunkt wird dennoch die Untersuchung stehen, ob und inwieweit das EP die klassischen Parlamentsfunktionen der nationalstaatlichen Parlamente westeuropäischer Demokratien erfüllt. Zwei Überlegungen führen zu diesem nicht unproblematischen Ansatz:
1) Die Europäischen Gemeinschaften unterliegen dem Prinzip der Supranationalität, d.h., ihr Gemeinschaftsrecht begründet eine Rechtsordnung, die unmittelbar innerstaatlich Rechtswirkung erzeugt. Die Charakterisierung der Gemeinschaften als supranational beinhaltet, dass sie eine neue öffentliche, gegenüber der Staatsgewalt eigenständige Gewalt darstellt, deren Normen unmittelbare Durchgriffswirkung gegenüber den Mitgliedsstaaten und ihren Bürgern haben und Vorrang vor dem innerstaatlichen Recht genießen. In diesen Bereichen sollte daher der Demokratiestandard in demselben Maße gewährleistet sein wie auf nationaler Ebene soweit er mit den Zielen und der Struktur der Organisation vereinbar is. Die Untersuchung wird sich daher auch lediglich auf den supranational ausgerichteten Bereich konzentrieren, d.h. die Europäischen Gemeinschaften als erste und wichtigste Säule der EU. 2) Die kontinuierliche Ausweitung der gemeinschaftlichen Kompetenzen führt zu einer Aushöhlung national-parlamentarischer Kompetenzen, die nur durch vergleichbare Befugnisse des EP auf europäischer Ebene kompensiert werden können. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der europäische Volksbegriff
- Die Wahlen zum Europäischen Parlament
- Die Parlamentsfunktionen
- Die Wahl- und Abberufungsfunktion
- Wahl und Abberufung der Kommission
- Wahl und Abberufung des Rates
- Die Gesetzgebungsfunktion
- Anhörungsverfahren
- Zusammenarbeit
- Zustimmungsverfahren
- Mitentscheidungsverfahren
- Haushaltsverfahren
- Vorschlagsrecht im Bereich der „obligatorischen Ausgaben“
- Änderungsrecht im Bereich der „nicht-obligatorischen Ausgaben“
- Gesamtablehnung des Haushalts
- Beurteilung der Gesetzgebungsfunktion
- Die Gesetzgebungsverfahren
- Beurteilung der Haushaltsfunktion
- Die Kontrollfunktion
- Kontrollrechte gegenüber der Kommission
- Kontrollrechte gegenüber dem Rat
- Organunabhängige Kontrollrechte
- Gerichtliche Kontrollen
- Haushaltskontrolle
- Bürgerbeauftragter
- Petitionsrecht
- Untersuchungsausschuss
- Beurteilung der Kontrollfunktion
- Die Repräsentationsfunktion
- Die Kommunikationsfunktion
- Beurteilung der Repräsentations- und Kommunikationsfunktion
- Die Wahl- und Abberufungsfunktion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht, ob das Europäische Parlament (EP) im derzeitigen Entwicklungsstadium dem Anspruch eines „echten“ Parlaments gerecht wird. Dabei wird die Frage gestellt, inwieweit das EP die klassischen Parlamentsfunktionen nationalstaatlicher Parlamente erfüllt.
- Das Demokratiedefizit der Europäischen Union im Kontext des EP.
- Die Funktionsweise des EP im Vergleich zu nationalstaatlichen Parlamenten.
- Die Rolle des EP in der Gesetzgebung, Kontrolle und Repräsentation der Europäischen Union.
- Die Entwicklung des europäischen Volksbegriffs und dessen Bedeutung für die Legitimation des EP.
- Die Ausweitung gemeinschaftlicher Kompetenzen und die damit verbundene Auswirkung auf nationale Parlamente.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Aufsatz stellt die Frage, ob das Europäische Parlament (EP) als „echtes“ Parlament betrachtet werden kann, wobei die Entwicklung des EP und seine aktuellen Funktionen im Mittelpunkt stehen.
Der europäische Volksbegriff
Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des europäischen Volksbegriffs für die Legitimation des EP und beleuchtet die Frage, ob ein europäisches Volk existiert.
Die Wahlen zum Europäischen Parlament
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Wahlen zum Europäischen Parlament, einschließlich der Wahlmodalitäten und der Rolle des EP in der Wahl der Kommission und des Rates.
Die Parlamentsfunktionen
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Funktionen des EP, darunter die Wahl- und Abberufungsfunktion, die Gesetzgebungsfunktion, die Kontrollfunktion, die Repräsentationsfunktion und die Kommunikationsfunktion.
Fazit und Ausblick
Der letzte Abschnitt des Aufsatzes zieht ein Fazit aus den vorangegangenen Analysen und gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des EP.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Aufsatzes sind das Europäische Parlament, Demokratiedefizit, Supranationalität, Parlamentsfunktionen, europäisches Volk, Gesetzgebung, Kontrolle, Repräsentation, Kommunikation.
- Quote paper
- Martin Köhler (Author), 2003, Das Europäische Parlament - ein echtes Parlament, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17242