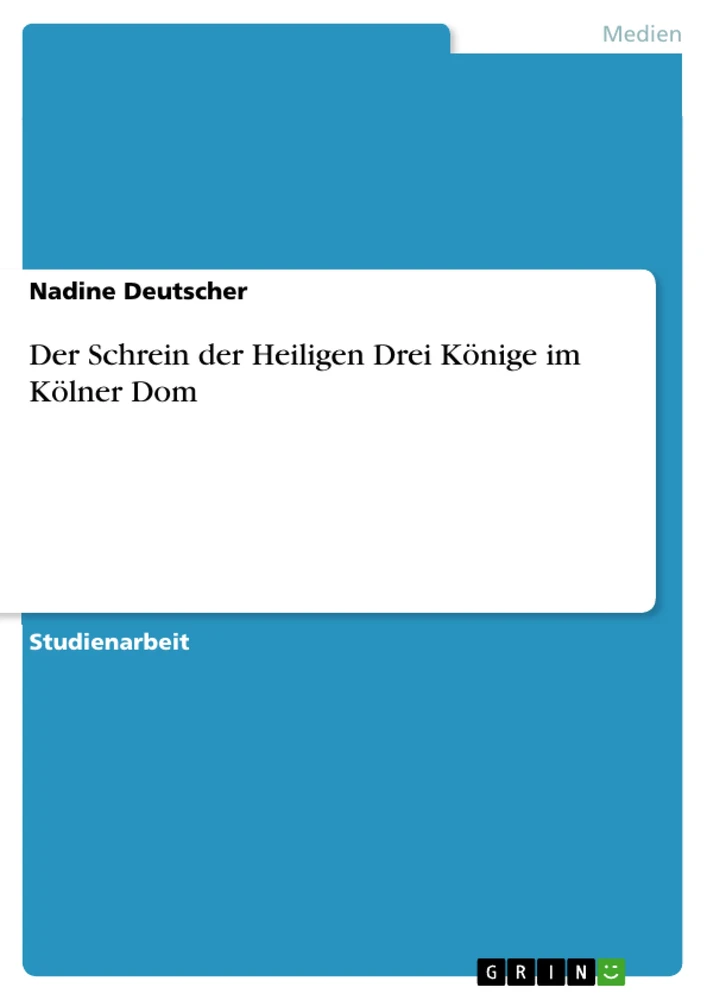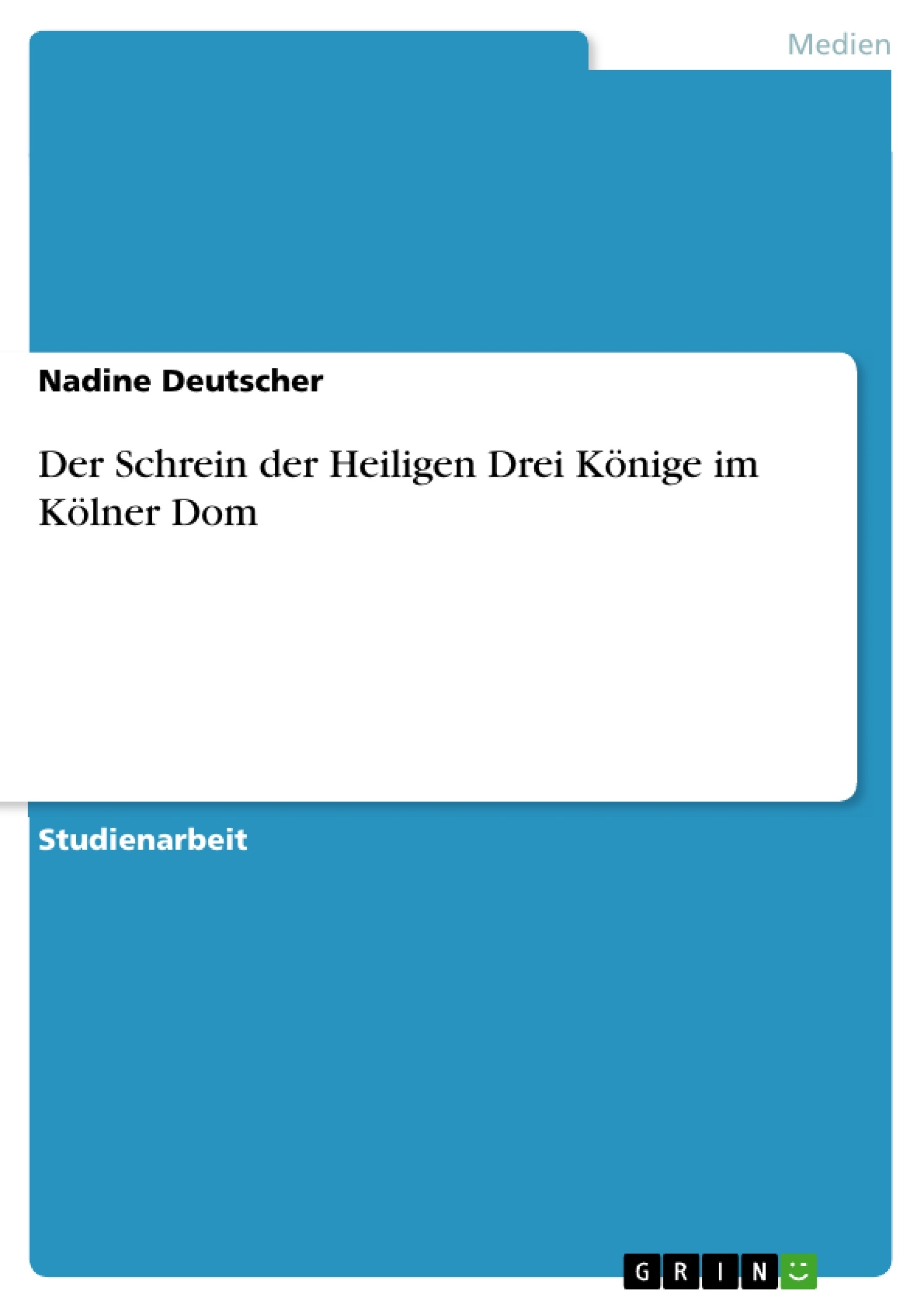Ein Reliquienschrein stellt in der Kunstgeschichte einen Aufbewahrungskasten, in dem die Reliquien von Heiligen aufbewahrt werden, dar.
Diese Arbeit möchte den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom skizzieren. Nach einer kurzen Einleitung, die den Weg der Gebeine von ihrer Fundstelle, über Konstantinopel bis nach Mailand beinhaltet, soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die künstlerische Gestaltung des Schreins gelegt werden.
Unter welchen Umständen kamen die Gebeine nach Köln, welche Personen waren an diesen Translationen beteiligt? Wer gab den Auftrag einen Schrein zu fertigen und wie sollte dieser Aussehen? Welche Materialien waren nötig, wie wurden diese verarbeitet? Wo sollte der Schrein sich befinden und was verrät das Bildprogramm, sollen die zentralen Fragen der Arbeit sein. Leider können hier nicht all die ikonographischen Aspekte des Drei Königen Schreins berücksichtigt werden, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die biblischen Magier
- Die Translationen
- Der Schrein der Heiligen Drei Könige
- Seine Standorte
- Die Stirnseite
- Die Längsseiten
- Die Rückseite
- Das Bildprogramm
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom. Die Zielsetzung ist es, die Geschichte der Gebeine von ihrer Fundstelle bis nach Köln nachzuzeichnen, die künstlerische Gestaltung des Schreins zu analysieren und zentrale Fragen zu klären: Unter welchen Umständen kamen die Gebeine nach Köln? Wer gab den Auftrag zum Schreinbau? Welche Materialien wurden verwendet? Was verrät das Bildprogramm? Aufgrund des Umfangs können nicht alle ikonographischen Aspekte und die positiven Folgen der Translationen für Köln detailliert behandelt werden.
- Die Translationen der Gebeine der Heiligen Drei Könige
- Die künstlerische Gestaltung des Schreins
- Das Bildprogramm des Schreins
- Die Bedeutung der Reliquie für Köln
- Die historische Einbettung des Schreins
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Reliquienschrein als Aufbewahrungsort für Gebeine von Heiligen. Die Arbeit fokussiert sich auf den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom und skizziert die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf behandelt werden. Die Beschränkungen der Arbeit bezüglich der ikonographischen Aspekte und der Folgen der Translationen für Köln werden erwähnt. Die Bedeutung der Reliquie für das Stadtwappen und den Bau des Kölner Doms wird kurz angedeutet.
Die biblischen Magier: Dieses Kapitel befasst sich mit der biblischen Darstellung der Magier aus dem Matthäus-Evangelium, deren Reise nach Bethlehem und deren Gaben an das Jesuskind. Es wird der Unterschied zwischen der biblischen Bezeichnung "Magier" und der späteren Bezeichnung "Könige" erläutert, wobei die Rolle des Erzbischofs von Arles bei der Festlegung der Bezeichnung "Könige" hervorgehoben wird. Die Deutung der Geschenke als königliche Gaben und deren Bedeutung für die spätere Gestaltung des Schreins werden diskutiert.
Die Translationen: Dieses Kapitel schildert die verschiedenen Stationen der Gebeine der Heiligen Drei Könige, beginnend mit der Legende um Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, die die Gebeine in Palästina und Persien gefunden haben soll. Die Überführung nach Konstantinopel, die Übergabe an Eustorgius, Bischof von Mailand, und die 700-jährige Aufbewahrung in Mailand werden beschrieben. Der Fokus liegt auf der Eroberung Mailands durch Friedrich Barbarossa und der Übergabe der Gebeine an Rainald von Dassel, Erzbischof von Köln, im Jahr 1162. Der detaillierte Bericht über die Reise nach Köln und die feierliche Überführung im Jahr 1164 wird dargelegt, einschließlich der Rückgabe kleinerer Teile der Gebeine nach Mailand im Jahr 1903.
Der Schrein der Heiligen Drei Könige: Dieses Kapitel beschreibt den Schrein selbst, seinen Auftraggeber, Erzbischof Philipp von Heinsberg, und seine Fertigstellung um 1225. Die Materialien (Eichenholz, vergoldetes Silber, Gold, Kupfer), die Abmessungen und die Geschichte von Restaurationen, die zu Kürzungen und Verlängerungen des Schreins und zu Positionswechseln der Figuren führten, werden detailliert dargelegt.
Schlüsselwörter
Schrein der Heiligen Drei Könige, Köln, Reliquie, Translationen, Friedrich Barbarossa, Rainald von Dassel, Philipp von Heinsberg, Matthäus-Evangelium, Magier, Könige, künstlerische Gestaltung, Bildprogramm, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen zum Schrein der Heiligen Drei Könige
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text analysiert die Geschichte der Gebeine, die künstlerische Gestaltung des Schreins und sein Bildprogramm.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende zentrale Themen: Die biblischen Magier und ihre Darstellung im Matthäus-Evangelium; die verschiedenen Translationen (Überführungen) der Gebeine der Heiligen Drei Könige von Palästina über Mailand nach Köln; die Geschichte des Schreins selbst, einschließlich seines Bauherrn, der verwendeten Materialien und der Restaurierungsarbeiten; eine Analyse des Bildprogramms des Schreins; und die historische Bedeutung der Reliquie für Köln.
Wer waren die Auftraggeber des Schreins?
Der Schrein wurde im Auftrag von Erzbischof Philipp von Heinsberg um 1225 fertiggestellt.
Welche Materialien wurden für den Schrein verwendet?
Der Schrein besteht aus Eichenholz, vergoldetem Silber, Gold und Kupfer.
Welche Bedeutung hat die Reliquie für Köln?
Die Reliquie der Heiligen Drei Könige hat eine immense Bedeutung für Köln. Sie ist untrennbar mit der Geschichte der Stadt verbunden und wird im Text kurz in Bezug auf das Stadtwappen und den Bau des Kölner Doms erwähnt. Der Text fokussiert sich jedoch stärker auf die kunsthistorischen und religionsgeschichtlichen Aspekte.
Wie beschreibt der Text die Translationen der Gebeine?
Der Text beschreibt detailliert die verschiedenen Stationen der Gebeine, beginnend mit der Legende um Helena, Mutter Kaiser Konstantins. Er verfolgt ihren Weg von Palästina über Konstantinopel und Mailand bis nach Köln im Jahr 1164 durch Rainald von Dassel. Die Rückgabe kleinerer Teile der Gebeine nach Mailand im Jahr 1903 wird ebenfalls erwähnt.
Was ist das Ziel des Textes?
Der Text verfolgt das Ziel, die Geschichte der Gebeine der Heiligen Drei Könige nachzuzeichnen, die künstlerische Gestaltung des Schreins zu analysieren und zentrale Fragen zu seiner Entstehung und Bedeutung zu klären. Dazu gehören die Umstände der Ankunft der Gebeine in Köln, der Auftraggeber des Schreins, die verwendeten Materialien und die Interpretation seines Bildprogramms.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Die biblischen Magier, Die Translationen, Der Schrein der Heiligen Drei Könige und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Text verbunden?
Schlüsselwörter des Textes sind: Schrein der Heiligen Drei Könige, Köln, Reliquie, Translationen, Friedrich Barbarossa, Rainald von Dassel, Philipp von Heinsberg, Matthäus-Evangelium, Magier, Könige, künstlerische Gestaltung, Bildprogramm, Mittelalter.
Gibt es Einschränkungen im Text?
Aufgrund des Umfangs können nicht alle ikonographischen Aspekte und die positiven Folgen der Translationen für Köln detailliert behandelt werden.
- Quote paper
- Nadine Deutscher (Author), 2010, Der Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171523