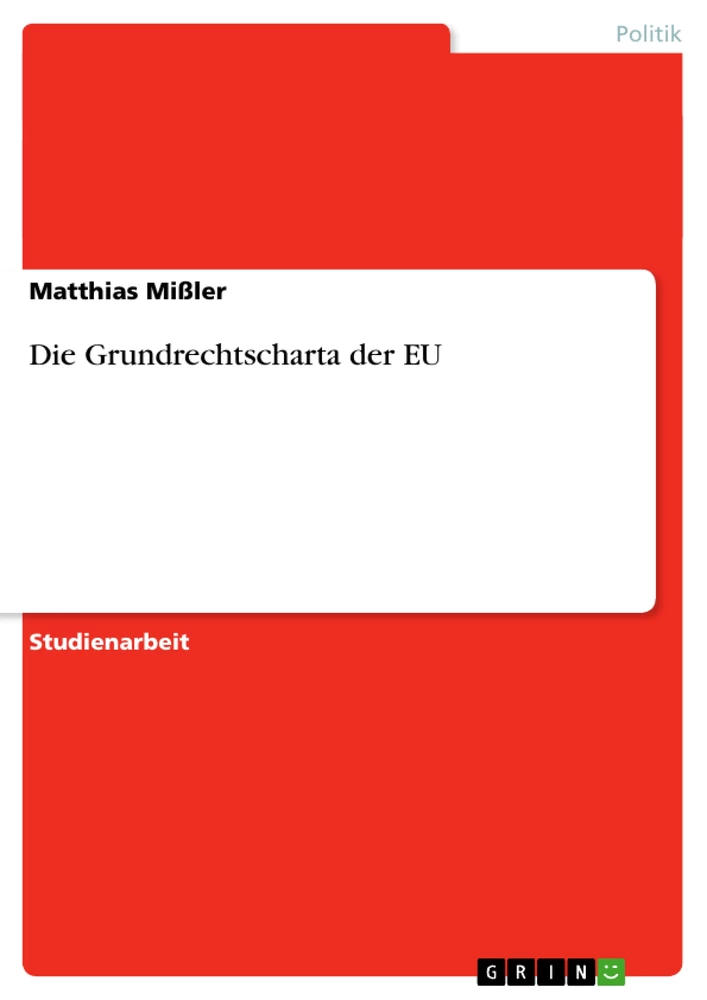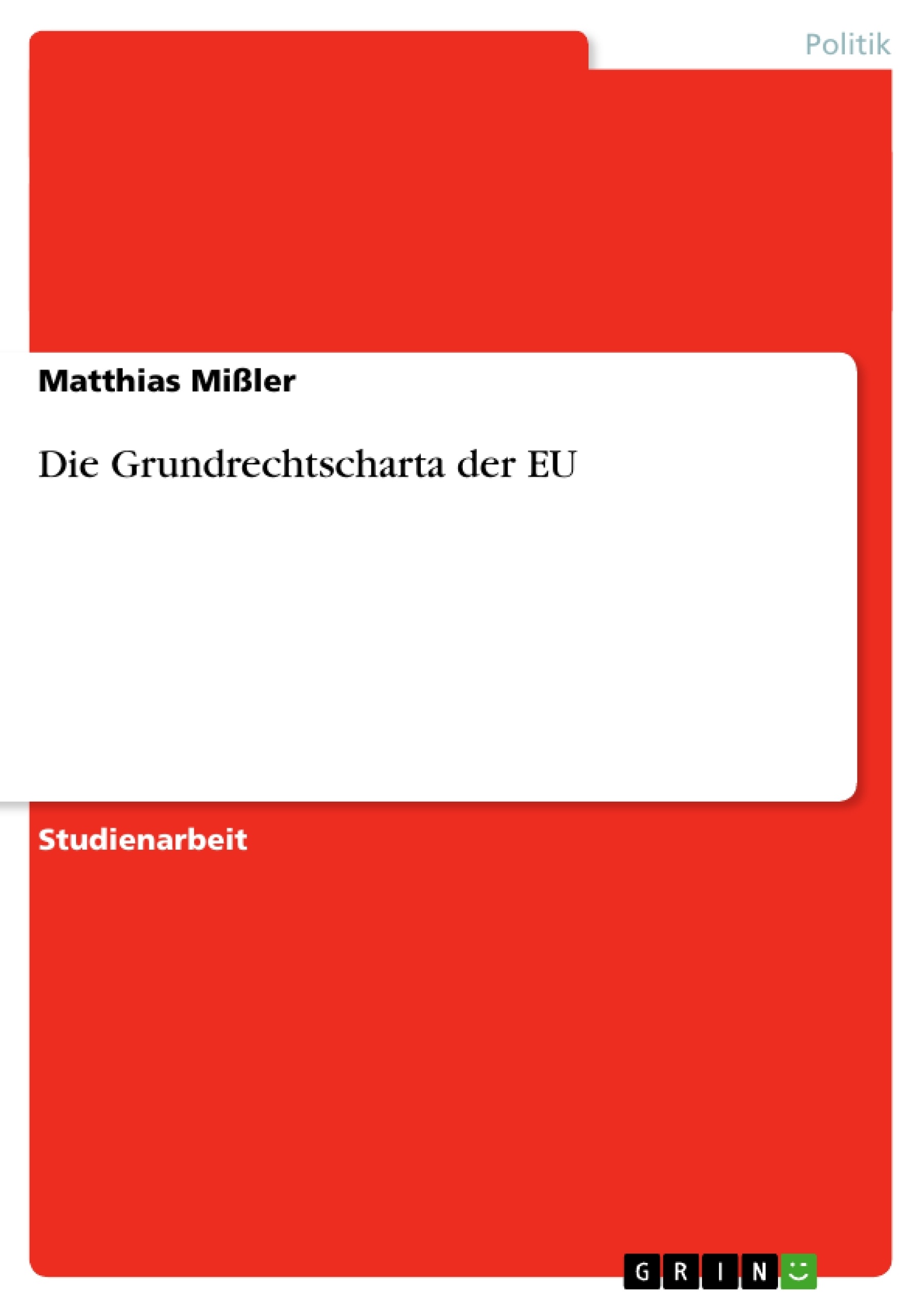Der „Status quo“ der europäischen Integration nach Amsterdam warf einige Fragen hinsichtlich der Verfasstheit der Europäischen Union (EU) auf. Die Debatte, ob die EU eine Verfassung braucht, ist allerdings eine weitgehend deutsche Diskussion. In Frankreich oder Großbritannien gründet die nationale Identität größtenteils auf ihre Geschichte und auf Traditionen. Die junge Bundesrepublik hingegen stand nach dem zweiten Weltkrieg vor der Frage, woran sich die nationale Identität festmachen könnte. Das Grundgesetz entwickelte sich rasch zu einem Pfeiler des bundesrepublikanischen Selbstverständnisses. Dolf Sternberger führte den Begriff des „Verfassungspatriotismus“1 an, wenn es um die Basis für die nationale Identität der Deutschen ging. Es ist deshalb auch nicht weiter verwunderlich, dass gerade der deutsche Außenminister Joschka Fischer mit seiner Rede vor dem Europäischen Parlament im Januar 1999 und im Mai an der Berliner Humboldt-Universität die Verfassungsdiskussion wieder in den Mittelpunkt hob.
In der Geschichte der europäischen Einigung gab es des öfteren Versuche, das zusammenwachsende Europa mit einer Verfassung auszustatten. Dass es allerdings immer noch keine EU-Verfassung gibt, hängt wohl damit zusammen, dass erheblich an der „Verfassungswürdigkeit“ der EU gezweifelt wird. Die EU ist in ihrer völker- und staatsrechtlichen Struktur ein einmaliges Gebilde, bei dem es sich laut Bundesverfassungsgericht um einen „Staatenverbund“ handelt. Es ist allerdings auch fraglich, ob es Sinn macht, wenn man eine Verfassung für eine Gemeinschaft ausarbeitet, in der die einzelnen Mitgliedstaaten und deren Bürger noch ein rein nationalstaatliches Denken an den Tag legen. Des Weiteren sind auch weite Teile der politischen und gesellschaftlichen Infrastruktur (Parteien, Verbände und Medien) noch rein nationalstaatlich geprägt. Trotz dieser gesellschaftlichen Situation zielten die Forderungen der unterschiedlichen politischen Vertreter in Deutschland alle in Richtung einer Verfassung. Der CDU/CSU ging es dabei um einen „Verfassungsvertrag“, der die Grundwerte der EU beinhalten, zum anderen aber auch die Zuständigkeiten zwischen der EU, den Nationalstaaten und den Regionen festschreiben sollte. In dieser Forderung ging es der CDU/CSU v.a. darum, die „Allzuständigkeit“ der EU, die befürchtete Zentralisierung nach Brüssel, zu verhindern. Die FDP plädierte für eine „staatlich verfasste föderale EU“. Der Verfassungsvertrag sollte nach ihrer Meinung zu einer europäischen Verfassung weiterentwickelt und dann per Volksabstimmung bestätigt werden. Die Grünen forderten eine europäische Grundrechtscharta, die gewährleisten sollte, dass die EU-Bürgerrechte und die rechtsstaatlichen Grundrechte respektiert werden
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundrechtssicherheit vor der Proklamierung der Grundrechtscharta
- Interdependenz zwischen der Rechtsprechung des EuGH und den Verfassungen der Mitgliedstaaten
- Einfluss der EMRK auf die Grundrechtssituation in Europa Vor der Charta
- Notwendigkeit einer Grundrechtscharta für die Europäische Union
- Die neue ,,Konvents-Methode“ und ihre Vor- und Nachteile
- Die Zusammensetzung des Konvents
- Schwächen der klassischen Verhandlungsmethode
- Vor- und Nachteile der „Konvents-Methode“
- Der Verlauf der Ausarbeitung de Charta
- Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Grundrechtscharta der EU, insbesondere mit ihrem Entstehungsprozess und ihrer Bedeutung für die demokratische Legitimation der EU. Die Arbeit analysiert die Grundrechtssituation vor der Proklamierung der Charta, erörtert die Notwendigkeit einer solchen Charta für die Europäische Union und untersucht die Vor- und Nachteile der „Konvents-Methode“, die bei der Ausarbeitung der Charta Anwendung fand.
- Grundrechtssicherheit vor der Grundrechtscharta
- Notwendigkeit einer Grundrechtscharta für die EU
- Die „Konvents-Methode“ als Erarbeitungsmethode der Charta
- Die demokratische Legitimation der EU
- Zukünftige Verfassungsentwicklung der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Debatte um eine Verfassung für die EU und die Rolle der Grundrechte im Kontext der europäischen Integration. Sie betont die Bedeutung des Grundgesetzes für das deutsche Selbstverständnis und stellt die verschiedenen Positionen deutscher Politiker zur Frage einer EU-Verfassung dar.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Grundrechtssicherheit vor der Proklamierung der Grundrechtscharta. Hier wird die Interdependenz zwischen der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und den Verfassungen der Mitgliedstaaten sowie der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) auf die Grundrechtssituation in Europa vor der Charta beleuchtet.
Das dritte Kapitel argumentiert für die Notwendigkeit einer Grundrechtscharta für die Europäische Union. Es beleuchtet die Integrationspolitische Bedeutung der Charta und skizziert die Entstehungsprozesse der Charta, die auf Initiative der Bundesregierung im Juni 1999 in Köln ihren Anfang nahm.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der „Konvents-Methode“ als Instrument für die Ausarbeitung der Grundrechtscharta. Es analysiert die Zusammensetzung des Konvents, die Schwächen der klassischen Verhandlungsmethode und beleuchtet Vor- und Nachteile der „Konvents-Methode“. Darüber hinaus wird der Verlauf der Ausarbeitung der Charta dargestellt, die ihren Höhepunkt im Dezember 2000 auf dem Gipfel in Nizza fand.
Schlüsselwörter
Grundrechtscharta der EU, Europäische Union, demokratische Legitimation, EU-Verfassung, Konvents-Methode, Grundrechtsschutz, Europäischer Gerichtshof, Europäische Menschenrechtskonvention, Integrationspolitik, Verhandlungsmethode, Verfassungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die EU-Grundrechtscharta ins Leben gerufen?
Die Charta wurde entwickelt, um die Grundrechte der EU-Bürger sichtbarer zu machen und die demokratische Legitimation der Europäischen Union zu stärken.
Was versteht man unter der "Konvents-Methode"?
Es handelt sich um ein transparentes Erarbeitungsverfahren, bei dem Vertreter von Regierungen, Parlamenten und der Zivilgesellschaft gemeinsam an einem Verfassungsentwurf arbeiten, statt dies nur in geheimen Regierungsverhandlungen zu tun.
Wie war die Grundrechtssituation vor der Charta?
Vor der Charta basierte der Grundrechtsschutz primär auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
Welche Rolle spielte Deutschland bei der Verfassungsdiskussion?
Deutschland war ein starker Befürworter; insbesondere Joschka Fischer rückte das Thema 1999 durch seine Reden wieder ins Zentrum der europäischen Politik.
Was ist "Verfassungspatriotismus"?
Ein von Dolf Sternberger geprägter Begriff, der beschreibt, dass sich nationale Identität nicht auf Herkunft, sondern auf die Identifikation mit demokratischen Verfassungswerten gründet.
- Citation du texte
- Matthias Mißler (Auteur), 2001, Die Grundrechtscharta der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17133