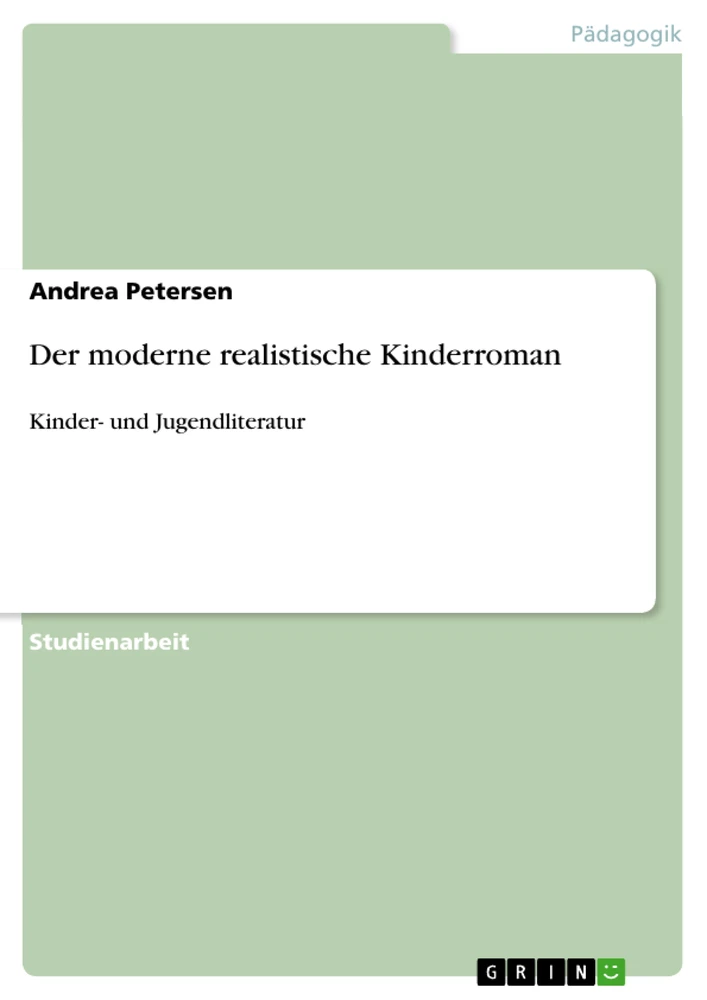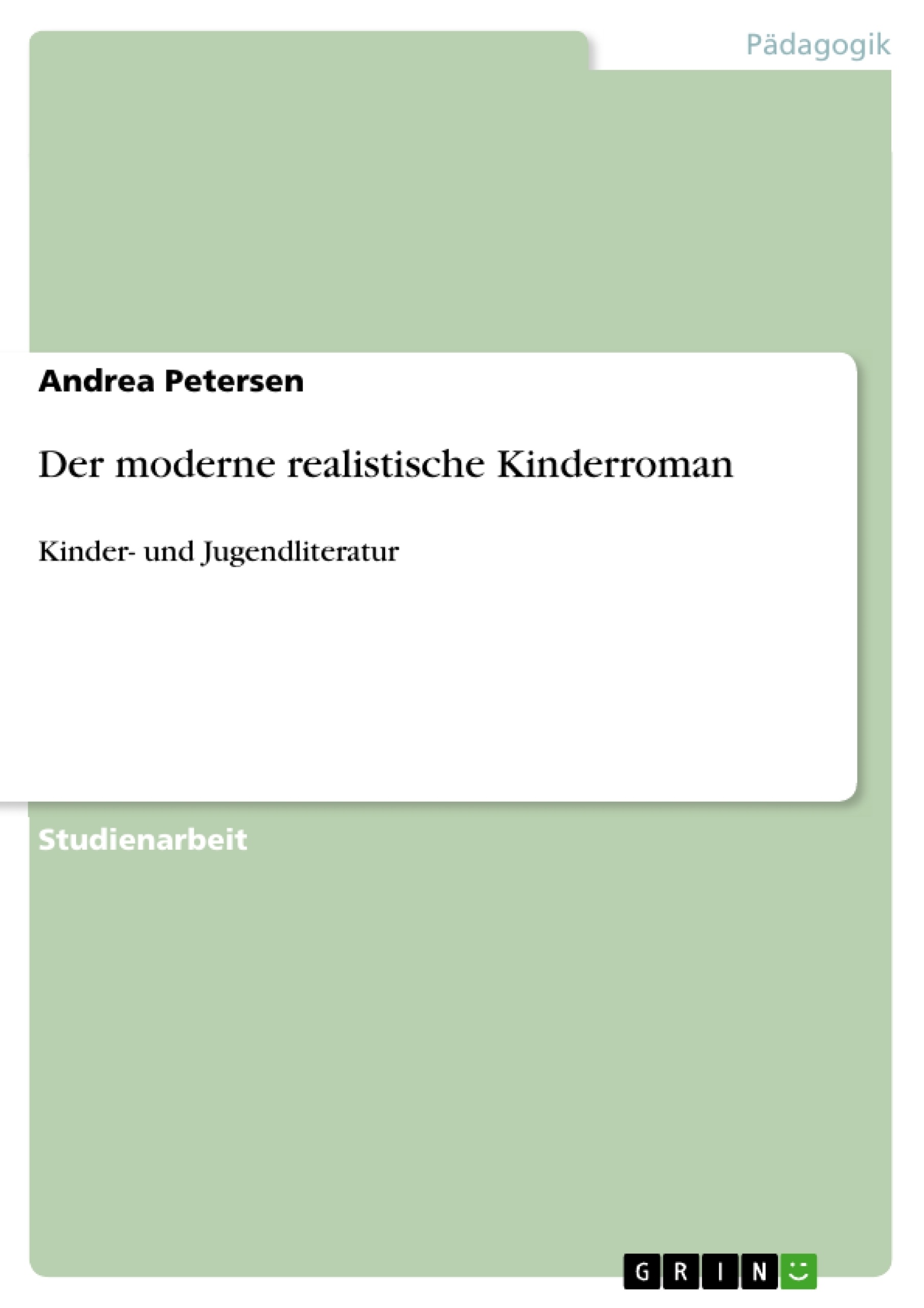Der Begriff der Kinder- und Jugendliteratur hat mittlerweile mehrere Bedeutungen: Es gibt bestimmte Texte die sich für Kinder eignen, obwohl diese ursprünglich nicht als Adressaten gedacht waren, zum Beispiel Fabeln, Märchen oder Reime. Ab dem 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, wurden Texte speziell für Kinder verfasst und mit der Zeit entstanden viele fiktionale und nichtfiktionale Texte, die Gesamtheit der Kinder- und Jugendliteratur. Es bildet sich ein eigenständiges gesellschaftliches bzw. literarisches Handlungs- und Symbolsystem heraus. Trotz dieser verschiedenen Bedeutungen hat die Kinder- und Jugendliteratur bis heute, durch das Festsetzen von Normen, hauptsächlich eine moralisch- soziale Funktion bzw. Erziehungsfunktion, sie dient also als didaktisches Instrument.
Seit dem 18. Jahrhundert ist sie durch zwei Wesens- bzw. Funktionsbestimmungen gekennzeichnet. Zum einen ist der Ausgangspunkt die Gesellschaft, denn den Kindern und Jugendlichen werden Inhalte, Normen und Werte vermittelt die für das Heranwachsen bzw. für das Leben in einer Gemeinschaft bedeutend sind. Sie sollen über die Literatur erzogen und zu handlungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft gemacht werden. Zum anderen ist der Ausgangspunkte das kindliche Subjekt, die Kinder- und Jugendliteratur muss sich also den aktuellen Bedürfnissen anpassen.
In der modernen Kinder- und Jugendliteratur geht es also nicht nur darum zu fragen, ob der Text auch hinsichtlich der kindlichen Auffassungsgabe angepasst ist, sondern inwieweit der Text die Wirklichkeit authentisch erfasst. Ein solcher Blickwinkel macht aufgrund historischer, thematischer und formaler Gesichtspunkte eine Unterscheidung der Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur in problemorientierten- bzw. sozialkritischen Kinderroman, psychologischen, komischen und fantastischen Kinderroman, möglich. I
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zum Begriff der (modernen) Kinder- und Jugendliteratur
- 2 Realismus und Realität im Kinderbuch
- 3 Der problemorientierte Kinderroman
- 3.1 Beispiel: Peter Härtling: „Oma“ (1975)
- 4 Der psychologische Kinderroman
- 4.1 Beispiel: Gudrun Mebs: „Sonntagskind“ (1983)
- 5 Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den modernen realistischen Kinderroman und analysiert seine Entwicklung im Kontext der gesellschaftlichen und literarischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts. Dabei wird insbesondere auf die Frage eingegangen, wie sich die Darstellung von Realität in Kinderbüchern von der autoritären Erziehungsliteratur des 19. Jahrhunderts bis hin zu den sozialkritischen und psychologischen Kinderromanen des späten 20. Jahrhunderts entwickelt hat.
- Entwicklung des Realismusbegriffs in der Kinder- und Jugendliteratur
- Der Einfluss gesellschaftlicher Strömungen auf die Kinderliteratur
- Der Wandel von der autoritären zur antiautoritären Kinderliteratur
- Die Darstellung von Problemen und Konflikten im modernen Kinderroman
- Die Bedeutung der psychologischen Dimension im Kinderroman
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Kinder- und Jugendliteratur und seiner Entwicklung. Es werden die verschiedenen Funktionen und Merkmale dieser Gattung erläutert sowie der Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Werten auf die literarische Produktion diskutiert. Das zweite Kapitel widmet sich dem Realismusbegriff in der Kinderliteratur und beleuchtet die besondere Herausforderung, die Wirklichkeit in fiktionalen Texten für Kinder darzustellen. Dabei werden sowohl die Grenzen des Realismus als auch die Bedeutung von Fantasie und Imagination im Kontext realistischer Erzählungen hervorgehoben. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem problemorientierten Kinderroman, der sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen und Problemen auseinandersetzt. Hier wird am Beispiel von Peter Härtlings „Oma“ (1975) gezeigt, wie der Kinderroman wichtige Themen wie Tod und Trauer aufgreifen und gleichzeitig den Bedürfnissen der jungen Leser gerecht werden kann. Das vierte Kapitel widmet sich dem psychologischen Kinderroman, der sich mit den innerpsychischen Prozessen von Kindern auseinandersetzt. Das Beispiel von Gudrun Mebs' „Sonntagskind“ (1983) veranschaulicht, wie die Kinderliteratur die psychischen und emotionalen Erfahrungen von Kindern in den Fokus rücken kann.
Schlüsselwörter
Moderner realistischer Kinderroman, Kinder- und Jugendliteratur, Realismus, Realität, Problemorientierter Kinderroman, Sozialkritik, Psychologischer Kinderroman, Antiautoritär, Erziehung, Gesellschaft, Fantasie, Imagination, Adaption, Perspektivenwandel.
- Quote paper
- Andrea Petersen (Author), 2005, Der moderne realistische Kinderroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171089