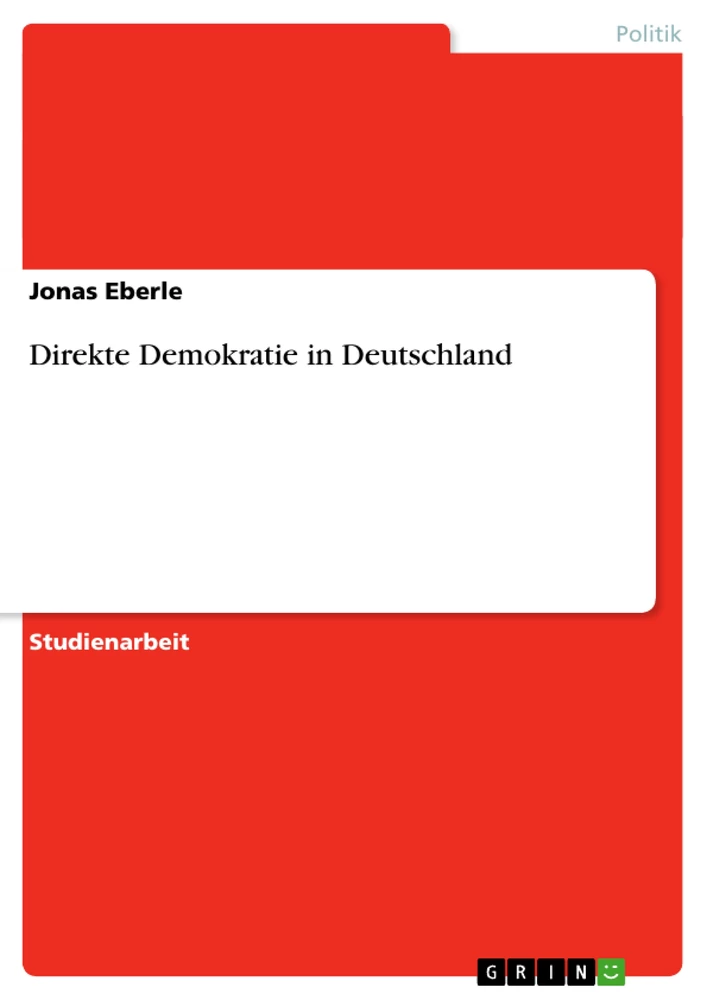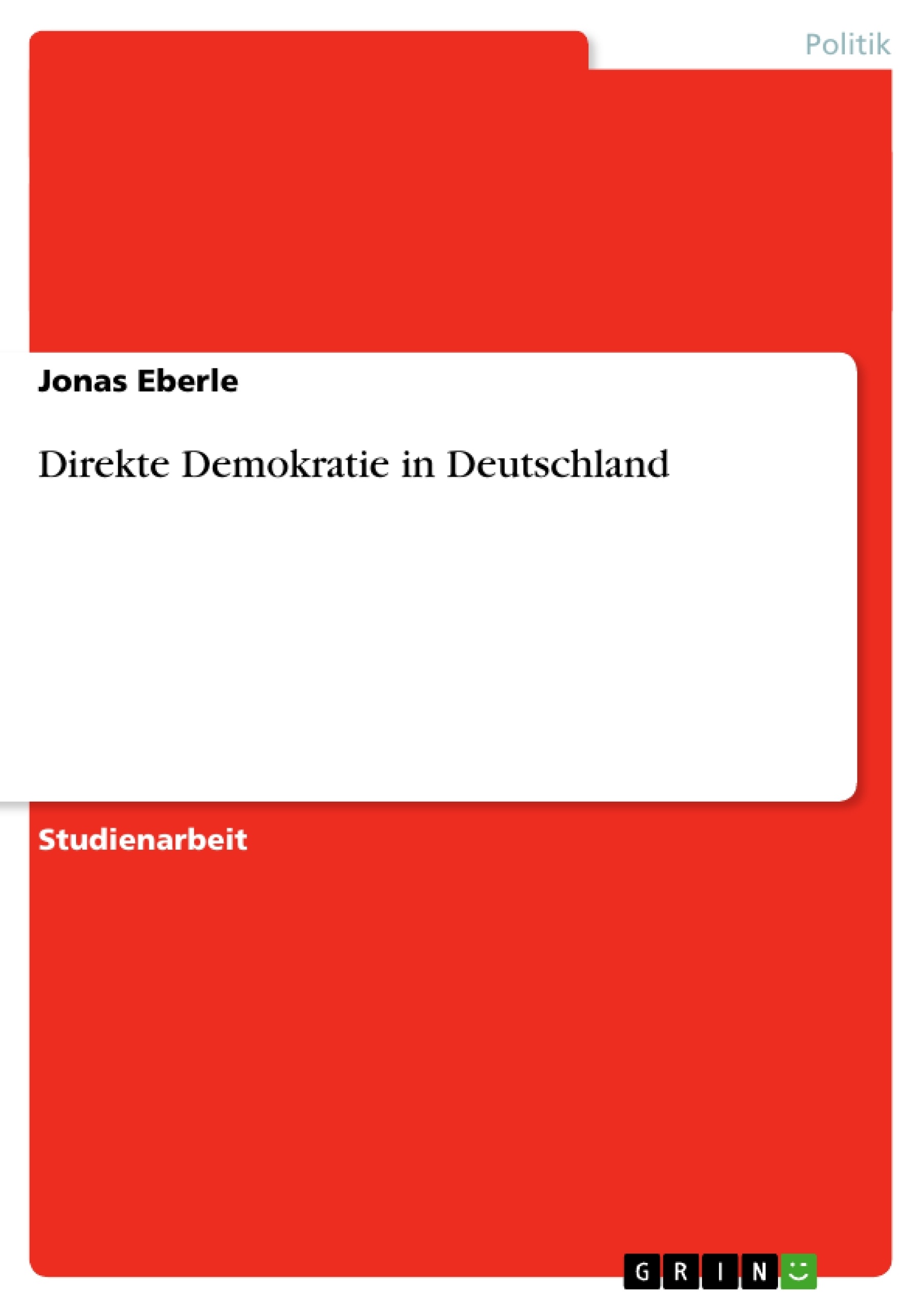Die Frage nach der Art und dem Wesen politischer Herrschaft ist sicherlich die älteste
politische Frage überhaupt, und sie stellt sich bis heute. Sie ist eine Frage der erfass- und
verallgemeinerbaren Faktoren, doch auch des Menschenbildes und der individuellen
Erfahrungen. Und da sich beides wandeln kann, ist das Ergebnis immer den Voraussetzungen
geschuldet. Die verbreitetste Antwort auf diese Frage ist die Demokratie. In mehreren
„Demokratisierungswellen“ überzog sie die Erde und brachte die Ideale Freiheit
(Volkssouveränität) und politische Gleichheit zu den Menschen. Doch ist Demokratie nicht
gleich Demokratie. Die Ausgestaltung der Volkssouveränität variiert von den unmittelbarsten
Formen (Versammlungsdemokratie) bis hin zu scheindemokratischen Diktaturen.
Der Ansatz der direkten Demokratie versucht, die Unmittelbarkeit der Volksherrschaft zu
erhöhen. Diesem Ansatz sind bisher etwa die Hälfte aller Staaten gefolgt (Volksentscheide auf
nationaler Ebene)1. In Deutschland ist dagegen der Status der direkten Demokratie auf
Bundesebene kümmerlich.
Der Wiedervereinigungsprozess löste in Deutschland eine Debatte um das Wesen der
Demokratie aus, die 1992 in der Gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und
Ländern institutionalisiert wurde. In ihr ging es auch um Fragen der Einführung
direktdemokratischer Elemente ins Grundgesetz.
Diese Arbeit soll den Status direkter Demokratie in Deutschland beleuchten, einen Überblick
über zugrundeliegende Theorien liefern, Formen direkter Demokratie erläutern sowie
Anregungen zur Frage der Umsetzbarkeit im politischen sowie der Akzeptanz im
gesellschaftlichen System geben. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Einführung
direktdemokratischer Elemente vor allem nach der Wiedervereinigung große Chancen hatte.
1 Vgl. Tiefenbach, Paul.: Direkte Demokratie im internationalen Vergleich, www.mehrdemokratie.
de/bu/dd/international.htm
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Zur Geschichte direkter Demokratie in Deutschland bis 1990.
- II. Demokratietheorie
- II.1. Grundlagen
- II.2. Repräsentative vs. partizipative Demokratietheorie
- III. Implementierung direkter Demokratie
- III.1. Spielarten direkter Demokratie
- III.2. Empirische Vorbilder
- III.3. Direkte Demokratie als Faktor der Systemtransformation
- IV. Der Beginn der Verfassungsdebatte um direkte Demokratie
- IV.1. Der Wiedervereinigungsprozess
- IV.2. Politische Kultur
- IV.3. Argumente der Befürworter und Gegner direkter Demokratie
- V. Outcome der Debatte
- V.1. Die Verfassungskommission
- V.2. Die neueren politischen Entwicklungen
- VI. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Status der direkten Demokratie in Deutschland, insbesondere im Kontext der Wiedervereinigung und der anschließenden Verfassungsdebatte. Ziel ist es, einen Überblick über zugrundeliegende Theorien, Formen der direkten Demokratie und ihre Umsetzbarkeit im politischen System zu liefern. Dabei wird die Frage der Akzeptanz direkter Demokratie in der Gesellschaft behandelt.
- Direkte Demokratie in Deutschland: Historische Entwicklung und aktueller Status
- Theorien der Demokratie: Repräsentative vs. partizipative Modelle
- Formen direkter Demokratie: Volksentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerinitiativen
- Einfluss der Wiedervereinigung auf die Verfassungsdebatte um direkte Demokratie
- Akzeptanz und Umsetzbarkeit direkter Demokratie in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der politischen Herrschaft und die unterschiedlichen Ausprägungen der Demokratie ein. Sie beleuchtet den Ansatz der direkten Demokratie und ihre Bedeutung in Deutschland, insbesondere im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung.
- I.1. Zur Geschichte direkter Demokratie in Deutschland bis 1990.: Dieser Abschnitt beleuchtet die Geschichte direkter Demokratie in Deutschland, angefangen mit der Weimarer Republik bis zur Gründung der Bundesrepublik. Er analysiert die Rolle von Volksentscheiden und Bürgerbeteiligung in diesen Epochen und die Gründe für die strikte Ablehnung direkter Demokratie im Grundgesetz von 1949.
- II. Demokratietheorie: Dieses Kapitel behandelt die grundlegenden Theorien der Demokratie, wie z.B. die Volkssouveränität und die politische Gleichheit der Bürger. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen repräsentativen und partizipativen Demokratietheorien und deren Relevanz für die Debatte um direkte Demokratie in Deutschland.
- III. Implementierung direkter Demokratie: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Spielarten der direkten Demokratie, wie z.B. Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerinitiativen. Es analysiert empirische Vorbilder anderer Länder und die Rolle der direkten Demokratie als Faktor der Systemtransformation.
- IV. Der Beginn der Verfassungsdebatte um direkte Demokratie: Dieses Kapitel analysiert die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland nach der Wiedervereinigung und die Entstehung der Debatte um die Einführung direkter Demokratie. Es untersucht den Wiedervereinigungsprozess, die politische Kultur und die Argumente von Befürwortern und Gegnern direkter Demokratie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Direkte Demokratie, Repräsentative Demokratie, Partizipative Demokratie, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerinitiative, Verfassungskommission, Wiedervereinigungsprozess, politische Kultur und Systemtransformation. Die Arbeit analysiert insbesondere die Debatte um die Einführung direkter Demokratie in Deutschland und die Relevanz dieser Thematik im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des Landes.
- Quote paper
- Jonas Eberle (Author), 2003, Direkte Demokratie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17097