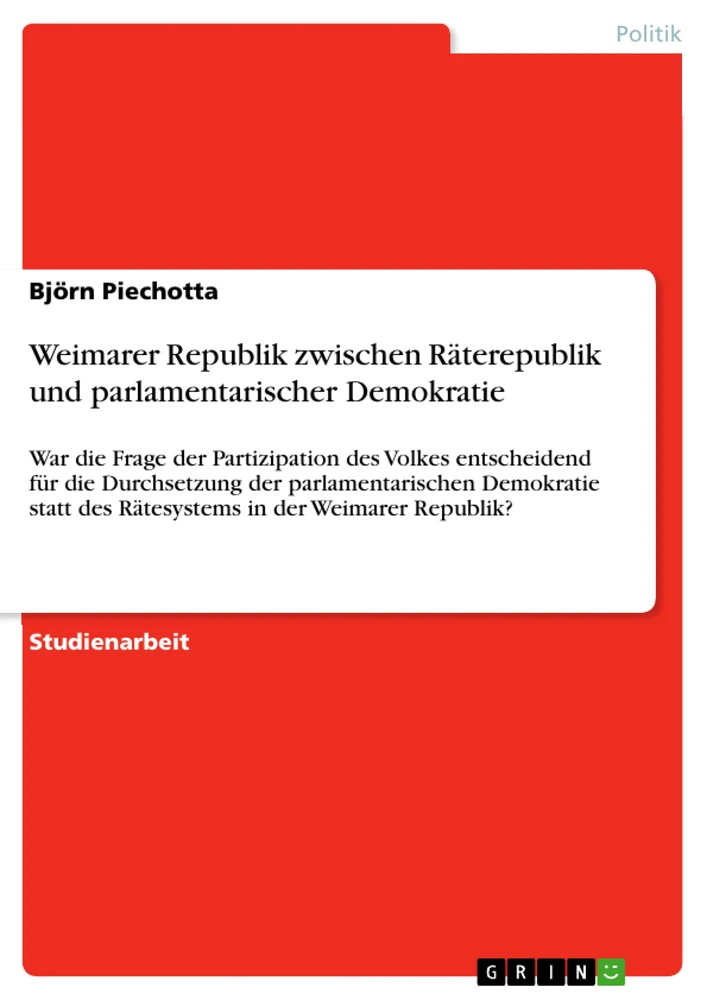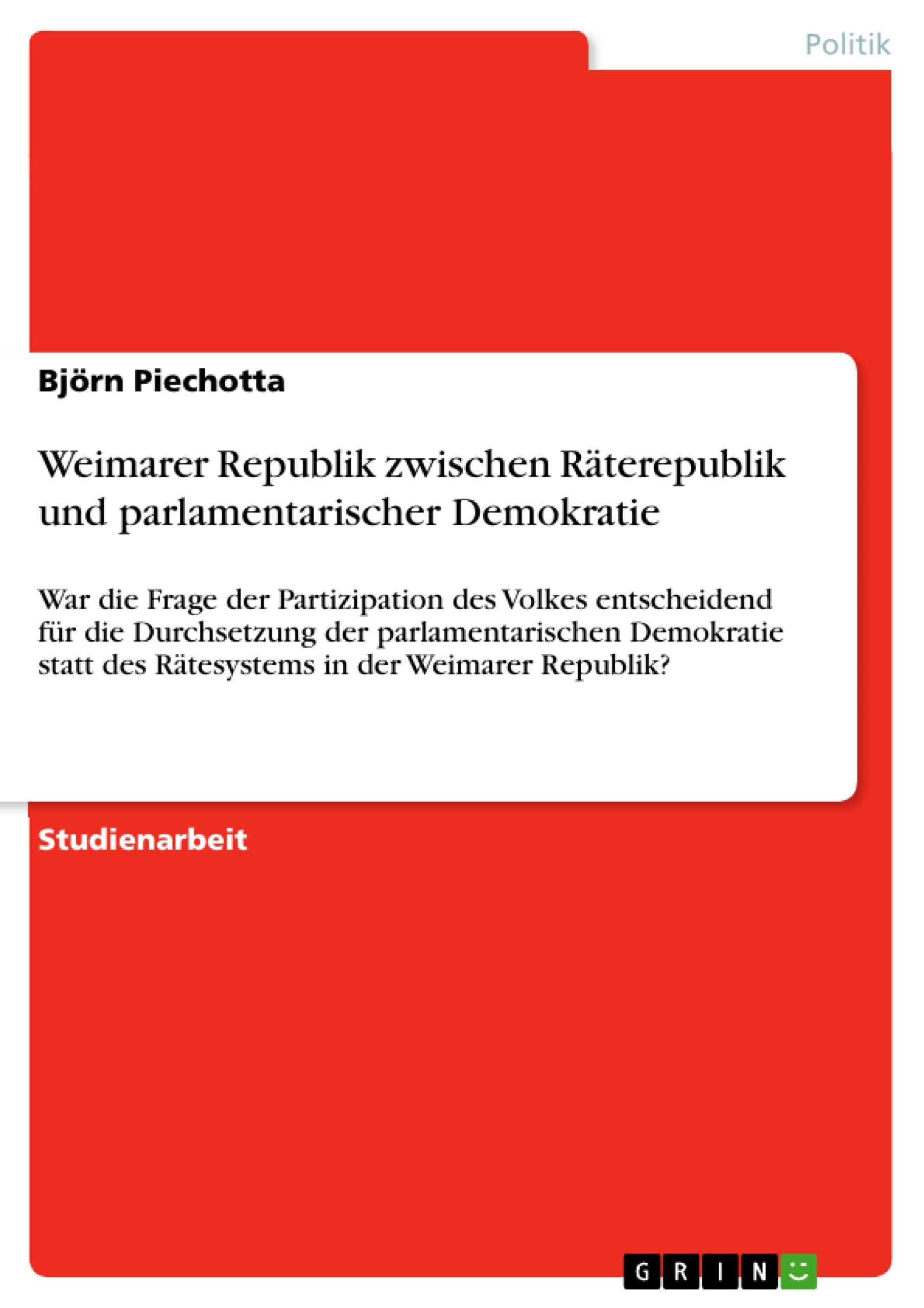Als Kaiser Wilhelm II. am 9. November 1918 mehr oder minder freiwillig seinen Thronverzicht verkündete und sich in sein niederländisches Exil begab, wurde das Neue, die deutsche Republik geboren. Diese hastig ausgerufene Republik, die spätere Generationen als die „Weimarer Republik“ bezeichneten, sollte sich gleich am ersten Tage ihres Bestehens einer fundamentalen Frage stellen:
Scheidemann oder Liebknecht? Beziehungsweise parlamentarische Demokratie oder sozialistische Räterepublik? Aufgrund dieses Streitpunktes kam es vielerorts in Deutschland und Europa zu gewalttätigen Auseinandersetzungen der jeweiligen Befürworter und Gegner zweier Systeme, die sich selbst als Repräsentanten des Volkes oder zumindest dessen bezeichneten, was ihnen vermeintlich Unterstützung zusagte. Doch worin bestanden die Stärken und die Schwächen der parlamentarischen Demokratie als auch des Rätesystems? Diese als Notlösung entstandene parlamentarische Demokratie war offensichtlich den Umständen des Zusammenbruchs der Monarchie und dem praktisch schon längst verlorenem Kriege zu verdanken (vgl. Eschenburg 1984, S. 13). Auf der Nationalversammlung des Jahres 1919 fand diese Regierungsform in der dort verabschiedeten Verfassung des Deutschen Reichs keine direkte Erwähnung, sondern ergab sich einzig aus den in der Reichsverfassung enthaltenen Zusammenhängen (vgl. Artikel 1 Verfassung DR 1919). Strittig ist unter Historikern und Politologen zudem, ob infolge der Nationalversammlung des Jahres 1919 überhaupt ein echtes parlamentarisches System eingeführt wurde, da Artikel 48 der Verfassung von Weimar dem Reichspräsidenten eine auf Wahlen begründete Diktatur zugestand (vgl. Gottschalch 1973, S. 10).
In der Frage des Theorienvergleichs zwischen der parlamentarischen Demokratie und des Rätesystems lassen sich vielfältige Medien zu Rate ziehen. Für die Erforschung der Zeit zwischen der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung kommt man nicht um die Publikationen von Rosa Luxemburg herum, wenn es darum geht, antidemokratisches Denken in der Entstehungsphase der Weimarer Republik zu erfassen. Jedoch ist der Begriff der Demokratie abhängig von der jeweiligen ideologischen Einstellung damaliger Akteure zu betrachten. So gab es Konzeptionen der Rätedemokratie, der bürgerlichen - liberalen Demokratie nach Hans Kelsen oder der sozialen Demokratie nach Max Adler.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hat der parlamentarische Demokratiegedanke der Weimarer Republik grundlegende Schwächen?
- 2.1 Welche Bedeutungen haben „Freiheit“ und „Gleichheit“ in der parlamentarischen Demokratie?
- 2.2 Wie viel Macht geht vom Volke aus?
- 2.3 Ist die Gewaltenteilung ein wirksames Element zur Wahrung der Volkssouveränität?
- 3 Welche Stärken und Schwächen besitzt das Rätesystem?
- 3.1 Vom wem soll die Macht im Rätesystem ausgehen?
- 3.2 Ermöglicht das imperative Mandat eine direktere Mitbestimmung des Wählers?
- 3.3 Ist die Interessenidentität von Legislative, Exekutive und Judikative ein effektives Mittel zur Ausführung des Wählerwillens?
- 4 Die Gegenüberstellung von parlamentarischer Demokratie und Rätesystem in der Frage der Partizipation.
- 4.1 Unvereinbarkeiten zwischen der parlamentarischen Demokratie und dem Rätesystem
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Durchsetzung der parlamentarischen Demokratie gegenüber dem Rätesystem in der Weimarer Republik. Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme im Hinblick auf die Partizipation des Volkes und vergleicht deren theoretische Konzepte mit der praktischen Umsetzung.
- Vergleich der parlamentarischen Demokratie und des Rätesystems
- Analyse der Volkssouveränität in beiden Systemen
- Bedeutung von Freiheit und Gleichheit in der Weimarer Republik
- Bewertung der Gewaltenteilung im Kontext der Partizipation
- Unvereinbarkeiten zwischen parlamentarischer Demokratie und Rätesystem
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt den historischen Kontext der Entstehung der Weimarer Republik. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung der Partizipation für die Durchsetzung der parlamentarischen Demokratie gegenüber dem Rätesystem. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs von Theorie und Praxis beider Systeme und benennt relevante wissenschaftliche Literatur.
2 Hat der parlamentarische Demokratiegedanke der Weimarer Republik grundlegende Schwächen?: Dieses Kapitel untersucht die grundlegenden Schwächen des parlamentarischen Demokratiegedankens in der Weimarer Republik. Es wird dargelegt, dass der deutsche Parlamentarismus vor 1918 keine Erfahrung mit einem demokratischen Parteiensystem hatte und das Aufkommen des Rätesystems als Konkurrenzmodell eine weitere Herausforderung darstellte. Die mangelnde Erfahrung mit Eigenverantwortung, die fehlende Parteienmehrheit nach der Nationalversammlung 1919 und die kurze Lebensdauer der Reichsregierungen werden als Schwächen identifiziert. Zusätzlich wird die Ignoranz der Verfassungsschöpfer gegenüber antidemokratischen Kräften als problematisch betrachtet. Trotz dieser Mängel betont der Text die Grundlage des Systems auf wohlüberlegten Prinzipien.
3 Welche Stärken und Schwächen besitzt das Rätesystem?: Dieses Kapitel beleuchtet das Rätesystem und dessen Stärken und Schwächen im Vergleich zur parlamentarischen Demokratie. Es werden Fragen nach der Quelle der Macht im Rätesystem, der direkten Mitbestimmung durch das imperative Mandat und der Effektivität der Interessenidentität von Legislative, Exekutive und Judikative untersucht. Der Fokus liegt darauf, die theoretischen Konzepte des Rätesystems zu analysieren und deren Potenzial für die Volkssouveränität zu bewerten.
4 Die Gegenüberstellung von parlamentarischer Demokratie und Rätesystem in der Frage der Partizipation: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Systeme im Hinblick auf die Volkspartizipation. Es untersucht die Unvereinbarkeiten zwischen parlamentarischer Demokratie und Rätesystem. Der Vergleich soll die unterschiedlichen Konzepte von Partizipation herausarbeiten und klären, inwieweit die jeweilige Form der Partizipation die Durchsetzung des einen oder anderen Systems begünstigte.
Schlüsselwörter
Parlamentarische Demokratie, Rätesystem, Weimarer Republik, Volkssouveränität, Partizipation, Freiheit, Gleichheit, Gewaltenteilung, imperative Mandat, antidemokratisches Denken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Parlamentarische Demokratie vs. Rätesystem in der Weimarer Republik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Durchsetzung der parlamentarischen Demokratie gegenüber dem Rätesystem in der Weimarer Republik. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Systeme hinsichtlich der Partizipation des Volkes und vergleicht deren theoretische Konzepte mit der praktischen Umsetzung.
Welche Systeme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die parlamentarische Demokratie und das Rätesystem der Weimarer Republik. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ihrer jeweiligen Konzepte der Volkssouveränität und Partizipation.
Welche Aspekte der Systeme werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit in beiden Systemen, die Rolle der Gewaltenteilung, die Effektivität des imperativen Mandats im Rätesystem und die Unvereinbarkeiten zwischen beiden Modellen. Die Arbeit untersucht auch, wie die theoretischen Konzepte in der Praxis umgesetzt wurden.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Zentrale Fragen sind: Hat die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik grundlegende Schwächen? Welche Stärken und Schwächen besitzt das Rätesystem? Wie lässt sich die Volkssouveränität in beiden Systemen bewerten? Wie unterscheiden sich die Konzepte der Partizipation, und welche Rolle spielten sie bei der Durchsetzung der jeweiligen Systeme?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Analyse der Schwächen der parlamentarischen Demokratie, Analyse der Stärken und Schwächen des Rätesystems, Vergleich beider Systeme hinsichtlich der Partizipation und ein Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Vergleich der parlamentarischen Demokratie und des Rätesystems in der Weimarer Republik zu liefern und deren jeweilige Eignung zur Gewährleistung der Volkssouveränität und Partizipation zu bewerten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Parlamentarische Demokratie, Rätesystem, Weimarer Republik, Volkssouveränität, Partizipation, Freiheit, Gleichheit, Gewaltenteilung, imperatives Mandat, antidemokratisches Denken.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Arbeit vergleicht die theoretischen Konzepte der parlamentarischen Demokratie und des Rätesystems mit deren praktischer Umsetzung in der Weimarer Republik. Sie stützt sich auf relevante wissenschaftliche Literatur.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung fasst die zentralen Aussagen jedes Kapitels zusammen: Die Einleitung beschreibt den Kontext und die Forschungsfrage; Kapitel 2 analysiert die Schwächen der parlamentarischen Demokratie; Kapitel 3 analysiert Stärken und Schwächen des Rätesystems; Kapitel 4 vergleicht beide Systeme hinsichtlich der Partizipation; und das Fazit zieht abschließende Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Björn Piechotta (Author), 2009, Weimarer Republik zwischen Räterepublik und parlamentarischer Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169751