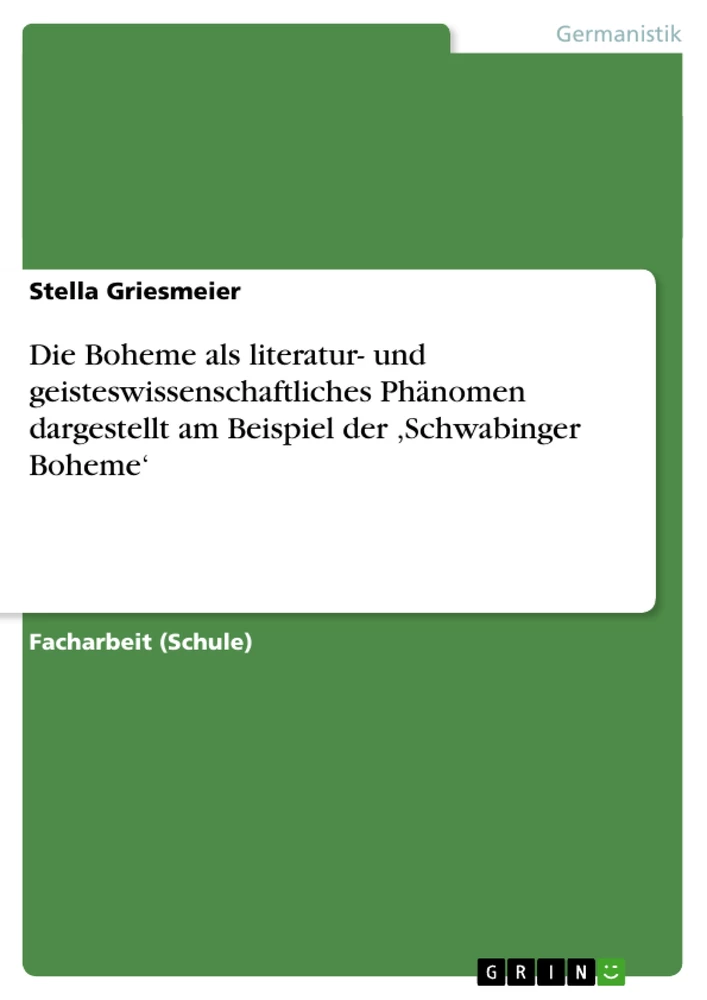Die Boheme wurde in der Kunstgeschichte unzählige Male beschrieben,
idealisiert, besungen, in Verse gefasst, analysiert oder für lächerlich erklärt und ist auch heute noch ein viel besprochenes Thema. Henri Murger, der sich als wahrer Bohemien sah, meinte seinerzeit, dass „die Boheme nur in Paris existiert und nur dort möglich ist.“(1) Das wirft die Frage auf, ob die Pariser Boheme wirklich einzigartig war. Um diese Frage beantworten zu können, wird
zunächst der Begriff erläutert und dann die Boheme definiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der Schwabinger Boheme herauszufinden, was genau das Phänomen der Boheme ausmacht und ob sich die Münchner Boheme wirklich von der Pariser unterscheidet.
Die Tagebücher des Oscar A. H. Schmitz, eines deutschen Autors, Philosophen und Mitglieds der Schwabinger Boheme, werden hierzu als Grundlage dienen.
Der Schwerpunkt liegt auf den Auszügen des Tagebuches „Das wilde Leben der Boheme“, das in den Jahren von 1896 bis 1906 entstand.
,Bohémien‘ ist seit seinem ersten Auftreten im 15. Jahrhundert in Frankreich das Wort für Zigeuner. Ursprünglich hatte das Wort eine sehr negative Bedeutung, da geglaubt wurde, dass die „Wanderschaft ihnen als Buße auferlegt sei“(2), weshalb nicht nur ihr nomadenhaftes Umherziehen, sondern ihr ganzer Lebensstil als lasterhaft und verwerflich galt.
Auch heute werden heimatlose oder obdachlose Menschen oft Zigeuner
genannt und ihre Lebensweise verachtet. Was Heimatlose und Obdachlose
jedoch verbindet, ist gerade das, was den Begriff ,Bohémien‘ wandelte, nämlich nicht sesshaft zu sein, sondern umherzuziehen. Denn in einer Gesellschaft, die eine gefestigte Familie und einen festen Wohnort erwartet, sind Zigeuner immer eine Randgruppe.
[...]
______
(1) Henri Murger: Boheme, S.12
(2) Helmut Kreuzer: Die Boheme, S.1
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs „Boheme“
- Voraussetzungen für die Entstehung der Boheme
- Der „Juste-Milieu-Hass“ als Antrieb der Boheme
- Das Ende der Boheme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Phänomen der Boheme am Beispiel der Schwabinger Boheme. Ziel ist es, die charakteristischen Merkmale der Boheme herauszuarbeiten und zu analysieren, ob und inwiefern sich die Münchner Boheme von der Pariser Boheme unterscheidet. Die Arbeit stützt sich dabei auf die Tagebücher von Oscar A. H. Schmitz.
- Definition und Entwicklung des Begriffs „Boheme“
- Soziokulturelle und wirtschaftliche Voraussetzungen für die Entstehung der Boheme
- Der „Juste-Milieu-Hass“ als treibende Kraft des bohemianischen Lebensstils
- Der Einfluss politischer Strömungen auf das Ende der Boheme
- Vergleich zwischen der Pariser und der Schwabinger Boheme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Boheme ein und stellt die Forschungsfrage nach den Besonderheiten der Schwabinger Boheme im Vergleich zur Pariser Boheme. Sie benennt die verwendeten Quellen, insbesondere die Tagebücher von Oscar A. H. Schmitz, und skizziert den Forschungsansatz.
Definition des Begriffs „Boheme“: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs „Boheme“, beginnend mit seiner ursprünglichen negativen Konnotation im Zusammenhang mit Zigeunern. Es wird die semantische Wandlung hin zu einer Beschreibung eines spezifischen Künstlertypus nachgezeichnet und der Einfluss von Henri Murger's Roman „Boheme“ hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Herausbildung des Begriffs als Bezeichnung für Künstler mit abweichenden Lebensformen und ihrem Milieu.
Voraussetzungen für die Entstehung der Boheme: Dieses Kapitel analysiert die sozioökonomischen Bedingungen, die die Entstehung der Boheme ermöglichten. Es werden Faktoren wie die Entwicklung eines freien Marktes für Kunst und Literatur durch den Buchdruck, die Emanzipation des Künstlers von der Abhängigkeit von Mäzenen und die zunehmende Massennachfrage nach Kunst als essentiell für das Aufkommen der Boheme herausgestellt. Die Kapitel erklärt, wie diese Entwicklungen den Nährboden für einen bohemianischen Lebensstil schafften.
Der „Juste-Milieu-Hass“ als Antrieb der Boheme: Hier wird der „Juste-Milieu-Hass“, die Ablehnung des gesellschaftlichen Mittelmaßes, als zentrale Triebkraft des bohemianischen Lebensstils identifiziert. Die Abkehr von bürgerlichen Konventionen und Werten, die Hinwendung zu Extremen im Lebensstil und im Umgang mit Geld, sowie die Betonung von Spontaneität und Abenteuerlust werden im Detail analysiert und anhand von Beispielen aus den Tagebüchern von Oscar A. H. Schmitz illustriert.
Das Ende der Boheme: Dieses Kapitel behandelt die Faktoren, die zum Ende der Boheme führten, insbesondere den Einfluss des aufkommenden Nationalsozialismus in München. Es wird die schrittweise Auflösung des bohemianischen Milieus durch politische Repression, Emigration und die Spaltung durch unterschiedliche politische Überzeugungen beschrieben. Die Kapitel zeigt, wie politische Ereignisse und ideologische Konflikte die Grundlage des Gemeinschaftsgefühls untergraben und die Existenz der Boheme unmöglich machten.
Schlüsselwörter
Boheme, Schwabinger Boheme, Pariser Boheme, Oscar A. H. Schmitz, Künstlerleben, abweichende Lebensformen, Juste-Milieu-Hass, soziale Kritik, politischer Einfluss, Kunstmarkt, Emanzipation, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Schwabinger Boheme
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Phänomen der Boheme, insbesondere die Schwabinger Boheme in München, und vergleicht sie mit der Pariser Boheme. Im Mittelpunkt steht die Analyse der charakteristischen Merkmale des bohemianischen Lebensstils und die Untersuchung der Gründe für dessen Entstehung und Ende.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf den Tagebüchern von Oscar A. H. Schmitz. Diese Tagebücher liefern detaillierte Einblicke in das Leben und die Erfahrungen der Schwabinger Boheme.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte die charakteristischen Merkmale der Boheme herausarbeiten und analysieren, ob und inwiefern sich die Münchner Boheme von der Pariser Boheme unterscheidet. Es geht darum, die soziokulturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung der Boheme zu verstehen und die Faktoren zu identifizieren, die zu ihrem Ende führten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition und Entwicklung des Begriffs „Boheme“, die soziokulturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Entstehung der Boheme, den „Juste-Milieu-Hass“ als treibende Kraft des bohemianischen Lebensstils, den Einfluss politischer Strömungen auf das Ende der Boheme und einen Vergleich zwischen der Pariser und der Schwabinger Boheme.
Wie wird der Begriff „Boheme“ definiert?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs „Boheme“ von seiner ursprünglichen negativen Konnotation bis hin zu seiner Verwendung als Bezeichnung für einen spezifischen Künstlertypus mit abweichenden Lebensformen. Der Einfluss von Henri Murger's Roman „Boheme“ wird dabei hervorgehoben.
Welche Voraussetzungen ermöglichten die Entstehung der Boheme?
Die Arbeit analysiert sozioökonomische Faktoren wie die Entwicklung eines freien Marktes für Kunst und Literatur, die Emanzipation des Künstlers von der Abhängigkeit von Mäzenen und die zunehmende Massennachfrage nach Kunst als essentiell für das Aufkommen der Boheme.
Welche Rolle spielt der „Juste-Milieu-Hass“?
Der „Juste-Milieu-Hass“, die Ablehnung des gesellschaftlichen Mittelmaßes, wird als zentrale Triebkraft des bohemianischen Lebensstils identifiziert. Die Abkehr von bürgerlichen Konventionen und die Hinwendung zu Extremen im Lebensstil werden detailliert analysiert.
Warum endete die Boheme?
Das Ende der Boheme wird im Zusammenhang mit dem aufkommenden Nationalsozialismus in München erklärt. Politische Repression, Emigration und die Spaltung durch unterschiedliche politische Überzeugungen führten zur Auflösung des bohemianischen Milieus.
Wie werden die Schwabinger und die Pariser Boheme verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Schwabinger und die Pariser Boheme, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Merkmalen und ihrer Entwicklung aufzuzeigen. Der Vergleich dient dazu, die Besonderheiten der Schwabinger Boheme besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Boheme, Schwabinger Boheme, Pariser Boheme, Oscar A. H. Schmitz, Künstlerleben, abweichende Lebensformen, Juste-Milieu-Hass, soziale Kritik, politischer Einfluss, Kunstmarkt, Emanzipation, Nationalsozialismus.
- Citar trabajo
- Stella Griesmeier (Autor), 2011, Die Boheme als literatur- und geisteswissenschaftliches Phänomen dargestellt am Beispiel der ,Schwabinger Boheme‘, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169601