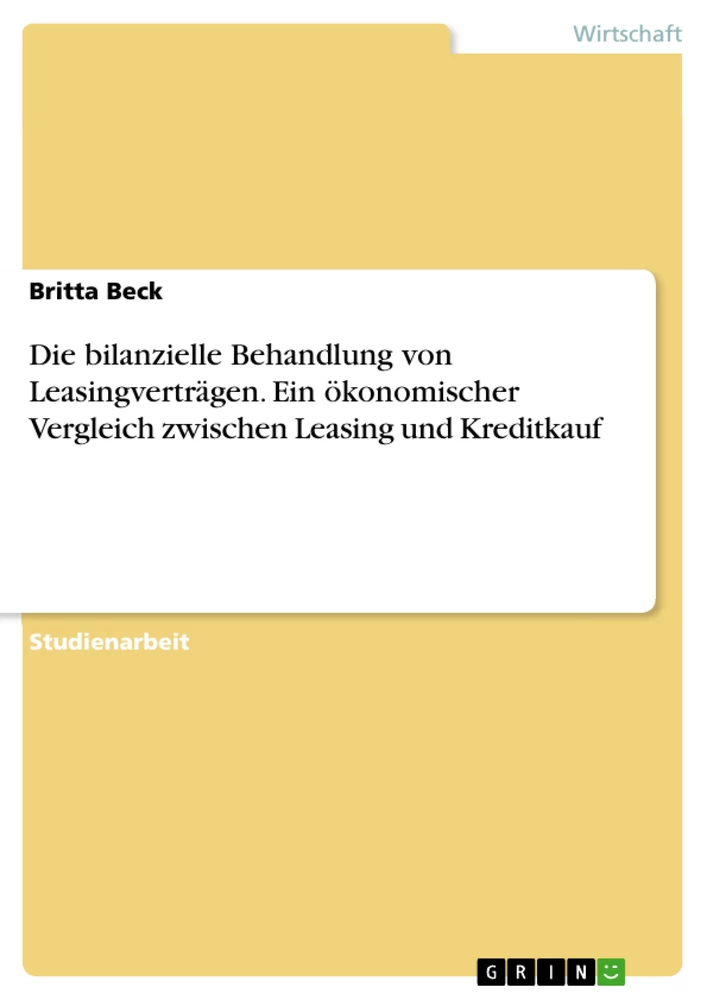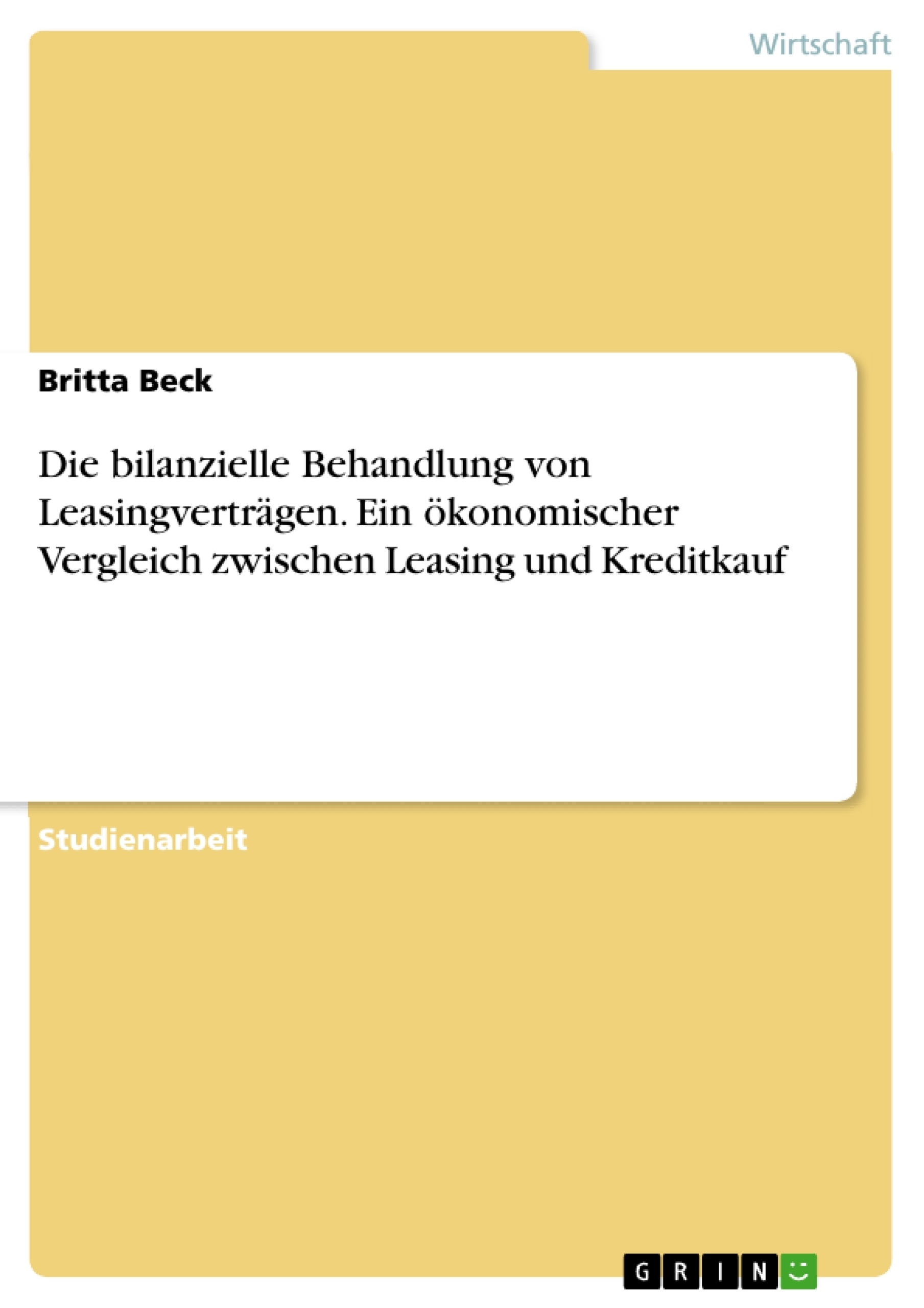Bereits im vierten Jahrhundert v.Chr. stellte Aristoteles fest, dass Reichtum vielmehr im Gebrauch als im Eigentum liegt. Die eigentumslose Nutzung von Gütern als Kerngedanke des Leasings ist schon seit vielen Jahrhunderten im Wirtschaftsleben anzutreffen. Die Regierung Athens vergab beispielsweise Erzminen an ihre Bürger. Es waren dem Leasing entsprechende Vertragsverhältnisse mit Gewinnbeteiligung.
Leasing hat sich im Laufe der Zeit stets weiterentwickelt und ist zu einer anerkannten Finanzierungsform geworden. In Deutschland wurden im Jahr 2000 rund 15% der gesamtwirtschaftlichen Investitionen geleast. Es stellt sich die Frage, warum diese Entwicklung in solch einem Maße stattfand. Die Leasingbranche wirbt mit einer Vielzahl von Vorteilen dieses Finanzierungsinstrumentes. Besonders hervorgehoben wird dabei der Off-Balance-Charakter und die damit verbundenen steuerlichen und bilanzpolitischen Effekte.
Um genau diese Auswirkungen geht es auch hauptsächlich in folgender Arbeit. Ziel ist es, Leasing vorzustellen und zu prüfen, ob die "Lobesgesänge" der Leasinggesellschaften gerechtfertigt sind. Im Kapital zwei wird zunächst einmal der Begriff "Leasing" definiert. Der nächste Abschnitt konzentriert sich auf das Finanzierungs-Leasing und seine Ausprägungen, wobei verschiedene Vertragsvarianten vorgestellt werden. Anschließend werden die Auswirkungen in den Bilanzen der Beteiligten betrachtet. Kapitel vier beleuchtet die Frage "Leasing oder Kreditkauf" näher. Hierin liegt der Schwerpunkt der Arbeit, da positive Effekte nur als reale Vorteile gelten, wenn andere Finanzierungsinstrumente diese nicht auch aufweisen. Neben der Bilanzneutralität, der Gewinnsituation, der steuerlichen Lage und der Liquidität werden auch Argumente wie Flexibilität, Risiko und Dienstleistungen betrachtet. Auf aktuelle Veränderungen durch neue Gesetzesentwürfe und deren Einfluss auf das Leasing als Finanzierungsinstrument wird im fünften Abschnitt eingegangen. Im Fazit werden die gewonnenen Erkenntnisse kurz zusammengefasst und es wird geprüft, ob es möglich ist, eine generelle Aussage über die Vorteilhaftigkeit des Leasings zu treffen bzw. ob diese auf die Bilanzierungsbesonderheiten zurückzuführen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 3. Finanzierungs-Leasing
- 3.1 Definition
- 3.2 Vereinbarungen nach der Grundmietzeit
- 3.2.1 Vollamortisation
- 3.2.2 Teilamortisation
- 3.3 Auswirkungen in der Bilanz
- 3.3.1 Hinzurechnung des Leasinggutes beim Leasingnehmer
- 3.3.2 Hinzurechnung des Leasinggutes beim Leasinggeber
- 4. Kreditkauf oder Leasing – betriebswirtschaftliche Aspekte aus Leasingnehmersicht
- 4.1 Quantitative Aspekte
- 4.1.1 Kosten
- 4.1.2 Steuerkomponente
- 4.1.3 Liquidität
- 4.1.4 Dienstleistungskomponente
- 4.2 Qualitative Aspekte
- 4.2.1 Bilanzstruktureffekt
- 4.2.2 Flexibilität
- 4.2.3 Risiken
- 4.1 Quantitative Aspekte
- 5. Ausblick
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die bilanzielle Behandlung von Leasingverträgen und vergleicht Leasing mit Kreditkauf aus ökonomischer Perspektive. Das Ziel ist es, die Vor- und Nachteile von Leasing zu beleuchten und die Gerechtigkeit der oft gepriesenen Vorteile zu überprüfen.
- Definition und Abgrenzung von Leasing
- Bilanzielle Auswirkungen von Finanzierungsleasing
- Betriebswirtschaftlicher Vergleich von Leasing und Kreditkauf
- Quantitative und qualitative Aspekte des Leasings
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Leasings ein und beleuchtet dessen historische Entwicklung sowie die aktuelle Relevanz in der deutschen Wirtschaft. Sie hebt die Bedeutung der bilanzpolitischen und steuerlichen Effekte hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Prüfung der oftmals propagierten Vorteile von Leasing konzentriert. Die Arbeit zielt darauf ab, Leasing umfassend vorzustellen und zu analysieren, ob die positiven Darstellungen der Leasinggesellschaften gerechtfertigt sind.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Leasing“. Es wird hervorgehoben, dass eine einheitliche Definition in der Praxis und Literatur fehlt, und verschiedene Vertragsformen existieren. Die Arbeit erklärt, dass Leasing im Wesentlichen die eigentumslose Nutzung von Gütern darstellt, wobei der Leasinggeber (LG) dem Leasingnehmer (LN) Vermögensgegenstände gegen Zahlung regelmäßiger Leasingraten überlässt. Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen und bilanzrechtlichen Aspekte, insbesondere die Problematik der Zurechnung des Leasinggegenstands, und erklärt die Wichtigkeit des wirtschaftlichen Eigentums.
3. Finanzierungs-Leasing: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf dem Finanzierungsleasing, einschließlich seiner Definition, verschiedener Vertragsvarianten wie Vollamortisation und Teilamortisation, und der resultierenden Auswirkungen auf die Bilanz des Leasingnehmers und Leasinggebers. Es analysiert detailliert, wie das Leasinggut in der Bilanz beider Parteien ausgewiesen wird, um die unterschiedlichen bilanzpolitischen Implikationen aufzuzeigen. Die verschiedenen Vertragsvereinbarungen nach der Grundmietzeit werden hinsichtlich ihrer bilanzrechtlichen Konsequenzen beleuchtet.
4. Kreditkauf oder Leasing – betriebswirtschaftliche Aspekte aus Leasingnehmersicht: Dieses Kapitel stellt einen zentralen Vergleich zwischen Leasing und Kreditkauf dar. Es untersucht sowohl quantitative Aspekte (Kosten, Steuerkomponente, Liquidität, Dienstleistungskomponente) als auch qualitative Aspekte (Bilanzstruktureffekt, Flexibilität, Risiken). Die Analyse zielt darauf ab, reale Vorteile des Leasings gegenüber dem Kreditkauf herauszustellen und die Bilanzneutralität, die Gewinnsituation, die steuerliche Lage und die Liquidität im Detail zu beleuchten. Die Berücksichtigung qualitativer Faktoren wie Flexibilität und Risiko macht den Vergleich umfassender.
Schlüsselwörter
Leasing, Finanzierungsleasing, Kreditkauf, Bilanzierung, Bilanzpolitik, Steuerrecht, betriebswirtschaftliche Aspekte, quantitative Aspekte, qualitative Aspekte, Vollamortisation, Teilamortisation, wirtschaftliches Eigentum, Risiken, Flexibilität.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Leasing
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Leasing, insbesondere Finanzierungsleasing. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Leasing und Kreditkauf aus betriebswirtschaftlicher Sicht, unter Berücksichtigung bilanzrechtlicher und steuerlicher Aspekte.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Leasing, bilanzielle Auswirkungen von Finanzierungsleasing, betriebswirtschaftlicher Vergleich von Leasing und Kreditkauf (quantitative und qualitative Aspekte), Vollamortisation und Teilamortisation im Finanzierungsleasing, sowie Auswirkungen auf die Bilanz von Leasingnehmer und -geber. Es beleuchtet die Vor- und Nachteile von Leasing und prüft die oft behaupteten Vorteile kritisch.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsbestimmung, Finanzierungsleasing (mit Unterkapiteln zu Definition, Vertragsvereinbarungen nach der Grundmietzeit und bilanzielle Auswirkungen), Vergleich von Leasing und Kreditkauf (quantitative und qualitative Aspekte), Ausblick und Fazit. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der bilanziellen Behandlung von Leasingverträgen und der Vergleich von Leasing mit Kreditkauf aus ökonomischer Sicht. Es soll untersucht werden, ob die oft propagierten Vorteile von Leasing gerechtfertigt sind.
Welche bilanzrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Das Dokument behandelt die bilanzielle Behandlung von Leasingverträgen, insbesondere im Finanzierungsleasing. Es erklärt, wie das Leasinggut in der Bilanz des Leasingnehmers und des Leasinggebers ausgewiesen wird und untersucht die Auswirkungen von Vollamortisation und Teilamortisation auf die Bilanz.
Wie werden Leasing und Kreditkauf verglichen?
Der Vergleich von Leasing und Kreditkauf umfasst quantitative Aspekte wie Kosten, Steuerkomponente, Liquidität und Dienstleistungskomponente sowie qualitative Aspekte wie Bilanzstruktureffekt, Flexibilität und Risiken. Ziel ist es, die tatsächlichen Vorteile des Leasings gegenüber dem Kreditkauf aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Leasing, Finanzierungsleasing, Kreditkauf, Bilanzierung, Bilanzpolitik, Steuerrecht, betriebswirtschaftliche Aspekte, quantitative Aspekte, qualitative Aspekte, Vollamortisation, Teilamortisation, wirtschaftliches Eigentum, Risiken, Flexibilität.
Was ist die Definition von Leasing gemäß des Dokuments?
Das Dokument betont, dass eine einheitliche Definition von Leasing in Praxis und Literatur fehlt. Es beschreibt Leasing im Wesentlichen als die eigentumslose Nutzung von Gütern, bei der der Leasinggeber dem Leasingnehmer Vermögensgegenstände gegen Zahlung regelmäßiger Leasingraten überlässt. Rechtliche und bilanzrechtliche Aspekte, insbesondere die Zurechnung des Leasinggegenstands und das wirtschaftliche Eigentum, werden hervorgehoben.
Was sind Vollamortisation und Teilamortisation?
Vollamortisation und Teilamortisation beschreiben verschiedene Vertragsvereinbarungen nach der Grundmietzeit im Finanzierungsleasing. Sie haben unterschiedliche Auswirkungen auf die bilanzielle Darstellung und werden im Dokument detailliert im Kontext der bilanzrechtlichen Konsequenzen erläutert.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist für Studierende, Wissenschaftler und alle Interessierten relevant, die sich mit Leasing, Bilanzierung und betriebswirtschaftlichen Aspekten auseinandersetzen. Es eignet sich insbesondere für akademische Zwecke zur Analyse von Themen im Bereich des Leasings.
- Quote paper
- Britta Beck (Author), 2001, Die bilanzielle Behandlung von Leasingverträgen. Ein ökonomischer Vergleich zwischen Leasing und Kreditkauf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1691