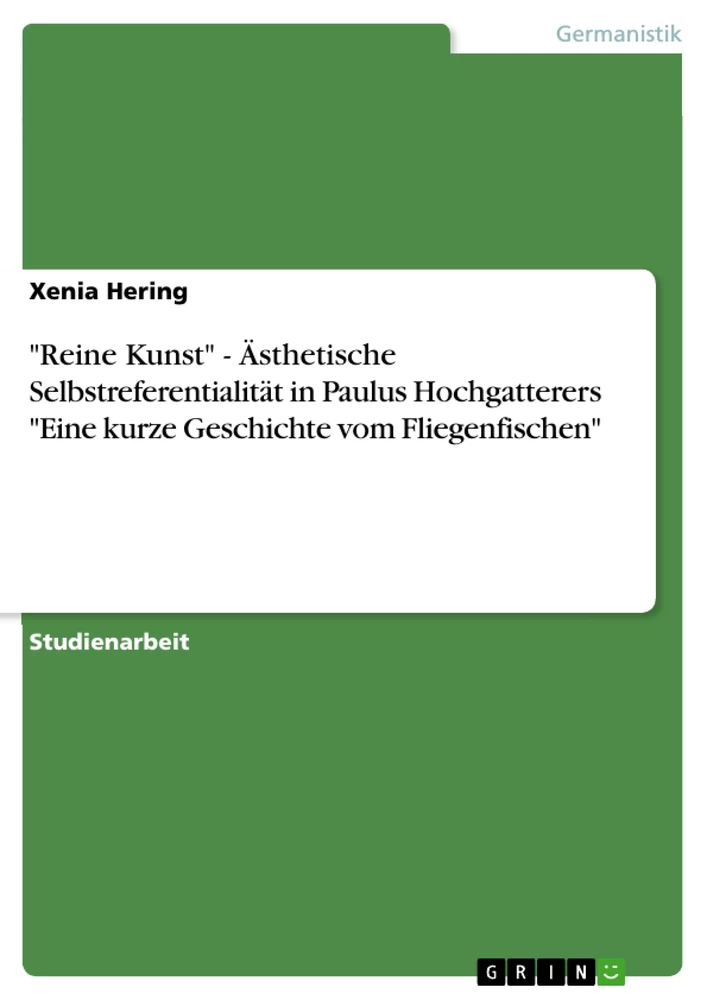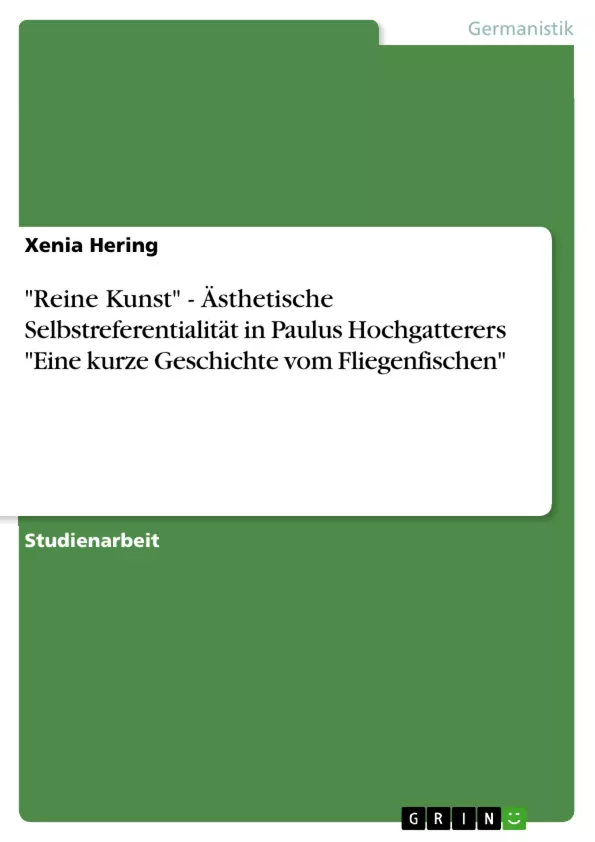Den Begriff der reinen Kunst charakterisiert der Psychoanalytiker Robert Bauer, der von seinen Freunden lediglich als Ire bezeichnet wird, als einer der drei Hauptfiguren in Hochgatteres Werk „Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen“ als „völlig losgelöst von irgendeinem Zweck“ .
Mit dieser Charakterisierung fasst er den Kern der Forderung „L’art pour l’art“, die 1836 von Victor Cousin geprägt wurde, zusammen. Jene postuliert die Befreiung der Kunst von jeglichen außerkünstlerischen Zwecken, d.h. von jeglicher politischen, moralischen, wirtschaftlichen und religiösen Motivation. Das Kunstwerk müsse als eigengesetzliches und eigenwertiges Gebilde angesehen werden, das sich jedwedem Nützlichkeitsdenken entzieht. Folglich soll Kunst als Selbstzweck existieren und der Inhalt gegenüber dem poetischen Schaffensprozess in den Hintergrund treten. Die höchste Priorität obliegt also der künstlerischen Form bzw. der ästhetischen Gestaltung eines Werkes.
Nun wird dieser Begriff aber nicht zufällig genannt. Hochgatterer gibt hier vielmehr einen Hinweis darauf, wie seine „[…] kurze Geschichte vom Fliegenfischen“ gelesen werden muss. Der Inhalt seines Werkes scheint sekundär zu sein und verfügt über keinerlei Nützlichkeitscharakter für den Rezipienten. Er irritiert und provoziert den Leser, der vergeblich versucht die Erzählung auf einen Sinn hin zu verstehen. Dies bleibt jedoch unmöglich. Es stellt sich gezwungenermaßen die Frage, wie man das Buch lesen solle, wenn man doch keinen Sinn im Inhalt erkennt und jener sekundär zu sein scheint. Die Antwort darauf lässt sich in der zuvor aufgeführten Definition der Forderung „L’art pour l’art“ suchen. Hochgatterers Geschichte ist eine Form von reiner Kunst, in der anstatt des Inhalts der poetische Schaffensprozess, d.h. die Selbstreferentialität des Literatursystems, im Vordergrund steht. Daher solle man sich von dem Versuch, den Text interpretieren und verstehen zu wollen, abwenden. Vielmehr müsse man einzelnen Hinwiesen in der Erzählung folgen, um Hochgatterers Werk in seiner Funktion als ästhetische Selbstreferentialität betrachten zu können. Dies soll im Folgenden verwirklicht und dargelegt werden. Aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit des Textes konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf einzelne zu beschreibende und analysierende Aspekte des selbstreferentiellen Literatursystems.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- „L'art pour l'art“ – Realisierung durch Paulus Hochgatterer
- Paulus Hochgatterer - Selbstreflexion als Mittel zur Selbstreferentialität
- Der Ire und der personale Ich-Erzähler – Symbolträger eines selbstreferentiellen Literatursystems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Analyse befasst sich mit der ästhetischen Selbstreferentialität in Paulus Hochgatterers Erzählung „Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen". Der Schwerpunkt liegt darauf, die Funktionsweise dieser Selbstreferentialität zu analysieren und die Rolle der Figuren, insbesondere des Iren, als Symbolträger zu untersuchen.
- Die Bedeutung des Begriffs "L'art pour l'art" in der Erzählung
- Die Selbstreflexion des Autors als Mittel zur Selbstreferentialität
- Die Rolle des Iren als Symbolfigur für die ästhetische Selbstreferentialität
- Die Verflechtung von Realität und Phantasie in der Erzählung
- Die Dekonstruktion von Leserwartungen und die Suche nach Sinn im Werk
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: „L'art pour l'art“ – Realisierung durch Paulus Hochgatterer: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Begriffs "L'art pour l'art" im Kontext der Erzählung und zeigt auf, wie Hochgatterer die Befreiung der Kunst von außerkünstlerischen Zwecken in seinem Werk umsetzt. Das Kapitel analysiert die Szene, in der der Ire die „reine Kunst“ definiert, und stellt die Verbindung zu Hochgatterers literarischer Strategie her.
- Kapitel 2: Paulus Hochgatterer - Selbstreflexion als Mittel zur Selbstreferentialität: Dieses Kapitel widmet sich der Frage, inwieweit die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse des Autors in seiner Erzählung widergespiegelt werden. Es wird untersucht, wie Hochgatterer seine beruflichen Erfahrungen als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in seine literarische Arbeit einfließen lässt und so die Selbstreferentialität seiner Erzählung verstärkt.
- Kapitel 3: Der Ire und der personale Ich-Erzähler – Symbolträger eines selbstreferentiellen Literatursystems: Dieses Kapitel befasst sich mit der Figur des Iren als Symbolfigur für die ästhetische Selbstreferentialität in Hochgatterers Werk. Die rätselhafte Person und ihre Äußerungen werden analysiert und ihre Bedeutung im Kontext der literarischen Strategie des Autors beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselbegriffe der Analyse sind „L'art pour l'art", Selbstreferentialität, ästhetische Selbstreferentialität, Symbolfigur, Psychologie, Realität und Phantasie, Leserwartung, Dekonstruktion und literarische Strategie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „L’art pour l’art“ in Hochgatterers Werk?
Es bezeichnet Kunst, die völlig losgelöst von außerkünstlerischen Zwecken (Moral, Politik) existiert und sich auf ihren eigenen Schaffensprozess konzentriert.
Wer ist die Symbolfigur für die ästhetische Selbstreferentialität?
Der „Ire“ (Robert Bauer) fungiert als zentrale Figur, die den Begriff der „reinen Kunst“ einführt und die Erzählung selbstreferentiell deutet.
Warum irritiert der Inhalt von „Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen“?
Der Inhalt scheint sekundär zu sein; der Text provoziert den Leser, der vergeblich nach einem konventionellen Sinn sucht, und lenkt den Fokus auf die Form.
Wie nutzt Hochgatterer seine Erfahrung als Psychiater im Buch?
Die Arbeit untersucht, wie Hochgatterers beruflicher Hintergrund in die literarische Gestaltung und die Konstruktion der Figuren einfließt.
Was ist das Ziel der ästhetischen Selbstreferentialität?
Das Ziel ist die Darstellung des Literatursystems als geschlossener Kreis, in dem das Werk auf sich selbst und seine eigene Künstlichkeit verweist.
- Quote paper
- Xenia Hering (Author), 2010, "Reine Kunst" - Ästhetische Selbstreferentialität in Paulus Hochgatterers "Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169163